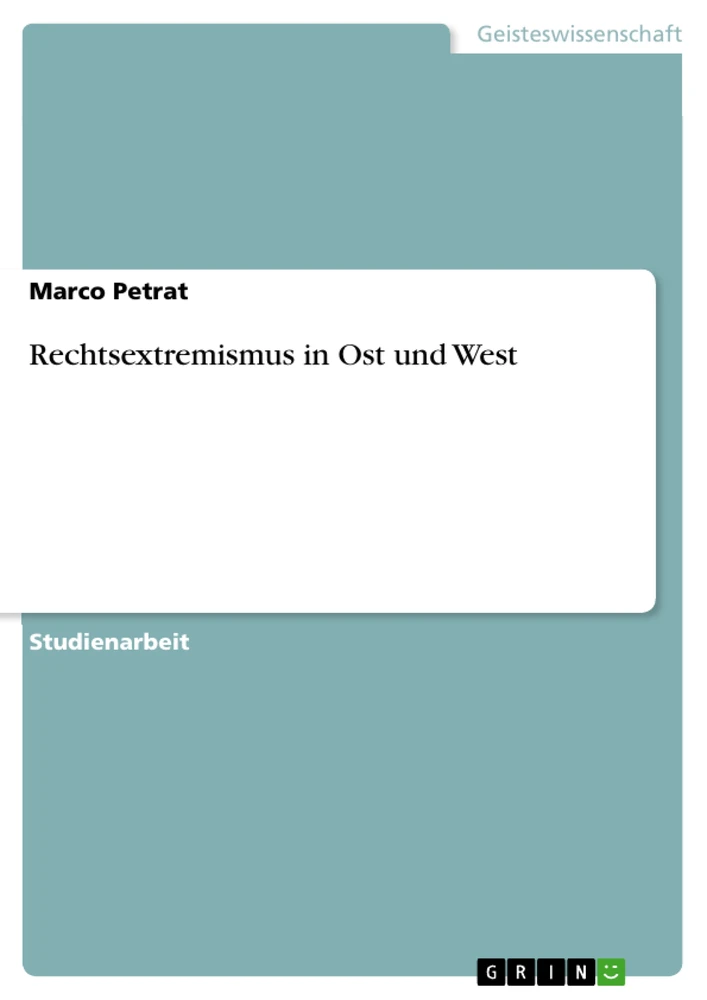14 Jahre lang trieb eine Terrorzelle in Deutschland ihr Unwesen. Sie war u. a. im Zeitraum von 2000 – 2006 für die sogenannten Ceska – Morde, die in weiten Teilen Deutschlands verübt wurden, verantwortlich. Die auch unter den Döner – Morden bekanntgewordene Serie wurde mittels einer Pistole der Marke Ceska begangen. Die aus dem Osten Deutschlands stammenden rechtsextremistischen Täter agierten also länderübergreifend.
Wie also trennt man die rechtsextreme Szene zwischen Ost und West?
Die Hausarbeit behandelt die Unterschiede des Rechtsextremismus im Osten und Westen Deutschlands und befasst sich mit der Frage, in wie weit dieser in den jeweiligen Landesteilen verbreitet ist, in welcher Form er auftritt und wie er sich nach dem 2. Weltkrieg entwickelt hat. Rechtsextremismus ist, nur Deutschland betrachtet, in allen Bundesländern und in vielen sozialen Schichten präsent. Es gibt unterschiedliche Formen des Rechtsextremismus, die sich von der Zweiteilung Deutschlands bis ins 21. Jahrhundert verändert haben. So hatte man früher eher das Bild von einem glatzköpfigen, mit Springerstiefeln und Bomberjacke bekleideten jungen Mann, der zu roher scheinbar willkürlicher Gewalt neigt und dessen Bildungsstand eher in der unteren Mittelschicht angesiedelt war. Heute ist das Bild nicht mehr so eindeutig, da sich immer mehr Männer und auch Frauen unterschiedlicher Altersgruppen dem Rechtsextremismus zuwenden, die sich besser organisieren, in einigen Teilen einen höheren Bildungsstand besitzen und sogar einen in der Gesellschaft angesehenen Beruf ausüben, ohne grundsätzlich Gefahr zu laufen, ins soziale Abseits gedrängt zu werden. Das zeigt u. a. ein Gerichtsurteil des Bundesarbeitsgericht vom 12.05.2011 ( Az: 2 AZR 479/09 ), das die Kündigung eines Mitarbeiters des öffentlichen Dienstes für unwirksam erklärte, da der Betroffene nicht aktiv als Mitglied der NPD gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung gewirkt habe. Grundsätzlich präsentieren sich rechtsorientierte Organisationen, wie die NPD, nach außen eher gesellschaftstauglicher und weniger auffällig, als es noch vor einigen Jahren der Fall war.
Wenn man sich die Homepage der NPD anschaut, muss man schon zwischen den Zeilen lesen, um möglicherweise demokratiefremde Andeutungen zu finden. Dies ist wohl eine Begründung des Erfolges, den die NPD vor allem im Osten auf kommunaler und Landesebene verzeichnet hat.
Das soll aber nicht bedeuten, dass der Rechtsextremismus nicht auch im Westen seine Anhänger findet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Rechtsextremismus in Ost und West
- 2.1 Was ist Rechtsextremismus?
- 2.2 Entwicklung und historischer Hintergrund in Ost und West
- 2.3 Statistiken zu Rechtsextremismus in Ost und West
- 2.4 Motivation und Hintergründe für Rechtsextremismus
- 3. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert die Unterschiede des Rechtsextremismus im Osten und Westen Deutschlands. Sie beleuchtet die Verbreitung, Erscheinungsformen und Entwicklung des Rechtsextremismus in beiden Landesteilen seit dem Zweiten Weltkrieg.
- Definition und Merkmale des Rechtsextremismus
- Historische Entwicklung des Rechtsextremismus in Ost und West
- Verbreitung und Erscheinungsformen des Rechtsextremismus in den neuen und alten Bundesländern
- Motivation und Hintergründe für rechtsextremes Denken und Handeln
- Gewaltbereitschaft und politisch motivierte Taten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung stellt den Kontext der Hausarbeit dar und führt den Leser in die Thematik des Rechtsextremismus in Ost und West ein. Sie beleuchtet die Motivation der Arbeit und die Relevanz des Themas, indem sie auf die Geschichte des Rechtsextremismus in Deutschland und aktuelle Entwicklungen verweist.
2. Rechtsextremismus in Ost und West
Dieses Kapitel untersucht die Unterschiede im Rechtsextremismus zwischen Ost- und Westdeutschland. Es beleuchtet die Entwicklung und den historischen Hintergrund des Rechtsextremismus in beiden Landesteilen und untersucht die Statistiken zu rechtsextremistischen Aktivitäten in Ost und West.
- 2.1 Was ist Rechtsextremismus? Dieses Unterkapitel definiert den Begriff Rechtsextremismus und beleuchtet die verschiedenen Ideologien und Merkmale, die ihn auszeichnen.
- 2.2 Entwicklung und historischer Hintergrund in Ost und West Dieses Unterkapitel untersucht die historischen Wurzeln des Rechtsextremismus in Ost- und Westdeutschland, beginnend mit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und den Auswirkungen der deutschen Teilung.
- 2.3 Statistiken zu Rechtsextremismus in Ost und West Dieses Unterkapitel präsentiert Statistiken über die Verbreitung von Rechtsextremismus in den neuen und alten Bundesländern.
- 2.4 Motivation und Hintergründe für Rechtsextremismus Dieses Unterkapitel beleuchtet die Ursachen und Motivationen für rechtsextremes Denken und Handeln, sowohl in Ost- als auch in Westdeutschland.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe und Themen der Hausarbeit sind Rechtsextremismus, Ostdeutschland, Westdeutschland, historische Entwicklung, Statistiken, Motivation, Gewaltbereitschaft, politisch motivierte Taten, Ideologien, Antisemitismus, Rassismus, Nationalismus, Demokratie, und Verfassungsschutz.
Häufig gestellte Fragen
Wie unterscheidet sich der Rechtsextremismus in Ost- und Westdeutschland?
Die Arbeit untersucht Unterschiede in der Verbreitung, den historischen Wurzeln seit dem 2. Weltkrieg und den spezifischen Erscheinungsformen in den alten und neuen Bundesländern.
Was waren die "Ceska-Morde"?
Es handelt sich um eine Mordserie der rechtsextremen Terrorzelle NSU, die zwischen 2000 und 2006 bundesweit verübt wurde und die länderübergreifende Agitation der Szene verdeutlicht.
Wie hat sich das äußere Bild von Rechtsextremisten gewandelt?
Früher dominierte das Bild des "Glatzkopfes in Springerstiefeln". Heute sind Rechtsextremisten oft besser organisiert, gebildeter und in bürgerlichen Berufen gesellschaftlich integriert.
Warum verzeichnete die NPD vor allem im Osten Erfolge?
Dies wird unter anderem mit einem gesellschaftstauglicheren Auftreten auf kommunaler Ebene und der Nutzung spezifischer regionaler Unzufriedenheiten erklärt.
Welche Rolle spielt die Motivation für rechtsextremes Denken?
Die Arbeit beleuchtet Hintergründe wie soziale Schichten, Bildungsstand und die historische Entwicklung in der DDR bzw. der alten Bundesrepublik.
- Citar trabajo
- Marco Petrat (Autor), 2012, Rechtsextremismus in Ost und West , Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/194045