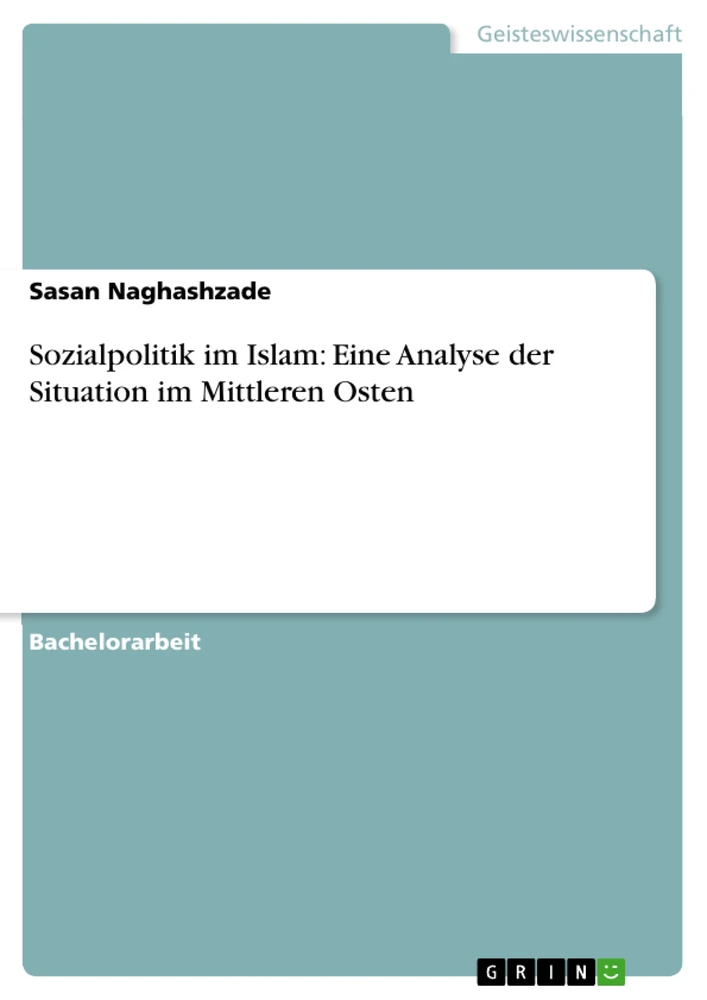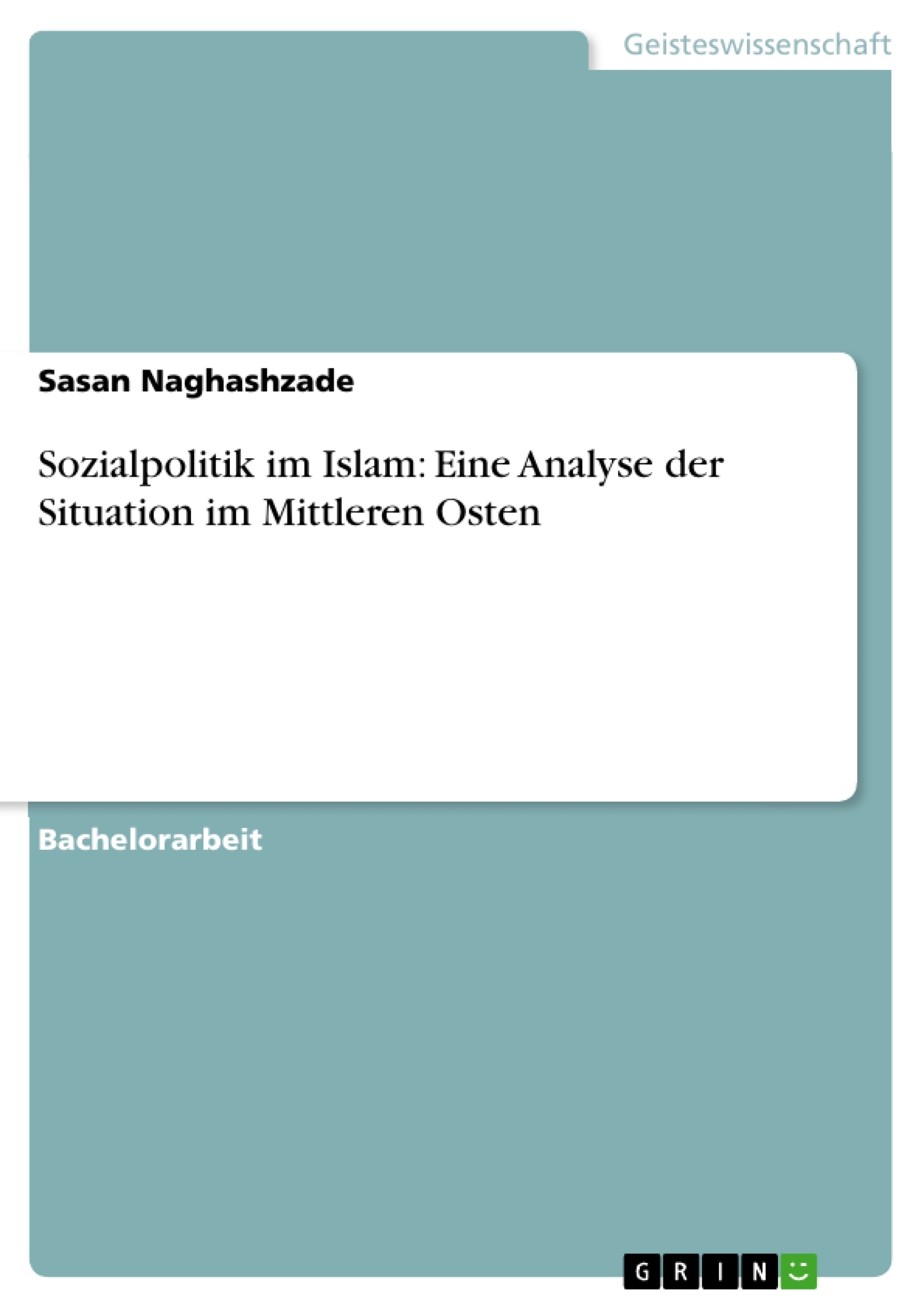Einleitung
Die Sozialpolitik kann in den westlichen Staaten Europas und den USA auf eine mehr als einhundert Jahre alte geschichtliche Entwicklung zurückblicken und ist inzwischen in unterschiedlichen Formen in den Ländern präsent. So ist die Sozialpolitik in den meisten Verfassungen der abendländischen Staaten gesetzlich verankert und bestimmt die politische Ausrichtung der jeweiligen Länder, die dementsprechend als Sozial- bzw. Wohlfahrtsstaaten bezeichnet werden. Hierbei spielen die christlichen Werte, die Aufklärung sowie die Industrialisierung eine wichtige Rolle beim Verständnis der sozialpolitischen Entwicklungen in den abendländischen Staaten. Die Demokratisierung war ebenfalls ein entscheidender Aspekt. Des Weiteren sind die verschiedenen Sozialsysteme der westlichen Länder in den Sozial- und Politikwissenschaften analysiert worden und anhand ihrer gesellschaftlichen, politischen und sozialen Eigenschaften in Wohlfahrtsregime eingeteilt worden. All diese wissenschaftlichen Arbeiten haben zu einer umfangreichen und nahezu lückenlosen Wissensbasis zum Thema der westlichen Sozialpolitik und Sozialstaaten geführt. Auf der Basis dieser Erkenntnisse, über die westlichen Sozial- und Wohlfahrtsstaaten, stellt sich unweigerlich die Frage, wie die Sozialpolitik in Staaten außerhalb des abendländischen Kulturkreises gestaltet wird. Welche kulturellen, politischen, wirtschaftlichen und sozialen Ereignisse haben diese Staaten beeinflusst? Der Mittlere Osten ist aus politischer Sicht eine sehr wichtige Region, die für die Weltpolitik von großer Bedeutung ist. Diese Staaten sind fast ausschließlich islamische Länder. Das stellt einen wichtigen Unterschied zu den christlich geprägten westlichen Staaten dar. Die islamischen Kulturen sind nicht in den Maße von den oben erwähnten Einflüssen der Aufklärung, Demokratisierung und Industrialisierung geprägt worden, wie diese entscheidend zur Entstehung der abendländischen Sozialstaaten beigetragen haben. Hierbei ist interessant zu analysieren, ob und wie die Sozialpolitik im Mittleren Osten ausgestaltet wird. Dem Islam, der nahezu alle Bereiche der Gesellschaft dieser Länder durchdringt, soll hier eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden, um zu erfahren, inwiefern er die sozialpolitischen Maßnahmen der relevanten Staaten beeinflusst. Zudem wird untersucht, wie die politischen Systeme, die in nahezu allen Ländern nicht demokratisch, sondern eher autoritär oder totalitär sind, die Sozialpolitik handhaben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entstehung der westlichen Wohlfahrtsstaaten
- Ursprünge und erste Ansätze der Sozialpolitik des Abendlandes
- Institutionelle Entwicklungen der modernen Wohlfahrtsstaaten
- Modelle der Wohlfahrtsstaaten
- Wohlfahrtsverständnis im Islam
- Die sozialpolitischen Regelungen nach dem Islam
- Soziale Institutionen nach den Vorgaben des Islams
- Der Zakat als islamische (Almosen-) Steuer
- Probleme bei Anwendung der islamischen Gesetze im Mittleren Osten
- Die sozialpolitischen Regelungen nach dem Islam
- Motive für das staatliche Engagement in der sozialen Wohlfahrt
- Politische Systeme und deren Motivation zur Durchführung der Sozialpolitik
- Die wirtschaftliche Situation als Basis zur Finanzierung der Sozialpolitik
- Sozialpolitische Maßnahmen im Mittleren Osten
- Vergleich sozialpolitischer Systeme anhand einiger Staaten des Mittleren Ostens
- Die islamische Republik Iran
- Das Königreich Saudi Arabien
- Die Republik Türkei
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt darauf ab, die Sozialpolitik in den Staaten des Mittleren Ostens zu analysieren, indem der Einfluss des Islams auf deren sozialpolitische Maßnahmen berücksichtigt wird. Das Hauptziel ist es, ein tieferes Verständnis für die Gestaltung der Sozialpolitik in dieser Region zu erlangen und die Rolle des Islams in diesem Kontext zu beleuchten.
- Entwicklung der westlichen Wohlfahrtsstaaten
- Wohlfahrtsverständnis im Islam
- Motive für staatliches Engagement in der Sozialpolitik
- Vergleich sozialpolitischer Systeme im Mittleren Osten
- Einfluss des Islams auf sozialpolitische Maßnahmen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Sozialpolitik und Sozialstaaten nach westlichem Vorbild. Dabei wird die Entstehung der westlichen Wohlfahrtsstaaten kurz erläutert. Anschließend werden die unterschiedlichen Institutionen, die im Laufe der Entwicklung der Wohlfahrtsstaaten entstanden sind, sowie die verschiedenen Formen der Wohlfahrtsstaaten selbst vorgestellt. Das dritte Kapitel befasst sich mit dem Islam und versucht, das Wohlfahrtsverständnis dieser Religion offenzulegen. Dadurch soll eine erste Vorstellung von den kulturellen und religiösen Einflüssen des Islams auf die Sozialpolitik in den islamischen Ländern entstehen. Es werden die sozialpolitischen Regelungen erläutert, die nach den Gesetzen und Werten des Islams vorgeschrieben sind. Dabei wird zunächst auf die sozialen Institutionen des Islams und anschließend auf die Staaten des Mittleren Ostens eingegangen. Die politischen Systeme und deren Motive zur Durchführung sozialpolitischer Maßnahmen werden untersucht, und die wirtschaftlichen und finanziellen Situationen der Staaten werden erläutert, da diese die Grundlage der Finanzierung jeglicher sozialpolitischer Maßnahmen darstellen. Im Anschluss werden drei islamische Länder des Mittleren Ostens, nämlich der Iran, Saudi Arabien und die Türkei, exemplarisch auf die oben dargestellten Merkmale islamischer Staaten hin untersucht. Es wird untersucht, wie die Sozialpolitik in diesen Ländern gestaltet wird und inwiefern diese Länder ihre sozialpolitischen Maßnahmen vom Islam leiten lassen.
Schlüsselwörter
Sozialpolitik, Wohlfahrtsstaaten, Mittlerer Osten, Islam, Zakat, politische Systeme, wirtschaftliche Situation, Iran, Saudi Arabien, Türkei.
Häufig gestellte Fragen
Wie unterscheidet sich islamische Sozialpolitik von westlichen Modellen?
Während westliche Modelle auf Aufklärung und Demokratisierung basieren, ist die Sozialpolitik im Mittleren Osten stark von religiösen Werten und dem islamischen Recht geprägt.
Was ist der Zakat?
Der Zakat ist eine obligatorische Almosensteuer im Islam, die als eines der zentralen Instrumente zur sozialen Umverteilung und Wohlfahrt dient.
Welche Rolle spielen soziale Institutionen im Islam?
Der Islam schreibt spezifische soziale Institutionen vor, die sich um Bedürftige kümmern und die gesellschaftliche Solidarität fördern sollen.
Wie setzen Iran, Saudi-Arabien und die Türkei Sozialpolitik um?
Die Arbeit vergleicht diese Staaten und zeigt, wie autoritäre oder totalitäre Systeme religiöse Vorgaben in ihre staatliche Wohlfahrtsstrategie integrieren.
Welchen Einfluss hat die wirtschaftliche Lage auf die Wohlfahrt im Mittleren Osten?
Die Finanzierung sozialer Maßnahmen hängt stark von den jeweiligen wirtschaftlichen Ressourcen (z. B. Öleinnahmen) und der Stabilität der politischen Systeme ab.
- Quote paper
- Sasan Naghashzade (Author), 2012, Sozialpolitik im Islam: Eine Analyse der Situation im Mittleren Osten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/194107