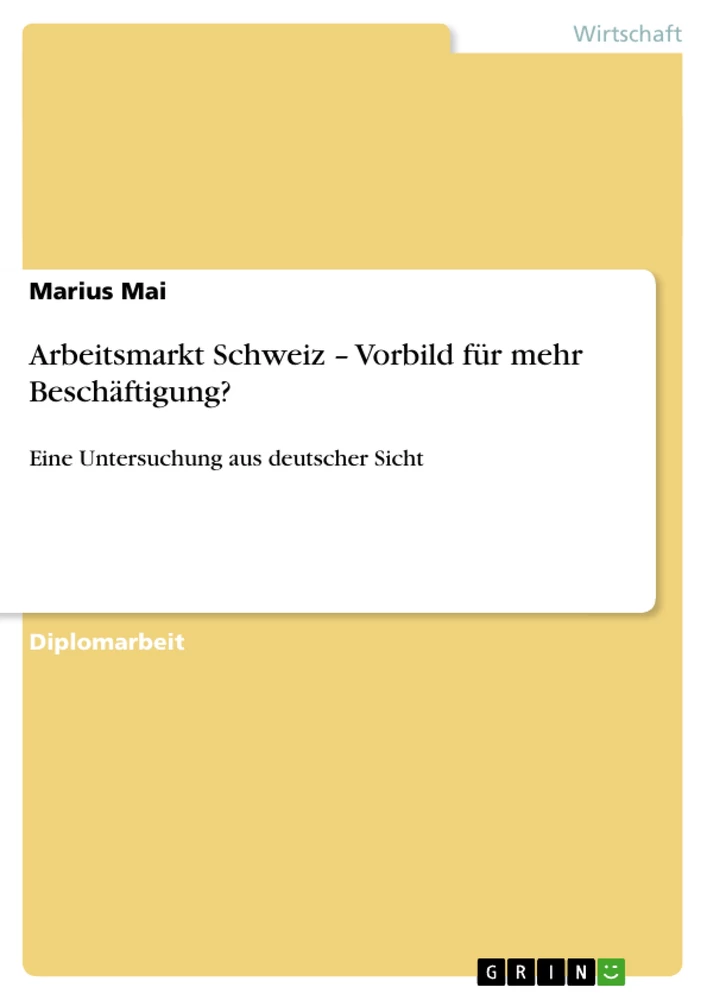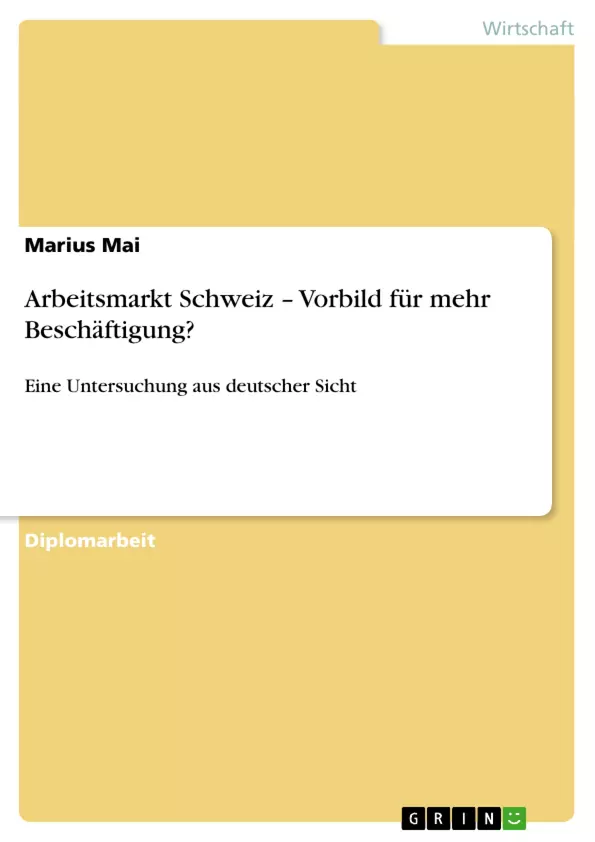Einleitung: Die Schweiz als Vorbild für die BRD?
Eines der größten Risiken innerhalb moderner Gesellschaften ist Arbeitslosigkeit. Während die Erwerbstätigkeit eine Grundlage für die aktive gesellschaftliche Teilnahme eines Menschen darstellt und dessen Identität fundamental prägt, so kann der Verlust des Arbeitsplatzes schwerwiegende Folgen haben. Aus Sicht der Betroffenen bedeutet dies oftmals nicht nur eine Zuspitzung der finanziellen Lage, sondern bringt häufig eine Verschlechterung der gesamten psychischen und sozialen Situation mit sich. Aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive betrachtet verursacht Arbeitslosigkeit erhebliche Kosten, die über eine Schwächung des Staatshaushaltes wiederum auf jeden Einzelnen zurückfallen.
Auch wenn das deutsche Arbeitslosigkeitsproblem in den letzten Jahren etwas an Dramatik verloren hat, stellt die Realisierung eines hohen Beschäftigungsstandes nach wie vor eines der wichtigsten sozialen und wirtschaftspolitischen Ziele dar. In diesem Zusammenhang kann es nützlich sein, einen Blick über die eigenen Landesgrenzen hinweg zu wagen, denn – wie sich zeigt – sind andere Länder deutlich weniger von Arbeitsmarktproblemen betroffen. Besonders bemerkenswert ist die Situation in der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Während die (standardisierte) Arbeitslosenquote auf dem Höhepunkt der Arbeitsmarktkrise im Jahr 2005 in Deutschland die 11 Prozent-Marke überschritt, herrschte in der Schweiz eine Quote von 4,4 % - ein Wert, bei dem manche Ökonomen von Vollbeschäftigung sprechen (vgl. OECD 2011). Doch nicht nur zu jenem Zeitpunkt, sondern über die letzten zwei Jahrzehnte hinweg lag die Arbeitslosigkeit in Deutschland zwei bis dreimal so hoch wie in der Schweiz.
Für Ökonomen und Politiker, aber auch aus persönlichem Interesse stellt daher die äußerst schwierige Frage, welche Determinanten für eine derart erhebliche Diskrepanz verantwortlich gemacht werden können und ob die Schweiz aus deutscher Sicht ein Vorbild für mehr Beschäftigung sein kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Schweiz als Vorbild für die BRD?
- Zielsetzung und Vorgehensweise
- Empirischer Hintergrund
- Arbeitslosigkeit und Beschäftigung
- Gruppenspezifische Betrachtung
- Arbeitsmarktdynamik und strukturelle Arbeitslosigkeit
- Besonderheiten der Schweiz
- Internationalität
- Qualifikationsstruktur und Bildungsanstrengungen
- Arbeitszeit
- Direkte Demokratie und ausgeprägter Föderalismus
- Ökonomische Aspekte
- Wirtschaftswachstum
- Wohlstand und finanzielle Situation
- Wirtschaftsstruktur
- Zwischenfazit
- Theoretischer Hintergrund - Das Konzept der „Varieties of Capitalism“
- Zusammenfassung und zentrale Aussagen des Ansatzes
- Kennzeichen liberaler und koordinierter Marktwirtschaften
- Institutionen und institutionelle Rahmenbedingungen
- Kulturell-historischer und politischer Hintergrund
- Industrial Relations
- Bedeutung der Gewerkschaften
- Zentralität vs. Dezentralität
- Konflikthaftigkeit
- Mindestlöhne
- Betriebliche Mitbestimmung
- Kündigungsschutz
- Zusammenfassung der Ergebnisse
- Berufliche Ausbildung
- Corporate Governance und zwischenbetriebliche Beziehungen
- Sozialsystem und passive Arbeitsmarktpolitik
- Arbeitsmarktreformen
- Bezug zum Konzept der Varieties of Capitalism
- Das Schweizer Modell - mögliche Handlungsableitungen für die BRD
- Schlussbetrachtung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit setzt sich zum Ziel, die Arbeitsmarktsituation in der Schweiz aus deutscher Perspektive zu analysieren. Im Fokus steht die Frage, ob die Schweiz ein Vorbild für die BRD in Bezug auf die Steigerung der Beschäftigung sein kann.
- Analyse der Arbeitslosigkeit und Beschäftigung in Deutschland und der Schweiz
- Untersuchung der institutionellen Rahmenbedingungen des Schweizer Arbeitsmarktes
- Bedeutung des Konzepts der „Varieties of Capitalism“ für den Vergleich der Arbeitsmärkte
- Bewertung der Übertragbarkeit des Schweizer Modells auf die BRD
- Diskussion von Handlungsoptionen für die deutsche Arbeitsmarktpolitik
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Relevanz des Themas Arbeitslosigkeit und die besondere Situation der Schweiz heraus, die mit ihrer niedrigen Arbeitslosenquote eine mögliche Inspiration für Deutschland darstellen könnte.
- Empirischer Hintergrund: Das Kapitel beleuchtet die Entwicklung der Arbeitslosigkeit und Beschäftigung in Deutschland und der Schweiz. Es analysiert die Arbeitsmarktdynamik und beleuchtet die strukturellen Ursachen für Arbeitslosigkeit. Des Weiteren werden Besonderheiten des Schweizer Arbeitsmarktes wie die Internationalität, die Qualifikationsstruktur und die Arbeitszeit vorgestellt.
- Theoretischer Hintergrund - Das Konzept der „Varieties of Capitalism“: Dieses Kapitel stellt das Konzept der „Varieties of Capitalism“ vor und beschreibt die zentralen Aussagen des Ansatzes. Es werden die Kennzeichen liberaler und koordinierter Marktwirtschaften erläutert, die als idealtypische Modelle für die Analyse der Arbeitsmärkte von Deutschland und der Schweiz dienen.
- Institutionen und institutionelle Rahmenbedingungen: Das Kapitel untersucht die kulturell-historischen und politischen Hintergründe des Schweizer Arbeitsmarktes. Es analysiert die Bedeutung von Industrial Relations, den Einfluss von Gewerkschaften und die Rolle der betrieblichen Mitbestimmung. Des Weiteren werden Themen wie Mindestlöhne, Kündigungsschutz und die berufliche Ausbildung beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Arbeitsmarkt, Beschäftigung, Arbeitslosigkeit, Schweiz, Deutschland, Varieties of Capitalism, Institutionen, Industrial Relations, Gewerkschaften, Betriebliche Mitbestimmung, Kündigungsschutz, Sozialsystem, Arbeitsmarktreformen.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist die Arbeitslosenquote in der Schweiz so niedrig?
Die Arbeit nennt Faktoren wie eine starke Qualifikationsstruktur, dezentrale Industrial Relations, hohe Arbeitszeitflexibilität und eine stabile Wirtschaftsstruktur.
Was bedeutet das Konzept der „Varieties of Capitalism“ für diesen Vergleich?
Es unterscheidet zwischen liberalen und koordinierten Marktwirtschaften, wobei die Schweiz Elemente beider Modelle kombiniert, was zu ihrer hohen Beschäftigung beiträgt.
Wie unterscheiden sich die Gewerkschaften in der Schweiz von denen in Deutschland?
Die Industrial Relations in der Schweiz sind stärker dezentral organisiert und durch eine geringere Konflikthaftigkeit (Arbeitsfrieden) geprägt.
Welche Rolle spielt die direkte Demokratie für den Arbeitsmarkt?
Die direkte Demokratie und der Föderalismus fördern einen politischen Konsens und eine wirtschaftsnahe Gesetzgebung, die Beschäftigung begünstigt.
Ist das „Schweizer Modell“ auf Deutschland übertragbar?
Die Arbeit diskutiert Handlungsableitungen, weist aber auch auf die unterschiedlichen kulturellen und historischen Hintergründe hin, die eine einfache Kopie erschweren.
Wie sieht der Kündigungsschutz in der Schweiz aus?
Im Vergleich zu Deutschland ist der Kündigungsschutz in der Schweiz liberaler, was laut einigen Ökonomen die Einstellungsbereitschaft von Unternehmen erhöht.
- Arbeit zitieren
- Marius Mai (Autor:in), 2011, Arbeitsmarkt Schweiz – Vorbild für mehr Beschäftigung?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/194166