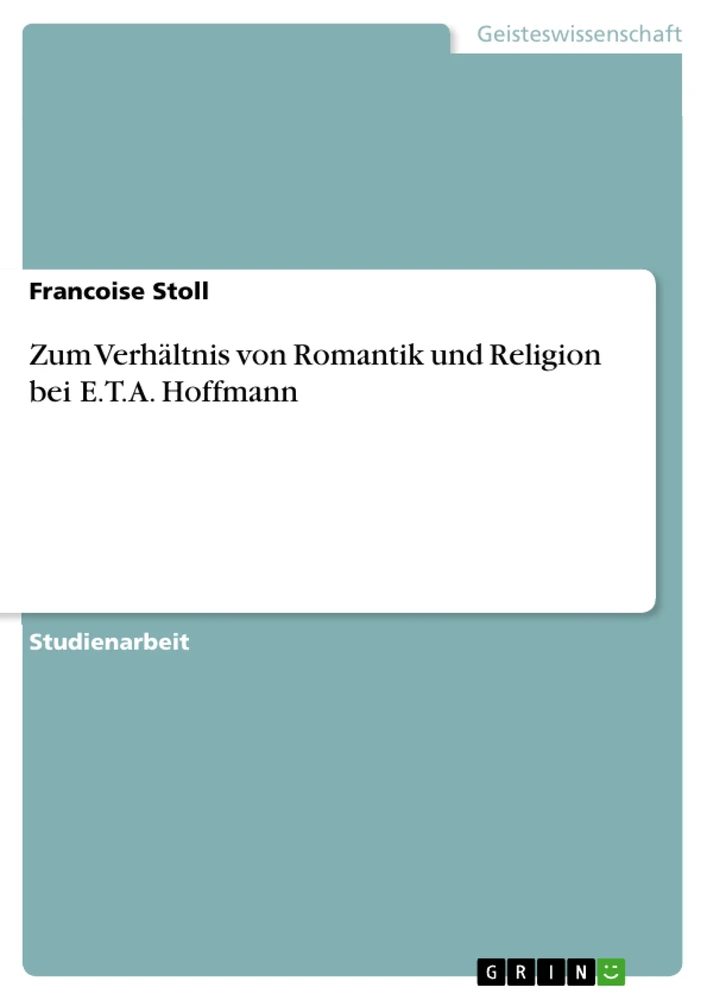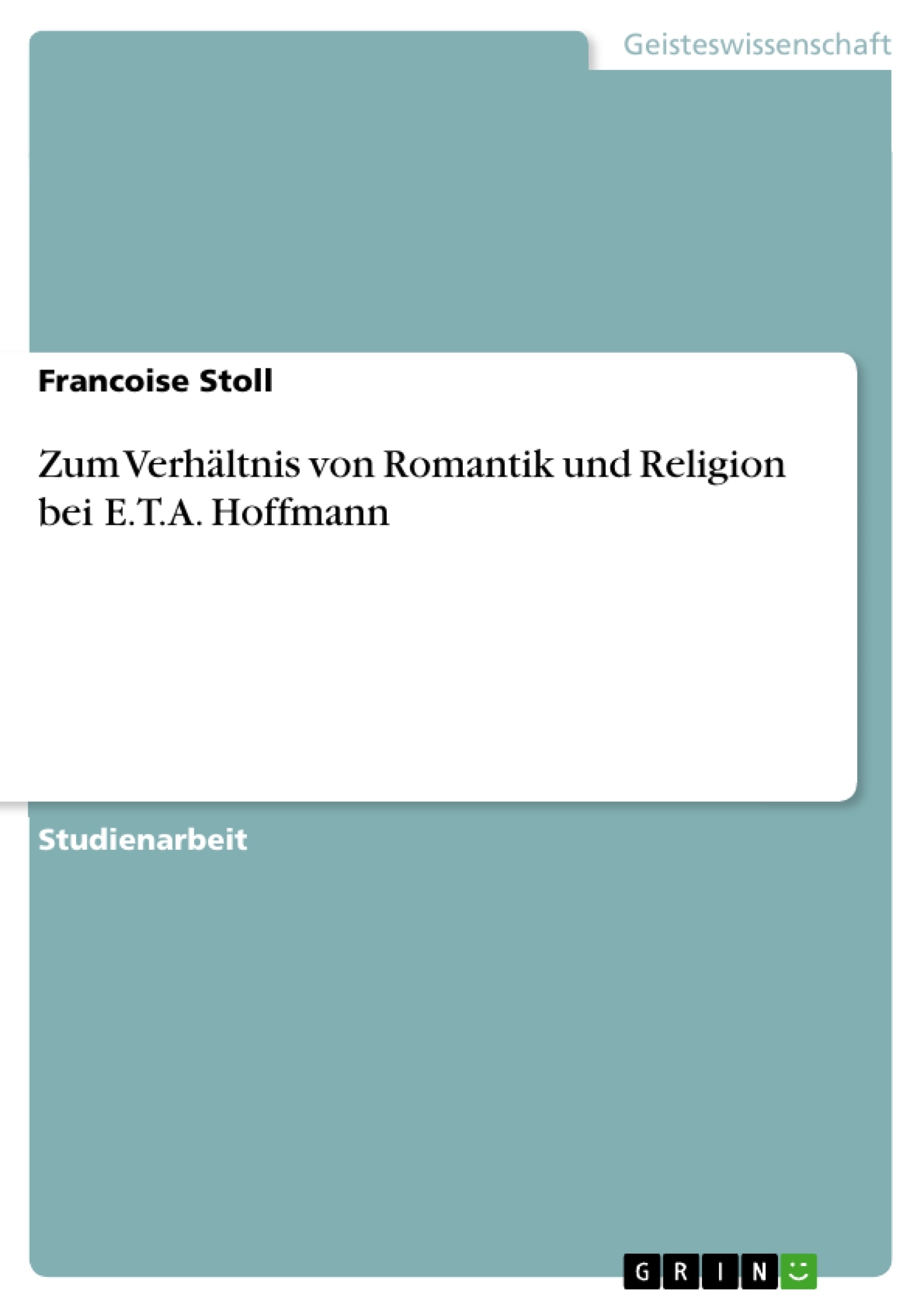Ernst Theodor Amadeus Hoffmann zählt zu den berühmtesten Autoren der deutschen Romantik. Die „Fantasiestücke in Callots Manier“ (1814/1815), die „Elixiere des Teufels“ (1815/16) und die „Nachtstücke“ (1816/1817) sind bis heute weltbekannt.
Doch seine literarischen Werke wurden bislang meist aus einer ausschließlich germanistischen Perspektive analysiert und interpretiert. Die vorliegende Hausarbeit hingegen soll den religionswissenschaftlichen Aspekt von E.T.A. Hoffmanns Erzählungen beleuchten. Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf der Beziehung zwischen der Romantik und der Religion. Anhand von zwei konkreten Textbeispielen soll diese Verbindung näher erläutert und die Unabdingbarkeit von religiösen Motiven und Symbolen in Hoffmanns Texten verdeutlicht werden. Bei „Der Sandmann“ liegt der Schwerpunkt auf „dem Teuflischen“. Im Kontrast dazu wird bei der Kurzgeschichte „Der Einsiedler Serapion“ auf den Heiligenkult eingegangen. Wie Stephan Gonschorek in seiner Vorbemerkung zu seinem Werk „Serapion sei unser Schutzpatron. Die Heiligen im Erzählwerk E.T.A. Hoffmanns“ bereits bemerkt,
wird leider nur geringes Interesse an den Motiven und Zusammenhängen in Hoffmanns Werk, die dem religiösen Bereich zuzuordnen sind, gezeigt. Die Heiligenthematik zählt bisher nicht zu den beliebtesten Bereichen der Forschungs-Literatur, weshalb diese bis jetzt nicht als selbstständiger Gegenstand der Untersuchung gilt.
Inhaltsverzeichnis
- Zum Verhältnis von Romantik und Religion bei E.T.A. Hoffmann
- A Einleitung
- I Der Gesamtkünstler E.T.A. Hoffmann
- II Romantik und Religion
- 1. Was bedeutet eigentlich „Romantik“?
- 2. Schwarze Romantik
- 3. Mittelalter und Christentum als Ideal
- III Der Sandmann
- 1. Inhaltsangabe und Kontext
- 2. Der Sandmann als Teufelsgestalt
- 3. Der säkularisierte Teufel
- IV Der Einsiedler Serapion
- 1. Die Serapionsbrüder
- 2. Inhaltsangabe und Kontext
- 3. Der Heilige Serapion und weitere Heilige
- B Fazit
- C Quellenangabe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem religionswissenschaftlichen Aspekt von E.T.A. Hoffmanns Erzählungen und analysiert die Beziehung zwischen Romantik und Religion. Anhand von zwei konkreten Beispielen, „Der Sandmann“ und „Der Einsiedler Serapion“, wird die Bedeutung religiöser Motive und Symbole in Hoffmanns Werken herausgestellt. Die Arbeit beleuchtet die Rolle des Teufels in „Der Sandmann“ und den Heiligenkult in „Der Einsiedler Serapion“.
- Religionswissenschaftliche Analyse von E.T.A. Hoffmanns Erzählungen
- Beziehung zwischen Romantik und Religion
- Bedeutung religiöser Motive und Symbole in Hoffmanns Werken
- Die Rolle des Teufels in „Der Sandmann“
- Der Heiligenkult in „Der Einsiedler Serapion“
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz des religionswissenschaftlichen Aspekts in Hoffmanns Werken und die Bedeutung der Beziehung zwischen Romantik und Religion heraus. Sie beschreibt den Fokus der Arbeit und die beiden ausgewählten Textbeispiele.
- Der Gesamtkünstler E.T.A. Hoffmann: Dieses Kapitel stellt E.T.A. Hoffmann als Gesamtkünstler vor und beleuchtet seine vielseitigen Talente als Musiker, Jurist, Zeichner und Schriftsteller. Die Besonderheit seiner Mehrfachbegabungen im Kontext der Romantik wird hervorgehoben.
- Romantik und Religion: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem komplexen Begriff der Romantik, der sowohl als Epoche als auch als kulturelles Phänomen zu verstehen ist. Es beschreibt die Verbindung der Romantik zur Volkssprache, das Verhältnis zur Klassik und die Bedeutung von Gefühlen und Emotionen. Der Kapitelteil „Schwarze Romantik“ analysiert die Verbindung von Phantastik, Unheimlichem und Fremdem sowie die Rolle von dämonischen Figuren und Fabelwesen. Der Abschnitt „Mittelalter und Christentum als Ideal“ beleuchtet die Faszination der Romantik für das Mittelalter und die Aufwertung des Christentums in dieser Epoche.
- Der Sandmann: Dieses Kapitel bietet eine Inhaltsangabe und den Kontext der Erzählung „Der Sandmann“. Der Fokus liegt auf der Darstellung des Sandmanns als Teufelsgestalt und der Analyse seiner säkularisierten Natur.
- Der Einsiedler Serapion: Dieses Kapitel bietet eine Inhaltsangabe und den Kontext der Kurzgeschichte „Der Einsiedler Serapion“. Es beleuchtet die Bedeutung der Serapionsbrüder und fokussiert auf die Darstellung des Heiligen Serapion und weiterer Heiliger im Text.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind Romantik, Religion, E.T.A. Hoffmann, „Der Sandmann“, „Der Einsiedler Serapion“, Teufel, Heiliger, Phantastik, Unheimliches, Mittelalter, Christentum, Säkularisierung, Heiligenkult, Gesamtkünstler.
- Citar trabajo
- Francoise Stoll (Autor), 2011, Zum Verhältnis von Romantik und Religion bei E.T.A. Hoffmann, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/194181