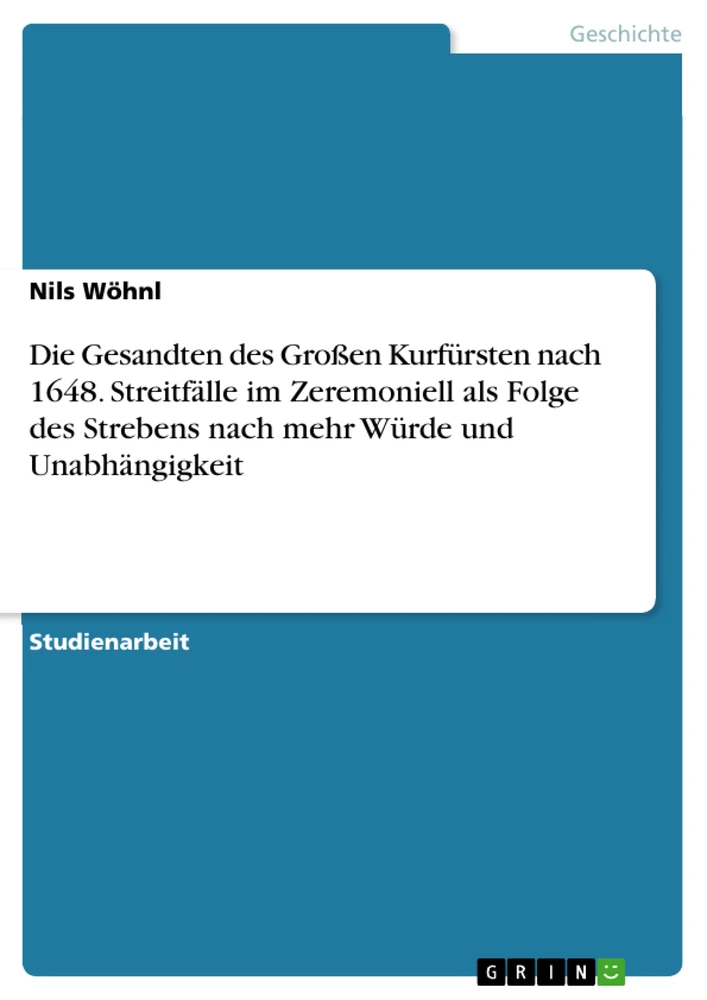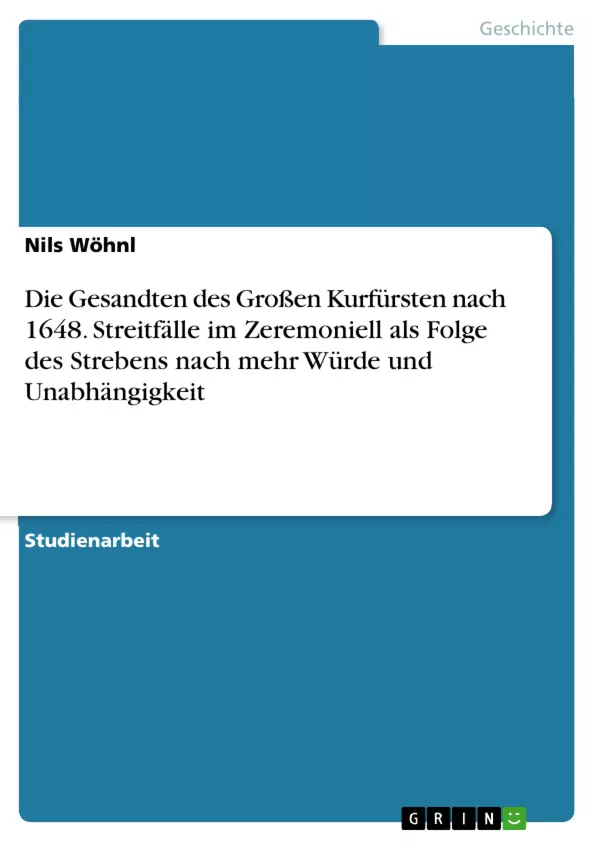Herrschaft war in der Zeit des Absolutismus vor allem eine Sache, dargestellt werden musste, um sie durchzusetzen. Nur durchRituale - soziale Handlungen - konnte hierbei eine Wirkung auf Beteiligte und Zuschauer ausgeübt werden. Im und am Zeremoniell wurden so bestimmte Bilder festgemacht, die bestehende Strukturen für weitere Zeiträume festlegten und legitimierten. Auch eine Neuformulierung von Herrschaftsansprüchen war möglich, jedoch musste die notwendige Akzeptanz der Beteiligten gegeben sein. Im Falle des Heiligen Römischen Reiches war dies ein überwiegend adliger Personenverband, in dem jeder einzelne Stand ein anderes politisches Gewicht besaß, demnach innerhalb der heterogenen Machtstruktur und gegenüber dem Ausland verschiedenartig auftreten konnte. Internationale Beziehungen gewannen zu dieser Zeit mehr und mehr an Bedeutung. Um handlungsfähig zu bleiben unterhielten Kaiser, Kurfürsten und weitere Stände zahlreiche Vertreter, die an fremde Höfe geschickt wurden um etwa Bündnisse zu schließen oder als „Botschafter“ über längere Zeiträume residierten. Da der eigene Anspruch auf Herrschaft vor Augen geführt werden musste, nämlich durch die Anwesenheit des jeweiligen Souveräns - dies galt für die eigenen Untertanen im aufkommenden Territorialstaat, für Herrscher anderer Höfe oder bei politischen Versammlungen, aber Reisen eine teure und langwierige Angelegenheit waren, bediente man sich eben „gewisser Leute“: Dies waren Gesandte. Dem Herrscher blieb so die Möglichkeit im Lande zu verweilen, während seine Stellvertreter umherreisten.
Die Behandlung dieser Personen und ihr Rang waren dabei von immenser Bedeutung, an der Art und Weise ihres Auftretens zeigte sich die internationale Stellung des Souveräns dem sie dienten. Am Beispiel des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg soll gezeigt werden, wie Gesandte als politisches Instrument des Souveräns auf seinem langen Weg hin zur Erhöhung der Würde der Hohenzollern genutzt wurden und welche Widerstände und Widersprüche sich dabei entwickelten. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Der rituelle Charakter der Diplomatie in der Frühen Neuzeit
- Die „symbolische Ressource“
- Von den Gesandten
- Diplomatie nach 1648
- Zur Quelle:
- Lünig und die ungerechte Behandlung der brandenburgischen Gesandten
- Die Lösung des Problems
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Bedeutung des diplomatischen Zeremoniells für den Aufstieg Brandenburgs in der Frühen Neuzeit. Sie analysiert, wie Gesandte als politisches Instrument des Kurfürsten Friedrich Wilhelm genutzt wurden, um die Würde und Unabhängigkeit der Hohenzollern zu erhöhen.
- Die Bedeutung des diplomatischen Zeremoniells in der Frühen Neuzeit
- Die „symbolische Ressource“ als Mittel zur Erhöhung des politischen Gewichts
- Die Rolle von Gesandten als Vertreter des Souveräns und deren Einfluss auf die internationale Stellung
- Streitfälle im diplomatischen Zeremoniell als Folge des Strebens nach mehr Würde und Unabhängigkeit
- Die Bedeutung der Quelle „Theatrum Ceremoniale historico-politicum“ von Johann Christian Lünig für die Analyse des diplomatischen Zeremoniells
Zusammenfassung der Kapitel
- Der rituelle Charakter der Diplomatie in der Frühen Neuzeit: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung von Diplomatie als zentrales Element der Politik in der Frühen Neuzeit. Es wird die Rolle von Ritualen und Zeremonien im Absolutismus hervorgehoben, sowie die Bedeutung des Zeremoniells für die Durchsetzung von Herrschaftsansprüchen.
- Die „symbolische Ressource“: Dieses Kapitel untersucht die verschiedenen Ressourcen, die Friedrich Wilhelm nach dem Dreißigjährigen Krieg zur Wiederherstellung Brandenburgs-Preußens benötigte. Neben Militär und Wirtschaft werden „symbolische Ressourcen“ wie die Erhöhung des Ansehens und des politischen Gewichts durch die Hofhaltung und den Empfang von Gesandten betrachtet.
- Von den Gesandten: Dieses Kapitel behandelt die Rolle von Gesandten als Vertreter des Souveräns im diplomatischen Zeremoniell. Es wird der Zusammenhang zwischen der Behandlung von Gesandten und der internationalen Stellung des Souveräns erläutert.
- Diplomatie nach 1648: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Entwicklung der Diplomatie im Kontext des Westfälischen Friedens. Es werden die Herausforderungen für Brandenburg-Preußen nach dem Krieg und die Bedeutung des diplomatischen Zeremoniells für die Durchsetzung der eigenen Interessen in der internationalen Politik betrachtet.
- Zur Quelle: Lünig und die ungerechte Behandlung der brandenburgischen Gesandten: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Quelle „Theatrum Ceremoniale historico-politicum“ von Johann Christian Lünig und analysiert die darin dargestellten Streitfälle im Zusammenhang mit der Behandlung brandenburgischer Gesandten.
- Die Lösung des Problems: Dieses Kapitel behandelt die Lösungsansätze für die Streitfälle im diplomatischen Zeremoniell und die Bedeutung der Quelle „Theatrum Ceremoniale historico-politicum“ für die Analyse des diplomatischen Zeremoniells.
Schlüsselwörter
Diplomatie, Zeremoniell, Rituale, Gesandte, Frühe Neuzeit, Absolutismus, Brandenburg-Preußen, Friedrich Wilhelm, Hohenzollern, Würde, Unabhängigkeit, politische Kulturgeschichte, „symbolische Ressource“, Theatrum Ceremoniale historico-politicum, Johann Christian Lünig.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielten Gesandte in der Zeit des Absolutismus?
Gesandte waren Stellvertreter des Souveräns an fremden Höfen. Ihr Rang und ihre Behandlung spiegelten die internationale Stellung und Würde ihres Herrschers wider.
Was versteht man unter dem diplomatischen Zeremoniell?
Das Zeremoniell umfasst rituell festgelegte Handlungen beim Empfang oder bei Verhandlungen, die Herrschaftsansprüche sichtbar machen und legitimieren.
Warum war das Zeremoniell für den Großen Kurfürsten so wichtig?
Friedrich Wilhelm von Brandenburg nutzte es als "symbolische Ressource", um den politischen Rang Brandenburgs nach dem Dreißigjährigen Krieg international zu erhöhen.
Was ist das "Theatrum Ceremoniale" von Johann Christian Lünig?
Es ist eine bedeutende zeitgenössische Quelle, die Streitfälle und Regeln des Zeremoniells dokumentiert und zeigt, wie hart um Rangfragen gekämpft wurde.
Warum kam es oft zu Streitfällen bei diplomatischen Missionen?
Streitigkeiten entstanden meist aus dem Streben nach mehr Unabhängigkeit und Würde, wenn Gesandte nicht den Rang erhielten, den ihr Souverän beanspruchte.
- Quote paper
- Nils Wöhnl (Author), 2012, Die Gesandten des Großen Kurfürsten nach 1648. Streitfälle im Zeremoniell als Folge des Strebens nach mehr Würde und Unabhängigkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/194185