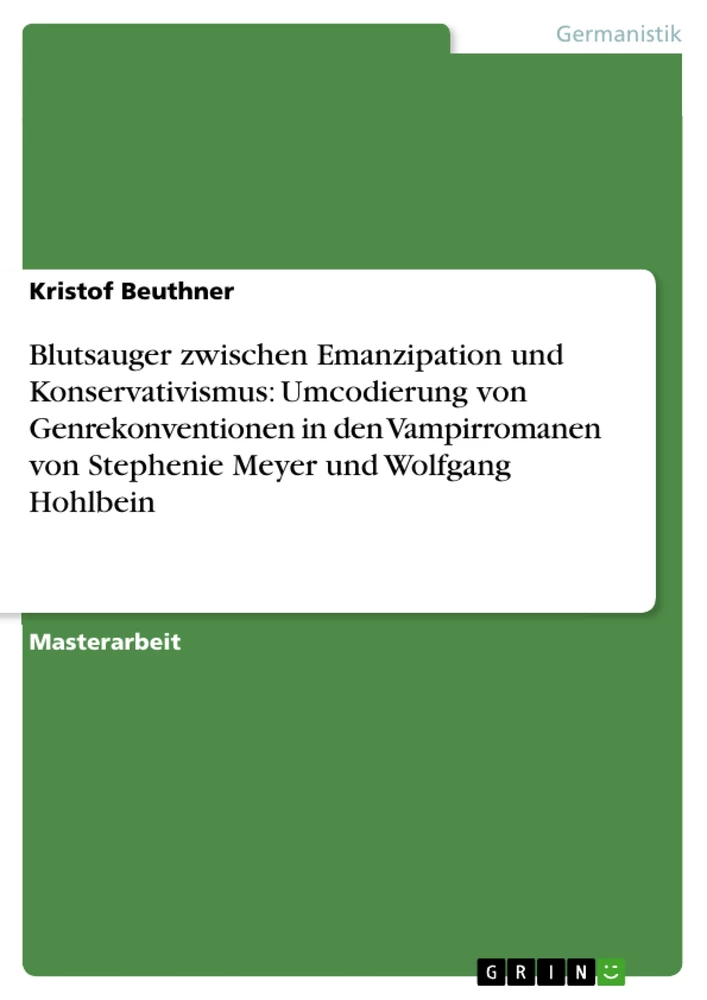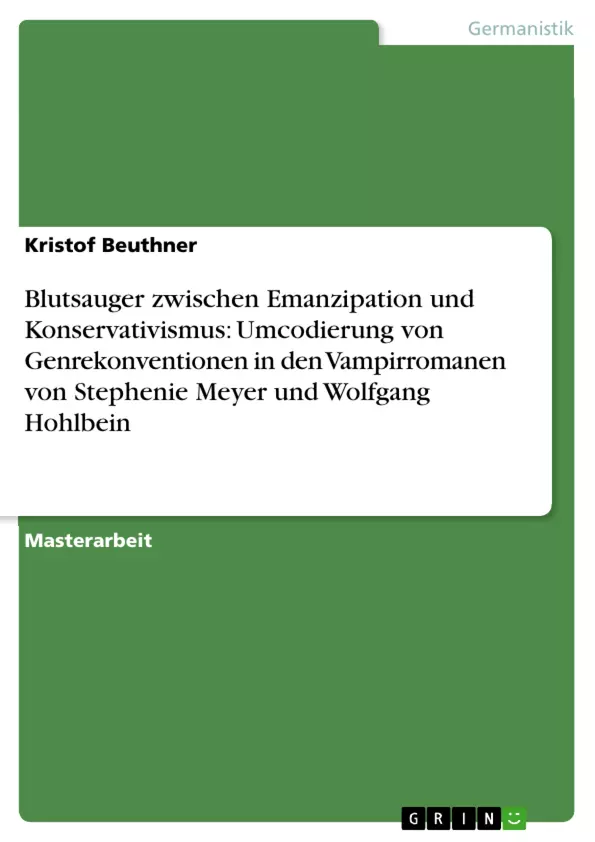Betrachtet man die in Literatur und Film über die Dekaden beschriebenen Schauergestalten, so lässt sich ironischerweise dem untoten Vampir die längste Lebensdauer zuschreiben. Nicht nur das: er erfreut sich, nicht zuletzt durch den großen Erfolg der mittlerweile auf vier Teile angewachsenen „Bis(s)...“-Romanreihe von Stephenie Meyer derzeit wieder einer außerordentlichen Beliebtheit. Dem enormen Erfolg der Bücher folgte ein nicht minder großer bei den Verfilmungen; der vierte Roman wird in zwei Teilen auf die Leinwand gebannt, wobei der zweite Teil in diesem Herbst in den Kinos starten wird. Fast scheint es sogar so zu sein, als würden die Protagonisten, das menschliche Mädchen Bella Swan und der Vampir Edward Cullen, mit ihrer verbotenen Liebe eine ganze Generation Jugendlicher prägen. Oder ist es gar andersherum und ist es die "heutige Jugend", die durch die Herausstellung eigener Subkulturen dem Vampir des 21. Jahrhunderts ein neues Gesicht verleiht? Die Leserschaft der „Bis(s)...“-Reihe reicht jedoch auch hoch bis ins Erwachsenenalter. Damit hat sich, so scheint es, der Vampir emanzipiert: vom Gegenstand alter Mythen und Legenden aus den entlegendsten Teilen vor allem Osteuropas bis hin zu einer literarischen Figur in phantastischen Romanen (allen voran ist hier natürlich Bram Stokers „Dracula“ zu nennen); über eine beliebte Figur in Horrorfilmen bis hin zu einem festen Teil der heutigen Gesellschaft mit neuen, menschlicheren Rollendefinitionen. Der Vampir in der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts haust nicht mehr in verlassenen Burgen im Siebenbürgenland oder in Transsylvanien; er gleicht auch nicht mehr dem nahezu greisen Hausherrn mit Perücke und Umhang, den Schlaf am Tag ausschließlich im Sarg findend. Statt dessen ist er jung, schön und geht aufs College. Oder, auf der anderen Seite: er bestimmt das Nachtleben deutscher Großstädte mit seinen Clubs und seiner extravaganten Dekadenz.
Denn dass sich auch die hiesige Schriftstellerzunft dem neu erstarkten Phänomen annehmen würde, blieb zu erwarten, genau wie mittlerweile unzählige andere Bücher, Filme und Fernsehserien dem Erfolg von Stephenie Meyers "Bis(s)"-Reihe nacheifern. Mit "True Blood" und "Vampire Diaries" führen derzeit zwei sehr erfolgreiche TV-Formate in den Vereinigten Staaten das Erbe der neuen Vampire weiter.
[...]
Inhaltsangabe
1. Einführung
2. Der Vampir in Literatur und Legende
3. Präsentation der verwendeten Primärliteratur
3.1 Stephenie Meyer: Die "Bis(s)"-Reihe
3.1.1 Informationen zu Werk und Autor
3.1.2 Inhalt der Romanreihe
3.2 Wolfgang Hohlbein: "Wir sind die Nacht"
3.2.1 Informationen zu Werk und Autor
3.2.2 Inhalt des Romans
4. Vergleich der beiden Romane
4.1 Lena und Bella: zwei Außenseiterinnen als Hauptfiguren
4.2 Ausgewählte Genderkonstruktionen bei Meyer und Hohlbein
4.3 Selbstreferenz und Neuordnung der Genrekonventionen
4.4 Religiöse und philosophische Ansätze in beiden Romanen
5. Zur Rezeption der Romane von Meyer und Hohlbein
5.1 Faszination von Jugendlichen durch Vampire
5.2 Mediale Inszenierung als Popularitätsschub
6. Fazit und Ausblick
7. Literatur- und Quellenangaben
Häufig gestellte Fragen
Wie hat sich das Bild des Vampirs im 21. Jahrhundert verändert?
Der moderne Vampir lebt nicht mehr in Särgen oder Burgen, sondern ist jung, attraktiv, besucht Colleges oder prägt das extravagante Nachtleben in Großstädten.
Was ist das Besondere an Stephenie Meyers „Bis(s)“-Reihe?
Die Reihe stellt eine romantische, fast menschliche Liebesbeziehung zwischen Bella und Edward in den Fokus und bricht mit vielen klassischen Horror-Konventionen.
Worum geht es in Wolfgang Hohlbeins „Wir sind die Nacht“?
Hohlbein entwirft ein Bild von Vampiren als Teil einer dekadenten Berliner Subkultur, wobei er traditionelle Genrekonventionen neu ordnet.
Warum faszinieren Vampire besonders Jugendliche?
Vampire dienen oft als Projektionsfläche für Themen wie Außenseitertum, verbotene Liebe, Identitätssuche und die Sehnsucht nach Unsterblichkeit.
Welche religiösen Ansätze finden sich in modernen Vampirromanen?
Oft werden moralische Fragen nach Gut und Böse, Verdammnis und Erlösung sowie die Beherrschung der eigenen Triebe (z.B. "vegetarische" Vampire bei Meyer) thematisiert.
- Citar trabajo
- Kristof Beuthner (Autor), 2011, Blutsauger zwischen Emanzipation und Konservativismus: Umcodierung von Genrekonventionen in den Vampirromanen von Stephenie Meyer und Wolfgang Hohlbein, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/194258