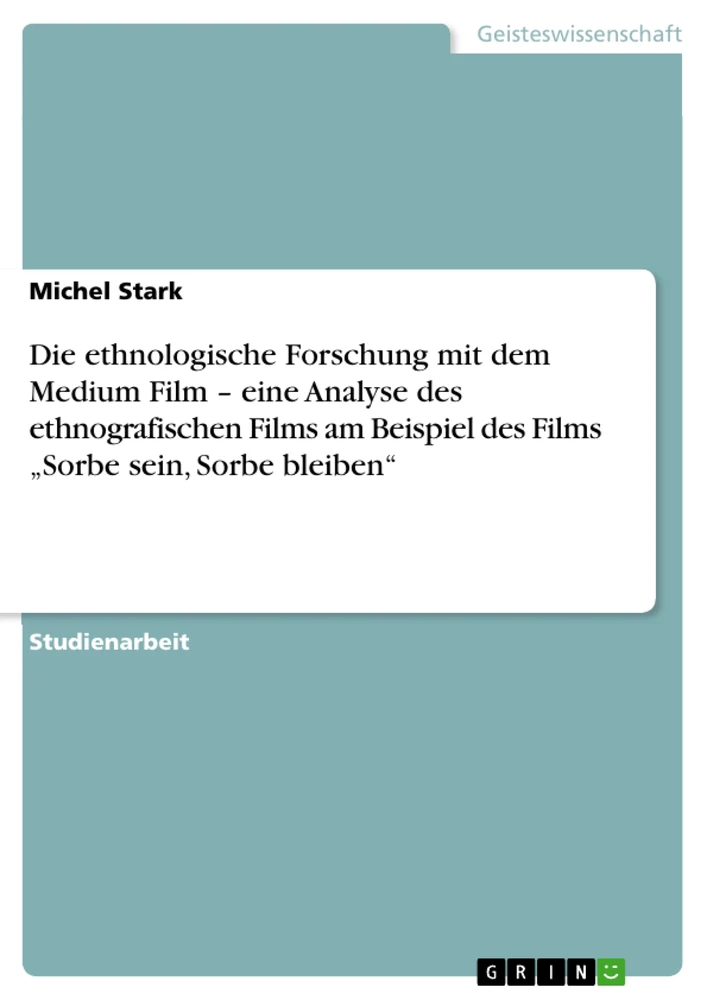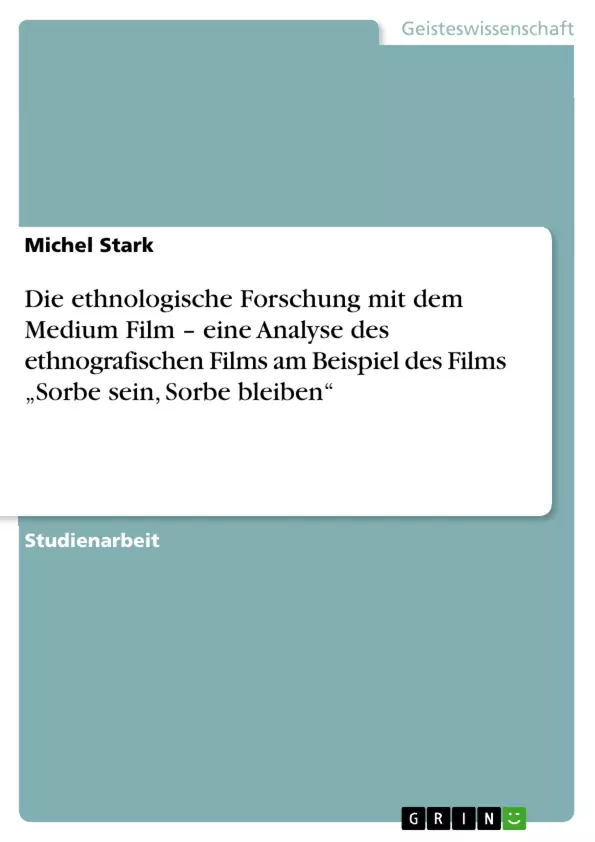Einleitung
Die ethnische Gruppe der Sorben ist eine der wenigen slawischen Gruppen, die ihre Bräuche, ihre Sprache und ihre kulturelle Identität bis heute zu einem großen Teil erhalten konnte. Ihre jahrhundertelange Geschichte ist von Ausgrenzung, Assimilation und Fremdbestimmung geprägt. In der ethnologischen Forschung wurden viele Werke zu diesem Thema verfasst. Seit dem Beginn des letzten Jahrhunderts steht der Volkskundenforschung allerdings auch ein weiteres Mittel zur Verfügung, um die Erkenntnisse über die verschiedenen Merkmale und die Entwicklungen des Brauchtums sowie der Traditionen von ethnischen Gruppen zu dokumentieren – der ethnografische Film. Sybille Roderer hat zusammen mit Martin Müller im Rahmen ihrer Magisterarbeit „Diskurse sorbischer Ethnizität“ einen Filmbeitrag zu den Sorben erstellt, welcher 1999 produziert und 2007 unter dem Titel „Sorbe sein, Sorbe bleiben“ von publiziert worden ist.
Das Ziel dieser Arbeit ist es, den eben genannten Film unter der Fragestellung genauer zu betrachten, ob es sich dabei um einen ethnografischen Film mit all seinen Merkmalen handelt und mit welcher Intention der Film erstellt wurde. Daran anschließend wird untersucht werden, mit welchen filmischen Mitteln die Intention versucht wurde umzusetzen und inwiefern die Intention erfolgreich gewesen ist.
Um die genannten Ziele zu erfüllen, werde ich zunächst einen kurzen historischen Abriss zur Geschichte der Sorben, ihren Bräuchen und der Entwicklung ihrer Sprache erarbeiten. Es folgt eine kurze Charakterisierung des ethnografischen Films und seiner Merkmale. Zum Abschluss der Arbeit erfolgt die genaue Analyse des Filmbeitrages, welche eine Betrachtung der Struktur, der Intention sowie der filmischen Instrumente enthält.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 2. Die ethnische Gruppe der Sorben
- 2.1 Zur Bezeichnung der ethnischen Gruppe der Sorben
- 2.2 Die historische Entwicklung der Sorben
- 2.3 Die Sprache der Sorben
- 2.4 Die Bräuche der Sorben
- 2.4.1 Die Osterreiter
- 2.4.2 Die Vogelhochzeit
- 2.5 Die Situation der Sorben heute
- 3. Der ethnografische Film
- 3.1 Definition des ethnografischen Films
- 3.2 Mögliche Rollen des Wissenschaftlers im Filmprozess
- 4. Die Analyse des Films „Sorbe sein, Sorbe bleiben“
- 4.1 Allgemeine Informationen
- 4.2 Der Inhalt des Films
- 4.3 Die Struktur und die gestalterischen Mittel des Films
- 4.4 Szenenanalyse
- 4.4.1 Anfangsszene: Der Brauch des Osterreitens
- 4.4.2 Szene: Sorbisches Dorffest (Schluss-Szene)
- 4.5 Das Interview mit den Filmproduzenten
- 5. Bewertung der filmischen Umsetzung des Themas
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Arbeit untersucht den ethnografischen Film „Sorbe sein, Sorbe bleiben“ von Sybille Roderer und Martin Müller. Die Analyse konzentriert sich auf die Frage, ob der Film die Merkmale eines ethnografischen Films erfüllt und welche Intention hinter seiner Entstehung steht. Dabei werden die filmischen Mittel zur Umsetzung dieser Intention und der Erfolg der Umsetzung analysiert.
- Ethnografischer Film als Dokumentationsinstrument
- Die historische Entwicklung der Sorben
- Die kulturelle Identität und Traditionen der Sorben
- Die filmische Umsetzung von ethnografischen Inhalten
- Die Intention des Films und seine Rezeption
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung erläutert die Bedeutung der Sorben als eine der wenigen slawischen Gruppen, die ihre Traditionen und Kultur bis heute bewahren konnten. Sie führt den Film „Sorbe sein, Sorbe bleiben“ als Objekt der Analyse ein und definiert die Zielsetzung der Arbeit. Das zweite Kapitel bietet einen Überblick über die ethnische Gruppe der Sorben, einschließlich ihrer Bezeichnung, ihrer historischen Entwicklung, ihrer Sprache und ihrer Bräuche, wie zum Beispiel dem Osterreiten und der Vogelhochzeit. Das dritte Kapitel definiert den ethnografischen Film und beleuchtet die möglichen Rollen des Wissenschaftlers im Filmprozess. Das vierte Kapitel analysiert den Film „Sorbe sein, Sorbe bleiben“ im Detail, wobei die Struktur, der Inhalt, die gestalterischen Mittel und bestimmte Szenen betrachtet werden. Es schließt mit einem Interview mit den Filmproduzenten.
Schlüsselwörter (Keywords)
Ethnografischer Film, Sorben, Wenden, slawische Kultur, Traditionen, Brauchtum, ethnische Identität, Filmsprache, Filmstruktur, Filmintension, Dokumentationsfilm, Diskurse sorbischer Ethnizität.
Häufig gestellte Fragen
Wer sind die Sorben?
Die Sorben (auch Wenden genannt) sind eine slawische Minderheit in Deutschland, die ihre eigene Sprache und Bräuche über Jahrhunderte bewahrt hat.
Was ist ein ethnografischer Film?
Ein ethnografischer Film ist ein wissenschaftliches Dokumentationsmittel, das die Kultur, Traditionen und das Alltagsleben ethnischer Gruppen festhält.
Welche sorbischen Bräuche werden im Film thematisiert?
Der Film behandelt unter anderem das Osterreiten und die Vogelhochzeit als zentrale kulturelle Identitätsmerkmale.
Was ist die Intention des Films „Sorbe sein, Sorbe bleiben“?
Die Arbeit analysiert, ob der Film die sorbische Ethnizität objektiv dokumentiert oder eine bestimmte Botschaft über den Erhalt der Identität vermitteln will.
Welche Rolle nimmt der Wissenschaftler im Filmprozess ein?
Die Arbeit beleuchtet die verschiedenen Rollen, die Forscher bei der Erstellung ethnografischer Filme einnehmen können, von der reinen Beobachtung bis zur aktiven Gestaltung.
- Arbeit zitieren
- Michel Stark (Autor:in), 2011, Die ethnologische Forschung mit dem Medium Film – eine Analyse des ethnografischen Films am Beispiel des Films „Sorbe sein, Sorbe bleiben“, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/194259