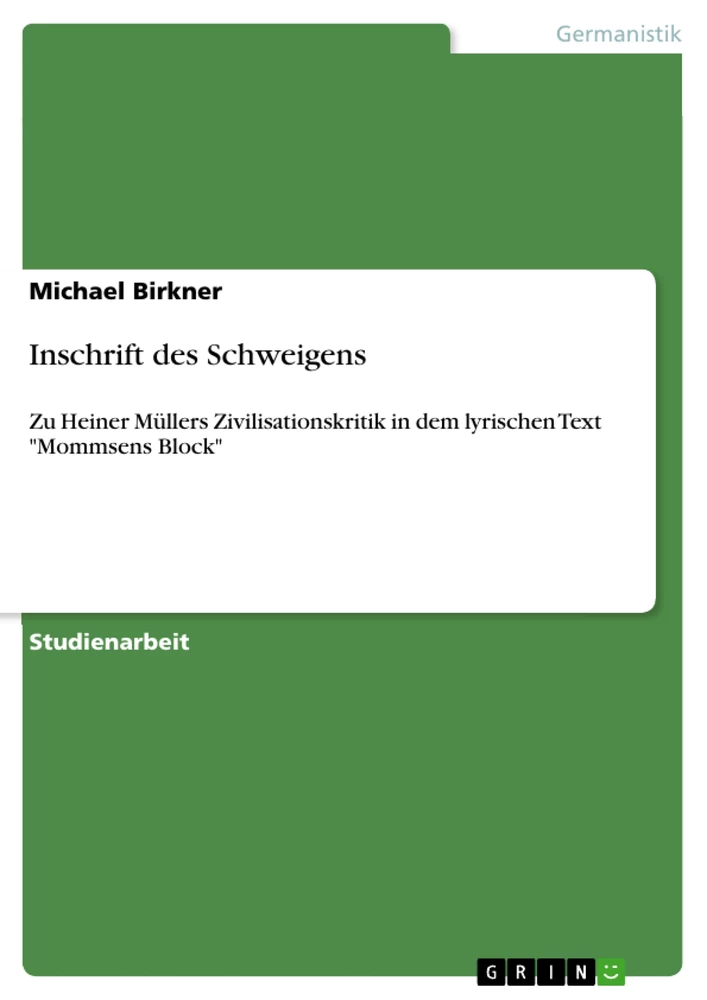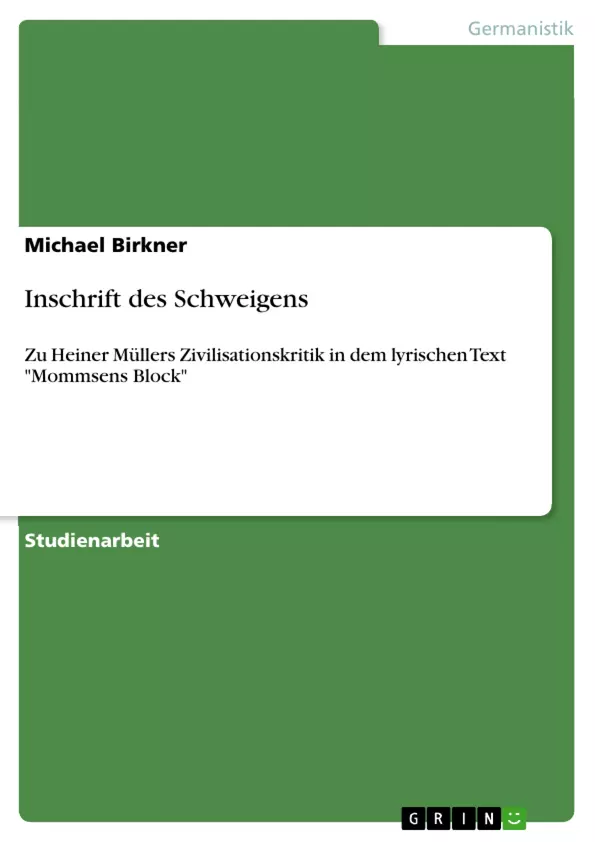Heiner Müllers lyrischer Text "Mommsens Block" lässt sich, abgesehen von einigen Gedichten , als seine erste literarische Reaktion auf die das Ende der statischen Ost-West-Teilung markierenden Ereignisse von 1989 aufnehmen. Müllers dramatisches Werk stand seit jeher - rezeptionsästhetisch gesehen - im Zeichen der Mauer, deren fragwürdige Legitimation letztlich seine Topoi bestimmen musste. Die zum Westen hin abgeschottete DDR ermöglichte das Müllersche Drama als kritischen Rückgriff auf geschichtliche Kulminationspunkte, an denen die Frage des Opfers des Individuums für die Gesamtheit, die Opposition kapitalistischen Eigensinns und sozialistischen Verzichtdenkens durchspielbar war . Anhand des Scheiterns der proletarischen Revolution, welches die Politik zum Schicksal des Volkes bestimmte, war daher im Blick auf die Geschichte die Utopie stets greifbar. Seit dem Zu-sammenbruch der sozialistischen Staaten Osteuropas ist der utopische Kontext unter dem Aspekt seiner staatspolitischen Inanspruchnahme Vergangenheit.
"Mommsens Block" stellt das jüngste Zeugnis der Abkehr Müllers von der Rolle des Kritikers im sozialistischen Staat dar. Die im Westen den Staat ersetzende Gesellschaft bedeutet den Verlust der Referenz auf die Utopie . Müller schreibt daher kein Drama, sondern als Lyriker über die Schreibhemmung des Dramatikers. In "Mommsens Block" tritt der Autor selbst in den Vordergrund und reflektiert über die Gründe literarischen Schweigens, "wissend der ungeschriebene Text ist eine Wunde/aus der das Blut geht das kein Nachruhm stillt"(9). Im wesentlichen allerdings vollzieht Müller diese Selbstreflexion durchgängig in indirekter Weise. Bereits der Titel deutet darauf hin, hinter dem sich die im Englischen vorhandene Ambivalenz des Wortes "block" verbirgt: Mommsens Statue und gleichwohl Mommsens "writers block" sind gemeint.
Genauer charakterisieren lässt sich der Text als Gespräch mit einem Toten, als Totenbeschwörung. "Das Drama war ja ursprünglich - jedenfalls die Tragödie - Totenbeschwörung, und das hat jetzt noch Sinn". Dieser Sinn besteht in einer radikalen Zivilisationskritik. Sprache als Mitteilung unter Lebenden sei in der Gegenwart auf ihren Informationsgehalt reduziert, demgegenüber schaffe einzig der Dialog mit den Toten Kultur. "Es geht darum, dass die Toten einen Platz bekommen. Das ist eigentlich Kultur". Die Gegenwart bietet Müller keine Identifikationsfläche, daher der Rückgriff auf den ersten deutschen Nobelpreisträger Theodor Mommsen.
Inhalt
I. Kunst als Totenbeschwörung
II. Zivilisationskritik am Beispiel des "writers block"
III. Zur Problematik des Erinnerns Seite
Inschrift des Schweigens
- Citar trabajo
- Magister Artium Michael Birkner (Autor), 1994, Inschrift des Schweigens, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/194324