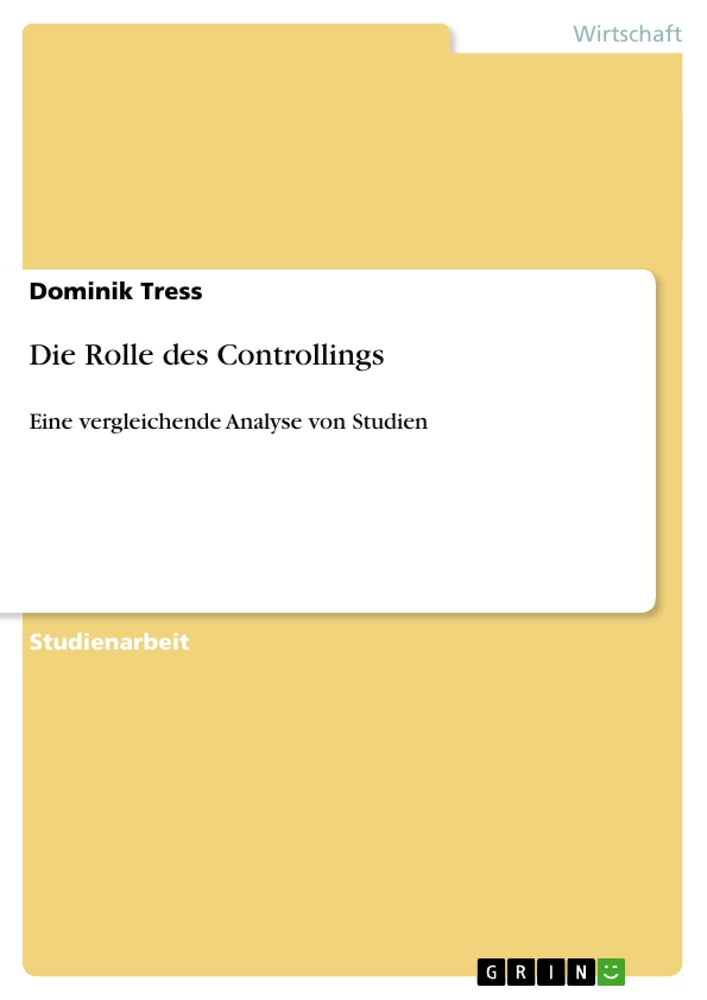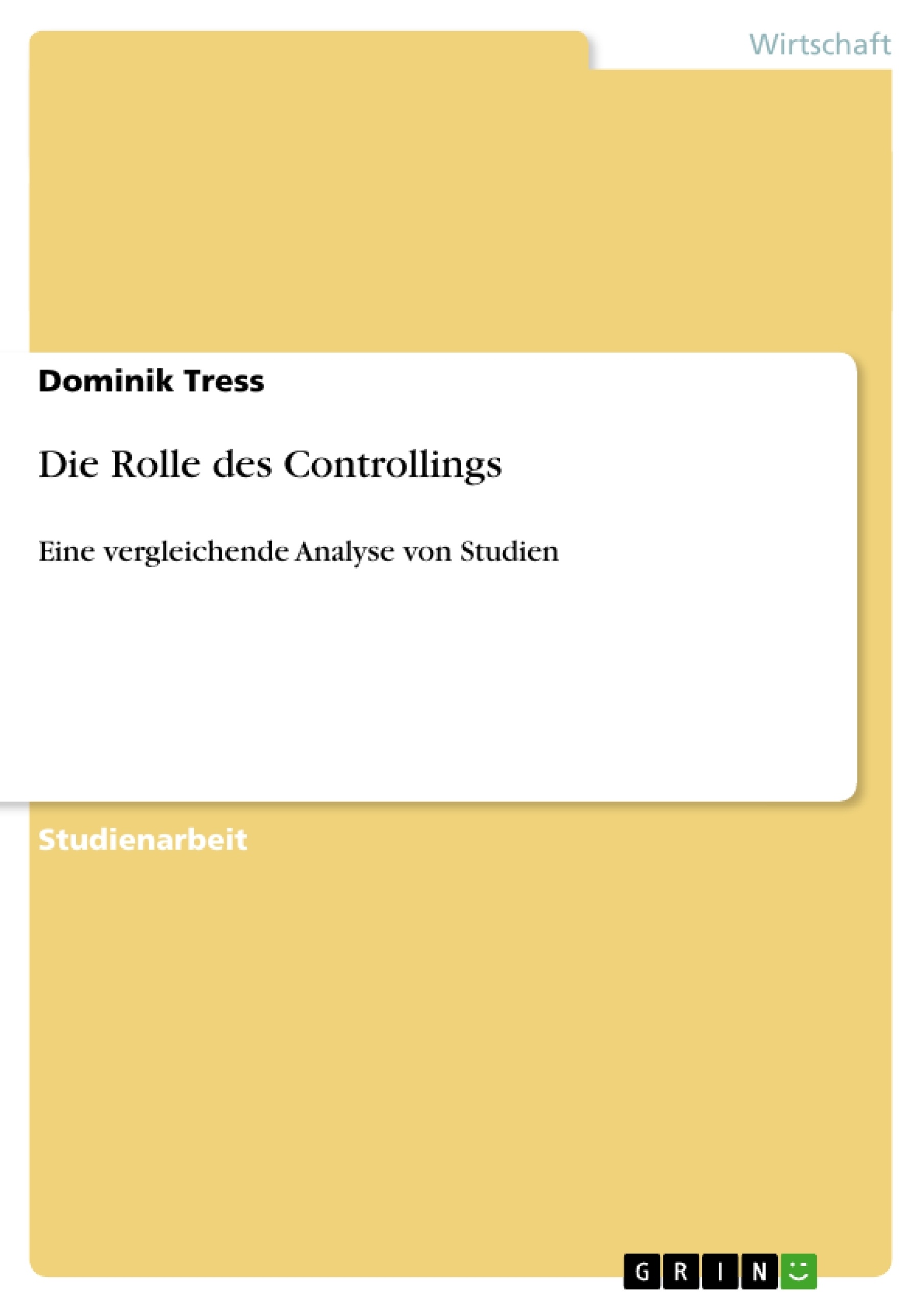Haben Jerry Siegel und Joe Shuster 1931 als sie die Comicfigur Superman geschaffen haben
dabei auch an das Rollenbild des Controllers gedacht? Selbst diese etwas pointierte
Ableitung des Bildes vom Controller wird in der Literatur aufgegriffen. Vielleicht aber versteht
sich der Controller auch als „Biltroller“, indem er Bilanzierungs- und
Controllingaufgaben wahrnimmt. Oder ist er doch der Zahlenknecht? Eines haben alle genannten
Bilder gemeinsam, sie transportieren positive und negative Emotionen, die das Controlling
prägen. Die hohe Bedeutung des Controllings in den Unternehmen ist unbestritten.
Jedoch wird die Rolle des Controllings immer noch intensiv diskutiert. Dabei wäre ein einheitliches
Verständnis über die Rolle des Controllings wichtig. Nicht nur um mit den negativ
belegten Rollenbilder Schluss zu machen, sondern vielmehr um für die anstehenden unternehmerischen
Herausforderungen gewappnet zu sein. Die turbulenten letzten Jahre10 haben
gezeigt wie wichtig das Controlling ist.
Inhalt
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Problemstellung und Zielsetzung
1.2 Gang der Untersuchung
2 Rolle des Controllings
2.1 Konzepte und Aufgaben des Controllings
2.2 Instrumente des Controllings
2.3 Organisatorische Eingliederung des Controllings
2.4 Qualifikationsprofil des Controllings
3 Studien über die Rolle des Controllings
3.1 Einordnung unterschiedlicher Studien über die Rolle des Controllings
3.2 Studie des WHU-Controllerpanels 2010
3.2.1 Untersuchungsdesign der Studie
3.2.2 Ergebnisse und Analyse der Studie
3.2.2.1 Ergebnisse zu den unterschiedlichen Rollenbildern der Controller und zum WHU-Controllerindex
3.2.2.2 Analyse der Ergebnisse zu den unterschiedlichen Rollenbildern der Controller
und zum WHU-Controllerindex
3.2.2.3 Ergebnisse zur Nutzung sowie Implementierung verschiedener
Controllingpraktiken
3.2.2.4 Analyse der Ergebnisse zu Nutzen und Implementierung verschiedener
Controllingpraktiken
3.2.3 Kritische Würdigung der Studie
3.3 Studie zum Controlling in den 30 DAX- Unternehmen
3.3.1 Untersuchungsdesign der Studie
3.3.2 Ergebnisse und Analyse der Studie
3.3.2.1 Ergebnisse zum Controlling-Verständnis
3.3.2.2 Analyse der Ergebnisse zum Controlling-Verständnis der
DAX- 30- Controller
3.3.2.3 Ergebnisse zu Fähigkeiten der Controller und Fähigkeiten der dazugehörigen
Controlling-Abteilung
3.3.2.4 Analyse der Ergebnisse zu Fähigkeiten der Controller und Fähigkeiten der
dazugehörigen Controlling-Abteilung
3.3.2.5 Ergebnisse zur Stellung des Controllings im Unternehmen
3.3.2.6 Analyse der Ergebnisse zur Stellung des Controllings im Unternehmen
3.3.2.7 Ergebnisse zu den Aufgabenschwerpunkten des Controllings
3.3.2.8 Analyse der Ergebnisse zu den Aufgabenschwerpunkten des Controllings .
3.3.2.9 Ergebnisse zu den Zukunftschancen des Controllings
3.3.2.10 Analyse der Ergebnisse zu den Zukunftschancen des Controllings
3.3.3 Kritische Würdigung der Studie
3.4 Studie zum Controlling im Mittelstand
3.4.1 Untersuchungsdesign der Studie
3.4.2 Ergebnisse und Analyse der Studie
3.4.2.1 Ergebnisse zur organisatorischen Eingliederung des Controllings
3.4.2.2 Analyse der Ergebnisse zur organisatorischen Eingliederung
des Controllings
3.4.2.3 Ergebnisse zur Rolle des Controllers in der Selbsteinschätzung
3.4.2.4 Analyse der Ergebnisse zur Rolle der Controller in der Selbsteinschätzung
3.4.2.5 Ergebnisse zur Bedeutung des Controllings
3.4.2.6 Analyse der Ergebnisse zur Bedeutung des Controllings
3.4.2.7 Ergebnisse zu den Instrumenten des Controllings
3.4.2.8 Analyse der Ergebnisse zu den Instrumenten des Controllings
3.4.2.9 Ergebnisse zum Beitrag des Controllings zum Unternehmenserfolg
3.4.2.10 Analyse der Ergebnisse zum Beitrag des Controllings zum
Unternehmenserfolg
3.4.3 Kritische Würdigung der Studie
4 Vergleichende Analyse der Studien zur Rolle des Controllings
5 Fazit
Anhang
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Übersicht über die untersuchten Studien
Abbildung 2: Rollenbilder der Controller in der Managerwahrnehmung
Abbildung 3: Zukünftig gewünschtes vs. aktuelles Rollenbildern der Controller
Abbildung 4: Einflüsse der Controller auf ihre Aufgaben (Role Making vs. Role Taking)
Abbildung 5: Nutzen der Langfristplanung
Abbildung 6: Nutzen der Budgetierungssysteme
Abbildung 7: Nutzen der Kostenrechnung
Abbildung 8: Nutzen von Entscheidungsunterstützungssystemen
Abbildung 9: Nutzen der Leistungsbeurteilung
Abbildung 10: Priorisierung der Fähigkeiten durch die Controllingleiter
Abbildung 11: Rolle der Controller in der Selbsteinschätzung
Abbildung 12: House of Controlling
Abbildung 13: Unterscheidung zwischen Controller und Controlling
Abbildung 14: Instrumente des operativen und strategischen Controllings
Abbildung 15: Instrumente des Controllings
Abbildung 16: Konvergenzbereiche von internem und externem Rechnungswesen
Abbildung 17: Die Abschnittsübersicht des Sarbanes-Oxley Act of 2002
Abbildung 18: Drei-Säulen Modell von Basel II
Abbildung 19: Beispielhafte Inhalte eines Ratinggutachtens
Abbildung 20: Funktionen von Verrechnungspreisen im Überblick
Abbildung 21: WHU-Studie: Größe der Unternehmen nach Umsatz in Mio. Euro
Abbildung 22: WHU-Controllerindex zum Standing des Controllings im Unternehmen
Abbildung 23: DAX-Studie: Alter der befragten Top-Controller
Abbildung 24: DAX-Studie: Auszüge aus Formulierungen zu Controlling-Leitbildern
Abbildung 25: DAX-Studie: Wichtigste Aufgabenfelder des Controllings
Abbildung 26: Haufe-Studie: Verteilung der Unternehmen nach Beschäftigtenzahl
Abbildung 27: Haufe-Studie: Verteilung der Unternehmen nach Existenz in Jahren
Abbildung 28: Haufe-Studie: Verteilung der Unternehmen nach Branchenstruktur
Abbildung 29: Haufe-Studie: Verteilung der Befragten nach Alter
Abbildung 30: Haufe-Studie: Verteilung der Befragten nach Berufserfahrung im Controlling
Abbildung 31: Haufe-Studie: Gruppierung der Rollebilder der Controller
Abbildung 32: Haufe-Studie: Zur Bedeutung des Controllings
Abbildung 33: Haufe-Studie: Zur Entwicklung der Bedeutung des Controllings
Abbildung 34: Haufe-Studie: Zu den Controlling-Aktivitäten in den Fachabteilungen
Abbildung 35: Haufe-Studie: Zur künftigen Bedeutung von strategischen ControllingInstrumente
Abbildung 36: Haufe-Studie: Zur Verteilung und Ausprägung der Systeme der KLR
Abbildung 37: Haufe-Studie: Zur Bedeutung einzelner operativer Controlling-Instrumente .. 53 Abbildung 38: Haufe-Studie: Zur künftigen Bedeutung operativer Controlling-Instrumente ..
Abbildung 39: Haufe-Studie: Zu den Auswirkungen der IFRS auf das Controlling
Abbildung 40: Haufe-Studie: Zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Controllerbereiche 54 Abbildung 41: Haufe-Studie: Zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit v. ControllingInstrumenten
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Einleitung
1.1 Problemstellung und Zielsetzung
Haben Jerry Siegel und Joe Shuster 1931 als sie die Comicfigur Superman geschaffen haben[1] dabei auch an das Rollenbild des Controllers gedacht? Selbst diese etwas pointierte Ableitung des Bildes vom Controller wird in der Literatur aufgegriffen.[2] Vielleicht aber versteht sich der Controller auch als „Biltroller“, indem er Bilanzierungs- und Controllingaufgaben wahrnimmt.[3] Oder ist er doch der Zahlenknecht?[4] Eines haben alle genannten Bilder gemeinsam, sie transportieren positive und negative Emotionen, die das Controlling prägen.[5] Die hohe Bedeutung des Controllings in den Unternehmen ist unbestritten.[6] Jedoch wird die Rolle des Controllings immer noch intensiv diskutiert.[7] Dabei wäre ein einheitliches Verständnis über die Rolle des Controllings wichtig.[8] Nicht nur um mit den negativ belegten Rollenbilder Schluss zu machen, sondern vielmehr um für die anstehenden unternehmerischen Herausforderungen gewappnet zu sein.[9] Die turbulenten letzten Jahre[10] haben gezeigt wie wichtig das Controlling ist.[11]
1.2 Gang der Untersuchung
Die nachfolgende Ausarbeitung ist in fünf Teile untergliedert. In Kapitel 2 wird die Rolle des Controllings, unterteilt nach Konzepten und Aufgaben, Instrumenten, organisatorische Eingliederung und Qualifikationsprofil des Controllings dargestellt. Auf zuletzt genanntes wird aufgrund der gegenwärtigen Bedeutung umfänglicher eingegangen. Das dritte Kapitel der Ausarbeitung befasst sich mit den unterschiedlichen Studien zur Rolle des Controllings. Bei der Auswahl der Studien war die Größe der befragten Unternehmen maßgeblich. Wonach zunächst eine Studie der WHU Otto Beisheim School of Management analysiert wird, darin wurden Unternehmen aller Größenklassen befragt. Anschließend wird eine von Jürgen Weber eigenständig durchgeführte Studie zum Controlling in den DAX 30-Unternehmen analysiert. Die letzte Studie hat sich mit dem Controlling im Mittelstand auseinandergesetzt. Diese drei Studien wurden ausgewählt, da ein Zusammenhang zwischen Unternehmensgröße und der Ausprägung des Controllings vermutet wird. Bei der Darstellung der einzelnen Studien wird zuerst das Untersuchungsdesign der Studie aufgezeigt. Anschließend werden die Ergebnisse der jeweiligen Studie dargestellt und analysiert. Bei der Analyse wird die Verbindung zwischen den Ergebnissen der Studie und der Literatur hergestellt. Zum Schluss erfolgt eine kritische Würdigung der Studie. Unter Kapitel 4 erfolgt schließlich die vergleichende Analyse der einzelnen Studien. Darin wird eine Verbindung zwischen den Aussagen der Studien und der in Kapitel 2 beschriebenen Rolle des Controllings hergestellt. Schließen wird diese Ausarbeitung mit einem Fazit in Kapitel 6.
2 Rolle des Controllings
2.1 Konzepte und Aufgaben des Controllings
Bei der Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Konzepten des Controllings lässt sich schnell feststellen, dass es keine „Generally Accepted Controlling Principles“ gibt.[12] Daraus resultiert, dass in der Literatur unterschiedliche Ansätze zur Controlling-Konzeption zu finden sind. Nachfolgend werden vier Konzeptionen bedeutender Wissenschaftler beschrieben, wobei die klare Abgrenzung zwischen den Ansätzen schwierig ist.[13]
Ein Ansatz von Horväth sieht im Controlling den Entwurf, die Gestaltung und die Einführung eines Planungs- und Kontrollsystems.[14] Reichmann vertritt die Auffassung, dass das Controlling die Versorgung des Managements mit aufbereiteten Informationen aus dem Rechnungswesen als Kernfunktion hat.[15] Nach Weber besteht der Controlling-Ansatz in der Sicherung der Rationalität der Unternehmensführung.[16] In der Auffassung von Hahn hat das Controlling durch das Aufbereiten von Führungsinformationen für die Erfolgszielorientierung im Unternehmen zu sorgen.[17] Der internationale Controller Verein (ICV) sieht im Controlling die Gestaltung und Begleitung des Management-Prozesses bei der Zielfindung, der Planung und Steuerung der Unternehmensprozesse sowie dem Tragen von Mitverantwortung für die Erreichung der unternehmerischen Ziele.[18]
Die einzelnen Aufgaben des Controllings lehnen sich an die beschriebenen Konzepte des Controllings an. Das so genannte House of Controlling, das in Abbildung 12 im Anhang dargestellt ist, klassifiziert die einzelnen Aufgaben. Entsprechend dem House of Controlling soll im nachfolgenden der Begriff Controller verwendet werden. Zur Verdeutlichung der begriffli- chen Unterschiede wird in Abbildung 13 im Anhang die Abgrenzung zwischen Controller und Controlling dargestellt.
Das House of Controlling kann in drei Teile zerlegt werden. Im ersten Teil wird das IGC- Controllerleitbild dargestellt und das Aufgabenprofil des Controllers beschrieben. Im zweiten Teil wird die Differenzierung der praktischen Controllertätigkeiten vorgenommen. Dabei wird nach originären Aktionsfeldern und derivativen Aktionsfeldern unterschieden.[19] Gegenstand des dritten Teils sind die einzelnen Rollenverständnisse des Controllers.[20] Nachfolgend werden die originären und derivativen Aktionsfelder des Controllers getrennt dargestellt, um die praktischen Aufgaben des Controllers zu verdeutlichen.
Bei den originären Aktionsfeldern wird zwischen Planung, Berichtswesen und Steuerung sowie Performance Measurement unterschieden. Bei der Planung hat der Controller die Aufgabe, Systeme, Instrumente und Medien zu entwickeln, welche dem Management zur Verfügung gestellt werden.[21] Das Aktionsfeld Berichtswesen baut auf der Planung auf[22] und hat die wirtschaftlichen Geschehnisse im Unternehmen darzustellen.[23] Die Darstellung erfolgt häufig in Form eines Soll-Ist-Abgleiches.[24] Als Ergebnis aus einer Abweichung des Ist- Zustandes zum Soll-Zustand resultiert die zielgerichtete Reaktion, welche als Steuerung zu verstehen ist.[25] Beim Performance Measurement misst das Controlling den Grad der Erreichung des Unternehmensziels anhand von Kennzahlen.[26]
Bei den derivativen Aktionsfeldern wird nach Gestaltung der Vorsysteme und Organisation des Controllerbereichs unterschieden. Aus der Gestaltung der Vorsysteme resultiert die Einflussnahme des Controllers auf die buchhalterischen Datenquellen. Die Aufgaben des Controllers bezüglich der Organisation des Controllerbereichs ergeben sich aus der Einflussnahme auf die aufbau- und ablauforganisatorische Mitgestaltung des Controllings.[27]
Gemäß einer weiteren Fassung besteht die Aufgabe des Controllings in der Schaffung eines wahrnehmbaren Nutzens für das Management.[28] Die detailliertere Auseinandersetzung mit den Aufgaben des Controllings erfolgt im Rahmen der Darstellung der Studien zur Rolle des Controllings in Kapitel 3 der Ausarbeitung.
2.2 Instrumente des Controllings
Die Instrumente des Controllings dienen dem Management zur Umsetzung der ControllingAufgabe. Unter den Instrumenten des Controllings werden unterschiedliche Methoden und Modelle zusammengefasst.[29] Die Wichtigkeit von Instrumenten des Controllings und die damit einhergehende Auswirkungen auf die unternehmerischen Aktivitäten haben in den letzten Jahren stark zugenommen.[30]
Eine Unterteilung der Instrumente des Controllings lässt sich nach Instrumenten des strategischen Controllings und Instrumenten des operativen Controllings vornehmen.[31] Abbildung 14 im Anhang zeigt einzelne Instrumente des operativen und strategischen Controllings. Eine weitere Unterteilung kann nach analytischen Instrumenten, heuristischen Instrumenten, Prognoseinstrumenten sowie Bewertungs- und Entscheidungsinstrumenten vorgenommen werden.[32] Abbildung 15 im Anhang führt einzelne Instrumente zu den o.g. Unterscheidungsmerkmalen auf. Besonders die erst genannte Unterteilung findet sich in der Literatur am häufigsten wieder. Daher wird nachfolgend jeweils ein bedeutendes Instrument des strategischen und operativen Controllings erläutert.
Als wichtiges strategisches Controlling-Instrument ist die Balanced Scorecard (BSC) zu nennen.[33] Die BSC ist ein das Management unterstützendes Instrument.[34] Dabei werden zur Erreichung der langfristigen Unternehmensziele Strategien in materielle Ziele und Kennzahlen transferiert.[35] Die BSC misst die Zielerreichung in vier Perspektiven: Finanziell, Kunde, Lernen und Entwicklung und interne Geschäftsprozesse.[36]
Ein operatives Instrument des Controllings ist die Break-Even-Analyse sie stellt den Zusammenhang zwischen produzierter Menge und Gewinn her.[37] Der Break-Even-Point definiert die Menge, bei welcher das Produkt die Gewinnschwelle erreicht hat.[38] Das Management verwendet dieses Instrument, um Entscheidungen über die Einführung oder Eliminierung von Produkten treffen zu können.[39]
2.3 Organisatorische Eingliederung des Controllings
Die unternehmensspezifisch „richtige“ Einordnung des Controllings im Unternehmen ist für die effektive Bewältigung aktueller Anforderungen an das Controlling von großer Bedeutung. Hierfür gibt es allerdings keine allgemeinverbindliche Definition für die „richtige“ Einordnung. Das Unternehmen hat dem Controlling eine Aufbau- und Ablauforganisation zu schaffen dies es dem Controlling ermöglichen seine Aufgaben zu erfüllen.[40] In der Literatur werden für das Controlling aus organisatorischer Sicht drei Organisationsformen diskutiert: Controlling als zentrale Organisation, Controlling als dezentrale Organisation und Controlling als „dotted- line“-Organisation.[41]
Das zentrale Controlling arbeitet bereichsübergreifend und hat stark mit Planungs- und Koordinationsaufgaben zu tun. Es ist in den meisten Fällen der Geschäftsleitung direkt unterstellt.[42] Das dezentrale Controlling ist bereichsbezogen und problemspezifisch und befasst sich schwerpunkmäßig mit Kontroll- und Steuerungsaufgaben. Das dezentrale Controlling kann entweder dem zentralen Controlling oder der zugehörigen Unternehmenssparte unterstellt sein.[43] Ist das Controlling sowohl dezentral als auch zentral organisiert liegt eine „dotted-line“-Organisation vor.[44]
2.4 Qualifikationsprofil des Controllings
Das Qualifikationsprofil des Controllings hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Die zunehmende Komplexität in Verbindung mit der dynamischen Veränderung von internen und externen Unternehmenseinflüssen sind Gründe dafür.[45] Die stärkste Prägung hat das Controlling durch die Internationalisierung erhalten. Das Controlling wird in seiner bereichsübergreifenden Funktion der Planung und Steuerung besonders von der Internationalisierung der Rechnungslegung (IFRS), der Unternehmenskontrolle (Coporate Governance, Sarbanes- Oxley Act), der Finanzierung (Basel II-Richtlinien) und der steigenden Bedeutung von globalen Beschaffungs-, Produktions-, und Absatzmärkten beeinflusst.[46] Nachfolgend werden die Auswirkungen der Aspekte der Internationalisierung auf das Controlling beschrieben.
Die Internationalisierung der Rechnungslegung (IFRS) in der Bundesrepublik hat durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) eine gesetzliche Grundlage bekommen.[47] Für das Controlling setzt dies die Notwendigkeit eines fundierten Grundwissens der IFRS vo raus.[48] Der Einfluss der IFRS auf das Controlling bringt eine Harmonisierung von internem und externem Rechnungswesen mit sich.[49] Damit verbunden ist die Frage nach dem Umfang der Harmonisierung. Abbildung 16 im Anhang zeigt die Konvergenzbereiche des internen und externen Rechnungswesens. Hieraus ergeben sich zwei mögliche Richtungen der Harmonisierung. Es können die Inhalte des internen Rechnungswesens von denen des externen Rechnungswesens bestimmt werden.[50] Gründe können extrinsischen Motiven[51] oder intrinsischen Motiven[52] geschuldet sein. Weiter können die Teilbereiche des internen Rechnungswesens in die des externen Rechnungswesens eingebunden werden. Diese Art der Harmonisierung nennt sich auch Management Approach.[53] Aus der Harmonisierung resultiert eine veränderte Betrachtungsweise der Aufgaben des Controllings. Der Controller wird in seiner Tätigkeit vermehrt mit Bilanzierungsaufgaben vertraut, woraus der „Biltroller“ (Bilanzierer und Controller) entstand.[54]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Auswirkungen der Aspekte der Internationalisierung auf das Qualifikationsprofil des Controllings stellen sich auch über die noch „neuen“ Eigenkapitalrichtlinien (Basel II) dar. Der Aufbau von Basel II wird gemäß Abbildung 18 in drei Säulen dargestellt[62], wobei die direkten Auswirkungen auf das Controlling auf die erste Säule, die Mindestkapitalanforderungen, zurückzuführen sind. Der Baseler Ausschuss hat die Mindestkapitalanforderungen im Juni 2004 verabschiedet.[63] Nach Basel I mussten die Kreditinstitute ihre Kredite mit pauschal 8 % des haftenden Eigenkapitals hinterlegen.[64] Basel II hingegen bindet die individuelle Ausfallwahrscheinlichkeit des Kreditnehmers in die Mindestkapitalanforderungen ein.[65] Je besser das Rating des Kreditnehmers, desto geringer ist das zu hinterlegende Eigenkapital.[66] Das bedeutet, dass die kreditnehmenden Unternehmen ihr Reporting den Banken gegenüber so positiv wie möglich darstellen müssen, um hohe Aufschlagssätze oder die Kreditabsage vermeiden zu können.[67] Insbesondere das Controlling muss über die das Rating beeinflussenden Faktoren informiert sein.[68] Abbildung 19 im Anhang zeigt die Inhalte eines beispielhaften Ratinggutachtens. Als Ergebnis aus der Finanzkrise wurde das Reformpaket zu Basel II, Basel III im Dezember 2010 in einer vorläufigen Endfassung vorgestellt. Basel III beinhaltet eine weitere Verschärfung der Mindestkapitalanforderungen.[69] Das Reformpaket stellt die Stabilität des Finanzsystems in den Mittelpunkt.[70]
Ein Resultat aus der zunehmenden Bedeutung von globalen Beschaffungs-, Produktions-, und Absatzmärkten besteht in der Einführung von Verrechnungspreisen.[71] Verrechnungspreise stellen den Wert von innerbetrieblich erstellten Leistungen, welche von Unternehmensbereichen anderer Rechnungskreise in Anspruch genommen werden, dar.[72] Verrechnungspreissysteme stellen als ein das Management unterstützendes System ein zentrales Element der Aufgaben des Controllings dar.[73] Des Weiteren haben Verrechnungspreise einen hohen Einfluss auf die Steuerung und Koordination von betrieblichen Einheiten.[74] Abbildung 20 im Anhang stellt die unterschiedlichen Funktionen von Verrechnungspreisen dar.
Die Ausführungen haben einen Teil der Auswirkungen der Aspekte der Internationalisierung auf das Qualifikationsprofil des Controllings dargestellt. Es ist festzuhalten, dass das Control- ling sich im Spannungsfeld der Internationalisierung befindet.[75] Eine Anpassung der Qualifikationsprofile im Controlling eröffnet den Unternehmen die Möglichkeit, die Chancen aus dem Veränderungsprozess zu nutzen.[76]
Neben dem Qualifikationsprofil des Controllings ist auch das Qualifikationsprofil des einzelnen Controllers zu nennen. Hierbei gilt es zwischen persönlichen und fachlichen Fähigkeiten zu unterscheiden.[77] In den Mittelpunkt der fachlichen Fähigkeiten rücken die Berater- und Accountingfähigkeiten.[78] Bei den persönlichen Fähigkeiten sind analytisches Denken, Teamfähigkeit, Durchsetzungsvermögen und Kommunikationsfähigkeit gefordert.[79] Es ist zu ergänzen, dass in Deutschland kein einheitliches Anforderungsprofil für Controller existiert, sondern immer eine unternehmensindividuelle Prägung vorliegt.[80]
3 Studien über die Rolle des Controllings
3.1 Einordnung unterschiedlicher Studien über die Rolle des Controllings
Um einen Überblick über die im nachfolgenden abgehandelten Studien zu bekommen, werden in Abbildung 1 die einzelnen Studien nach Autor, Untersuchungsthema, -jahr, -fokus und -umfang eingeordnet.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
3.2 Studie des WHU-Controllerpanels 2010
3.2.1 Untersuchungsdesign der Studie
Das WHU-Controllerpanel ist eine Initiative des Instituts für Management und Controlling der WHU Otto Beisheim School of Management in enger Zusammenarbeit mit dem internationalen Controllerverein (ICV). Das WHU-Controllerpanel reflektiert die Entwicklung des Controllings in Deutschland, Österreich und der Schweiz und umfasst über 800 Mitglieder, die in Unternehmen oder Non-Profit-Organisationen im Bereich Controlling tätig sind. Dabei gibt es keine Unterscheidungen nach Größenklassen. Die Mitglieder können an bis zu drei Befragungen im Jahr teilnehmen.[81]
Ein WHU-Controllerpanel hat sich im Jahr 2010 mit der Rolle der Controller befasst. Dabei wurden 851 Unternehmen aller Branchen im Zeitraum vom 12. Juli bis 27. August 2010 angeschrieben. An der Befragung haben 314 Unternehmen teilgenommen.[82] Abbildung 21 im Anhang stellt die Größen der 314 teilgenommen Unternehmen nach deren Umsatz dar.
Die Studie hat sich mit den folgenden zwei Schwerpunkten befasst:
- Zuordnung des Controllings zu unterschiedlichen Rollenbildern und die Analyse unterschiedlicher Aspekte der Controllerrolle im WHU-Controllerindex
- Nutzung sowie Implementierung verschiedener Controllingpraktiken.[83]
3.2.2 Ergebnisse und Analyse der Studie
3.2.2.1 Ergebnisse zu den unterschiedlichen Rollenbildern der Controller und zum WHU-Controllerindex
Die WHU-Studie hat die Rollenbilder der Controller in der Managerwahrnehmung, in der zukünftig gewünschten Wahrnehmung und in der Selbstwahrnehmung analysiert. Abbildung 2 auf der nächsten Seite zeigt die Ergebnisse der Rollenbilder in der Managerwahrnehmung.
Über Zweidrittel der befragten Mitglieder sehen den Controller als internen Berater, was auch die häufigste Nennung repräsentiert. Neben dem Rollenbild des Controllers als interner Berater wird der Controller auch als ökonomisches Gewissen (59%) oder Kontrolleur (52%) verstanden.[84]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Neben dem gegenwärtigen Verständnis über die Rolle des Controllings hat sich das WHU- Controllerpanel auch mit dem künftig gewünschten Rollenbild des Controllers auseinandergesetzt. Bei der Gegenüberstellung zwischen aktuellem und gewünschtem Rollenbild wird die Funktion des Controllers als interner Berater und Steuermann in Zukunft noch stärker ausgeprägt sein.[85] Abbildung 3 stellt die Ergebnisse zu den Abweichungen der gegenwärtigen Rollenbilder mit den künftigen Rollenbildern in einem Schaubild dar.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Zukünftig gewünschtes vs. aktuelles Rollenbildern der Controller
(Quelle: in Anlehnung an: WHU-Controllerpanel (2010), S. 15)
Weiteres Untersuchungsfeld der Studie ist die Rolle der Controller in der Selbstwahrnehmung. Dabei ist eine Analogie zum Rollenbild der Controller in der Managerwahrnehmung
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
festzustellen. Die vier meist genannten Rollenbilder sind interner Berater (32%), ökonomisches Gewissen (26%), Steuermann (13%) und Kontrolleur (10%).[86] Des Weiteren hat das WHU-Controllerpanel auch die Einwirkung der Controller auf ihr Rollenbild analysiert. Dabei wurden zwei bedeutende Dimensionen unterschieden.[87] Zum einen das Role Making, worunter die eigene Gestaltung der Aufgaben verstanden werden kann.[88] Und zum anderen das Role Taking, was dem Verständnis des Annehmens der Aufgaben entspricht.[89] Abbildung 4 stellt die Ergebnisse der Untersuchung im Schaubild dar. Dabei ist festzuhalten, dass die Controller ihre Aufgaben größtenteils selbst bestimmen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4: Einflüsse der Controller auf ihre Aufgaben (Role Making vs. Role Taking)
(Quelle: WHU-Controllerpanel (2010), S. 18)
Ergänzend wurden die Dimensionen Role Taking und Role Making in der zukünftigen Erwartung der Befragten gegenübergestellt. Daraus resultiert, dass nach Einschätzung der Controller besonders die externen Unternehmenseinflüsse und die Unternehmenskultur an Bedeutung gewinnen. Demgegenüber wird der Wahrnehmung der vom Management zugewiesenen Aufgaben abnehmende Bedeutung beigemessen.[90]
Das WHU-Controllerpanel hat zur Analyse des Standings eines Controllers im Unternehmen den WHU-Controllerindex eingeführt.[91] Die Ergebnisse sind Abbildung 22 im Anhang zu entnehmen. Eine weitere Untersuchung des WHU-Controllerindexes hat sich mit dem Standing des Controllings in den einzelnen Branchen befasst sowie mit dem Zusammenhang zwi- sehen Standing und Unternehmenserfolg auseinandergesetzt. Es ist festzustellen, dass das Standing in den einzelnen Branchen teilweise deutlich auseinandergeht. So hat das Controlling in der IT- und Chemiebranche ein hohes Standing, dagegen im Maschinenbau ein geringeres Standing. Ebenfalls lässt sich festhalten, dass der Unternehmenserfolg mit dem Standing des Controllings positiv korreliert. Eine weitere Korrelation wird zwischen dem Standing und dem Rollenbild der Controller deutlich. Das bedeutet, dass ein positives Rollenbild, bspw. interner Berater oder ökonomisches Gewissen, mit einem hohen Standing des Controllings im Unternehmen einhergeht. Gleichzeitig geht ein negatives Rollenbild mit einem geringen Standing einher.[92]
3.2.2.2 Analyse der Ergebnisse zu den unterschiedlichen Rollenbildern der Controller und zum WHU-Controllerindex
Das Verständnis der Controller als interne Berater deckt sich vielfach mit der Literatur.[93] Der Controller nimmt nach diesem Rollenverständnis eine Ergänzungsfunktion[94], begründet durch Könnens- oder Wollensdefizite wahr. Dabei hat er nicht nur eine beratende sondern auch eine rationalitätssichernde Funktion.[95] Unmissverständlich lässt sich aus den Funktionen eine Anlehnung an das Konzept von Weber ableiten, wonach Controlling für die Sicherung der Rationalität zu sorgen hat.[96] Neben dem Rollenbild des Controllers als interner Berater stellt das Panel den Controller als ökonomisches Gewissen (59%) und als Kontrolleur (52%) dar. Auch diese Rollenbilder finden sich in der Literatur wieder.[97] Die Funktion des Controllers als ökonomisches Gewissen versteht sich in der optimalen Abstimmung von Unternehmensabläufen.[98] Ebenso leitet sich für den Controller aus diesem Rollenbild die Funktion ab, die Effizienz des Managerhandelns kritisch zu hinterfragen.[99] Dieser koordinationsorientierte Ansatz deckt sich mit dem Controlling-Konzept von Horväth.[100] Nach dem Rollenbild des Controllers als Kontrolleur hat dieser für die Ergebniszielorientierung zu sorgen.[101] In der Literatur vertritt Hahn das ergebniszielorientierte Controlling-Konzept.[102]
Auch die Ergebnisse aus der Analyse der Einflüsse der Controller auf ihre Aufgaben, wonach das Role Making überwiegt, finden in der Literatur Bestätigung.[103] Hieraus kann auf die hierarchische Einordnung des Controllers Rückschluss gezogen werden. Demnach findet sich der Controller häufig in der ersten Führungsebene wieder[104], sodass nur CEO oder CFO die Aufgaben der Controller beeinflussen können.[105] Daraus lässt sich ableiten, dass das Controlling bei den befragten Unternehmen in der „dotted-line“-Organisation angesiedelt sein muss.[106]
Durch die Ergebnisse aus dem Rollenverständnis der Controller lassen sich Rückschluss auf das Qualifikationsprofil ziehen. Das Verständnis des Controllers als interner Berater rückt die Consulting-Fähigkeiten stärker in den Mittelpunkt.[107] Geläufige Anforderungen sehen den Berater als Analytiker, Strategen, Katalysator oder vertrauensvollen Trainer.[108] Damit verbunden sind auch weitere Kriterien, die die allgemeinverständliche Beratertätigkeit prägen. Diese sind Externalität, Unabhängigkeit und Professionalität.[109] Die zunehmende Bedeutung des Controllers als ökonomisches Gewissen ist auch als Sparringspartner des Managements zu verstehen.[110] Deckungsgleich ist das Verständnis des Controllers als kritischer Counterpart.[111] Aus diesem Verständnis leitet sich ein geändertes Qualifikationsprofil des Controllers ab, welches sich in der Reflexion des Managements von Entscheidungen darstellt.[112]
3.2.2.3 Ergebnisse zur Nutzung sowie Implementierung verschiedener Controllingpraktiken
Das zweite Feld der WHU-Studie zur Rolle der Controller hat sich mit dem Nutzen verschiedener Controllingpraktiken (Instrumente des Controllings) auseinandergesetzt. Daran haben sich 237 Mitglieder beteiligt, was 75% der gesamten Studienteilnehmer entspricht. Dabei lassen sich die abgefragten Praktiken in Langfristplanung, Budgetierungssysteme, Kostenrechnung, Entscheidungsunterstützungssysteme und Leistungsbeurteilung unterteilen. Explizit wurden die Implementierung, der vergangene Nutzen und der in den nächsten drei Jahren erwartete Nutzen abgefragt.[113]
Nachfolgende Abbildung 5 gibt die Ergebnisse der Langfristplanung entsprechend den einzelnen Praktiken wieder, wobei die hellblauen Balken den aktuellen Nutzen darstellen und die dunkelblauen Balken den zuküftig erwarteten Nutzen.[114]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Quelle: WHU-Controllerpanel (2010), S. 33)
Dabei ist festzuhalten, dass der gemeinsamen Erstellung von strategischen Plänen und Budgets sowie der formalisierten strategischen Planung der höchste Nutzen beigemessen wird. Ersteres findet auch beim zukünftig erwarteten Nutzen hohe Bedeutung. Ebenso wird den längerfristigen Forecasts eine zunehmende Bedeutung im Nutzen zugesprochen. Neben dem aktuellen und zukünftig erwarteten Nutzen wurde auch der Implementierungsstand der Controlling-Praktiken abgefragt. Demnach finden bei 86% der Befragten die längerfristigen Forecasts Anwendung. Nur 76% der Befragten gaben an, Investitionsrechenarten wie die interne Zinsfuß-Methode und die Kapitalwertmethode anzuwenden. Hierbei findet die formalisierte strategische Planung die geringste Anwendung.[115]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 6 zeigt die Ergebnisse zum Nutzen von Budgetierungssystemen. Auch hier stellen die hellblauen Balken den aktuellen Nutzen und die dukelblauen Balken den zukünftig erwarteten Nutzen dar.[116]
(Quelle: WHU-Controllerpanel (2010), S. 34)
Bei den Befragten ist der Nutzen von Budgetierungssystemen vor allem bei der Budgetierung zur Kostenkontrolle und zur Planung der finanziellen Lage am bedeutendsten. In der zukünftigen Wahrnehmung werden Budgetierung zur Kostenkontrolle, Budgetierung zur Planung der finanziellen Lage sowie die Budgetierung zur Planung von Cash-Flows an Bedeutung gewinnen. Die gegenwärtig und zukünftig geringste Bedeutung wird der Budgetierung zur Ermittlung der Manger-Vergütung beigemessen. Hinsichtlich des Implementierungsstands findet die Budgetierung zur Kostenkontrolle nahezu bei allen Unternehmen (98%) Anklang.[117]
Der Nutzen von Kostenrechnung wird in Abbildung 7 dargestellt. Die hellblauen Balken stellen den aktuellen Nutzen und die dukelblauen Balken den zuküftig erwarteten Nutzen dar.[118]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
In der aktuellen Wahrnehmung wird der Nutzen der Voll- und Teilkostenrechnung gleich eingeschätzt. Zukünftig wird jedoch die Teilkostenrechnung an Bedeutung gewinnen. Ebenso wird die Prozesskostenrechnung in ihrem zukünftig erwarteten Nutzen zunehmen. Implementiert sind die Voll- und Teilkostenrechnung zu 81% bzw. 83%. Die Prozesskostenrechnung ist zu 44% bereits heute Gegenstand der Controllingpraxis.[119]
Nachfolgende Abbildung 8 stellt den aktuellen Nutzen der Entscheidungsunterstützungssysteme dar. Hellblau ist der aktuelle Nutzen, dunkelblau der erwartete zukünftige Nutzen dargestellt. Demnach sind die beiden bedeutenden Systeme die Produktergebnisrechnung und die Break-even-Analyse. In der künftigen Bedeutung wird dem Benchmarking von operativen Prozessen und der Analyse der Wertschöpfungskette eine
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
zunehemende Bedeutung beigemessen. Ebenso werden der Produktergebniserechnung und der Break-even-Analyse höhere Bedeutung beigemessen. Auch für das Zielkostenmanagement wird in der Zukunft ein höherer Nutzen erwartet. Hinsichtlich dem Implementierungsstand ergibt sich die absteigende Rangfolge: Produktergebnisrechnung (86%), Break-even-Analyse (76%), Benchmarking von operativen Prozessen (69%) und Analyse der Wertschöpfungskette (68%).[120]
In Abbildung 9 werden die Ergebnisse zum Nutzen von Praktiken zur Leistungsbeurteilung zusammengefasst.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die hellblauen Balken stellen den aktuellen Nutzen, die dunkelblauen Balken den künftig erwarteten Nutzen dar. Bei den Ergebnisse dominieren die finanzbasierten Verfahren. Die drei meistgenannten Praktiken sind Leistungsbeurteilung anhand des finanziellen Geschäftserfolgs, der Analyse von Budgetabweichungen und des beeinflussbaren Gewinns.
[...]
[1] Vgl. http://www.greatkrypton.com/superman/creators.php (Zugriffsdatum: 01.06.2011).
[2] Vgl. Deusch, Christian (1992), S. 56.
[3] Vgl. Tiedge, J. (2008), S. 80.
[4] Vgl. Fleßa, S. (2008), S. 83f.
[5] Vgl. Goretzki, L./Weber, J./Zubler, S. (2010), S. 56.
[6] Vgl. Mehrmann, E. (2004), S. 9f.
[7] Vgl. Barth,T./Barth, D. (2008), S. 9.
[8] Vgl. Rambusch, R./Sill, F. (2007), S. 376f.
[9] Vgl. Jung, H. (2007), S. 1.
[10] Vgl. o.V. (2010), S. 138.
[11] Vgl. Weber, J. et al (2011), S. 15ff.
[12] Vgl. Küpper, H.-U./Weber, J./Zünd, A. (1990), S. 282.
[13] Vgl. Weber, J./Schäffer, U. (2006), S. 17f.
[14] Vgl. Horváth, P. (2008), S. 169; Küpper, H.-U. (2008), S. 28; Ziegenbein, K. (2007), S.25.
[15] Vgl. Reichmann, T. (2006), S. 4.
[16] Vgl. Weber, J. (2008), S. 30.
[17] Vgl. Hahn, D./Laßmann, G. (1999), S. 83; Jung, H. (2007), S. 11.
[18] Vgl. http://www.controllerverein.de/Was_ist_Controlling.50.html (Zugriffsdatum: 17.04.2011).
[19] Vgl. Weißenberger, B. (2007), S. 36.
[20] Vgl. Weißenberger, B. (2007), S. 20.
[21] Vgl. Preißler, P. (2007)S. 83.
[22] Vgl. Pook, M./Tebbe, G. (2002), S. 54.
[23] Vgl. Külpmann, B. (2005), S. 60.
[24] Vgl. Liermann, F./Uecker, P. (2006), S. 20.
[25] Vgl. Tauberger, A. (2008), S. 34.
[26] Vgl. Schmeisser, W./ Claussen, L. (2009), S. 4ff.
[27] Vgl. Weißenberger, B. (2007), S. 36.
[28] Vgl. http://www.iir.de/DATA/pdf/P1200345.pdf (Zugriffsdatum: 17.04.2011).
[29] Vgl. Müller, D./Münnich, A. (2007), S. 535.
[30] Vgl. Zühlke, J. (2006), S. 1.
[31] Vgl. Vollmuth, H. (2006), S. 18.
[32] Vgl. Baier, P. (2008), S. 121f.
[33] Vgl. Piser, M. (2004), S. 155.
[34] Vgl. Mieke, C. (2009), S. 119.
[35] Vgl. Peemöller, V. (2005), S. 190ff.
[36] Vgl. Kaplan, R./Norton, D. (1996), S. 2.
[37] Vgl. Dubrin, A. (2010), S. 208.
[38] Vgl. Spraul, A./Oeser, J. (2007), S. 108.
[39] Vgl. Götze, U. (2010), S. 192.
[40] Vgl. Meier, T./Schmidt, H. (2010), S. 7f.
[41] Vgl. Esser, J./Müller, M. (2007), S. 39ff.
[42] Vgl. Zell, M. (2008), S. 4.
[43] Vgl. Heinrich, L./Lehner, F. (2005), S. 174f.
[44] Vgl. Tiebel, C. (2003), S. 215.
[45] Vgl. Smolenski, F. (2008), S. 35f.
[46] Vgl. Funk, W./Rossmanith,J. (2007), S. 42.
[47] Vgl. Rossmanith, J./Funk, W./Eha, C. (2010), 307.
[48] Vgl. Hoffjan, A. et al (2011), S. 64.
[49] Vgl. Weißenberger, B. (2007), S. 41ff.
[50] Vgl. Funk, W./Rossmanith, J. (2007), S. 45f.
[51] Vgl. Hebeler, C. (2002), S. 33.
[52] Vgl. Jonen, A./Lingnau, V. (2005), S. 285f.
[53] Vgl. Hachmeister, D. (2004), S. 284.
[54] Vgl. Hennige, S. (2007), S. 97.
[55] Vgl. du Plessis, J. J./Hargovan, A./Bagaric, M. (2011), S. 4.
[56] Vgl. Litke, H.-D. (2007), S. 294.
[57] Vgl. Volkwein, E. (2007), S. 11 ff.
[58] Vgl. Holt, M. (2008), S. 4.
[59] Vgl. Peter, A. (2008), S. 45.
[60] Vgl. Herkendell, A. (2007), S. 122f.
[61] Vgl. Hinz, A. (2010), S. 41f.
[62] Vgl. Pracht, J. (2005), S. 57.
[63] Vgl. Perridon, L./Steiner, M. (2006), S. 384.
[64] Vgl. Padberg, C./Padberg, T. (2006), S. 35.
[65] Vgl. Blunck, S. (2010), S. 363.
[66] Vgl. Funk, W./Rossmanith, J. (2008), S. 17f.
[67] Vgl. Behr, P./Fischer, J. (2005), S. 58.
[68] Vgl. Funk, W./Rossmanith, J. (2008), S. 23.
[69] Vgl. http://www.untemehmensberatung-herke.de/beratugnsangebote/basel3_2.pdf (Zugriffsdatum: 21.04.2011).
[70] Vgl. Funk, W./Rossmanith, J. (2010), S. 23.
[71] Vgl. Korff, M. (2008), S. 1ff.
[72] Vgl. Ewert, R./Wagenhofer, A. (2008), S. 573.
[73] Vgl. Clemens, R. (2008), S. 297.
[74] Vgl. Küpper, H.-U. (2008), S. 411.
[75] Vgl. Weber, J./Meyer, M. (2005), S. 3.
[76] Vgl. Smolenski, F. (2008), S. 31.
[77] Vgl. Preißler, P. (2007), S. 39.
[78] Vgl. Scheer, A.-W. (1999), S. 397.
[79] Vgl. Schierenbeck, H./Lister, M. (2002), S. 30f.
[80] Vgl. Barth, T./Barth, D. (2008), S. 69.
[81] Vgl. http://www.whu.edu/cms/forschung/zentren/institut-fuer-management-und-controlling/institut-fuer- management-und-controlling/business/whu-controllerpanel/controllerpanel-d-a-ch/studien/ (Zugriffsdatum: 28.04.2011).
[82] Vgl. WHU-Controllerpanel (2010), S. 8.
[83] Vgl. WHU-Controllerpanel (2010), S. 7.
[84] Vgl. WHU-Controllerpanel (2010), S. 13.
[85] Vgl. WHU-Controllerpanel (2010), S. 15.
[86] Vgl. WHU-Controllerpanel (2010), S. 17.
[87] Vgl. WHU-Controllerpanel (2010), S. 18.
[88] Vgl. Neuberger, O. (2002), S. 334.
[89] Vgl. Van Ments, M. (1999), S. 7.
[90] Vgl. WHU-Controllerpanel (2010), S. 19.
[91] Vgl. WHU-Controllerpanel (2010), S. 20f.
[92] Vgl. WHU-Controllerpanel (2010), S. 21ff.
[93] Vgl. Löhr, B. (2010), S. 296; Schlüter, H. (2008), S. 28.
[94] Vgl. Weber, J. (2009), S. 46.
[95] Vgl. Weber, J. et al (2008), S. 12ff.
[96] Vgl. Weber, J. (2008), S. 30.
[97] Vgl. David, U./Prenzler, C. (2003), S. 333.
[98] Vgl. Schenkel, B. (2006), S. 144.
[99] Vgl. WHU-Controllerpanel (2010), S. 12.
[100] Vgl. Horváth, P. (2008), S. 15f.
[101] Vgl. Weber, J./Schäffer, U. (2000), S. 186.
[102] Vgl. Hahn, D./Hungenberg, H. (2001), S. 115.
[103] Vgl. Paefgen, A. (2007), S. 226.
[104] Vgl. Becker, H.-J. (2005), S. 29.
[105] Vgl. Pfennig, C. (2009), S. 275.
[106] Vgl. Müller, U. (2004), S. 236.
[107] Vgl. Scheer, A.-W. (1999), S. 397.
[108] Vgl. Mackebrandt, L. (2004), S. 30.
[109] Vgl. Bokler, A. (2004), S. 37.
[110] Vgl. Ederer, F. (2005), S. 131.
[111] Vgl. Schäffer, U./Weber, J. (2002), S. 11.
[112] Vgl. Pietsch, G. (2003), S. 29.
[113] Vgl. WHU-Controllerpanel (2010), S. 32.
[114] Vgl. WHU-Controllerpanel (2010), S. 33.
[115] Vgl. WHU-Controllerpanel (2010), S. 33.
[116] Vgl. WHU-Controllerpanel (2010), S. 34.
[117] Vgl. WHU-Controllerpanel (2010), S. 34.
[118] Vgl. WHU-Controllerpanel (2010), S. 35.
[119] Vgl. WHU-Controllerpanel (2010), S. 35.
[120] Vgl. WHU-Controllerpanel (2010), S. 36f.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rollenbilder gibt es für Controller?
Die Literatur unterscheidet zwischen verschiedenen Bildern, vom "Zahlenknecht" über den "Business Partner" bis hin zum "Navigator" oder "internen Berater".
Wie unterscheidet sich das Controlling im Mittelstand von DAX-Unternehmen?
In DAX-Unternehmen ist das Controlling oft spezialisierter und strategischer ausgerichtet, während es im Mittelstand häufig stärker operativ und eng mit dem Rechnungswesen verknüpft ist.
Was sind die Kernaufgaben des Controllings?
Dazu gehören Planung, Budgetierung, Kostenrechnung, Abweichungsanalysen und die Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen für das Management.
Was ist der Sarbanes-Oxley Act (SOX)?
Ein US-Gesetz zur Verbesserung der Unternehmensberichterstattung, das weitreichende Auswirkungen auf die Kontrollsysteme und die Rolle des Controllings weltweit hatte.
Welche Qualifikationen benötigt ein moderner Controller?
Neben exzellenten Zahlenkenntnissen sind heute zunehmend kommunikative Fähigkeiten, IT-Kompetenz und ein tiefes Verständnis des Geschäftsmodells (Business Partnering) gefragt.
- Arbeit zitieren
- Dominik Tress (Autor:in), 2011, Die Rolle des Controllings, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/194329