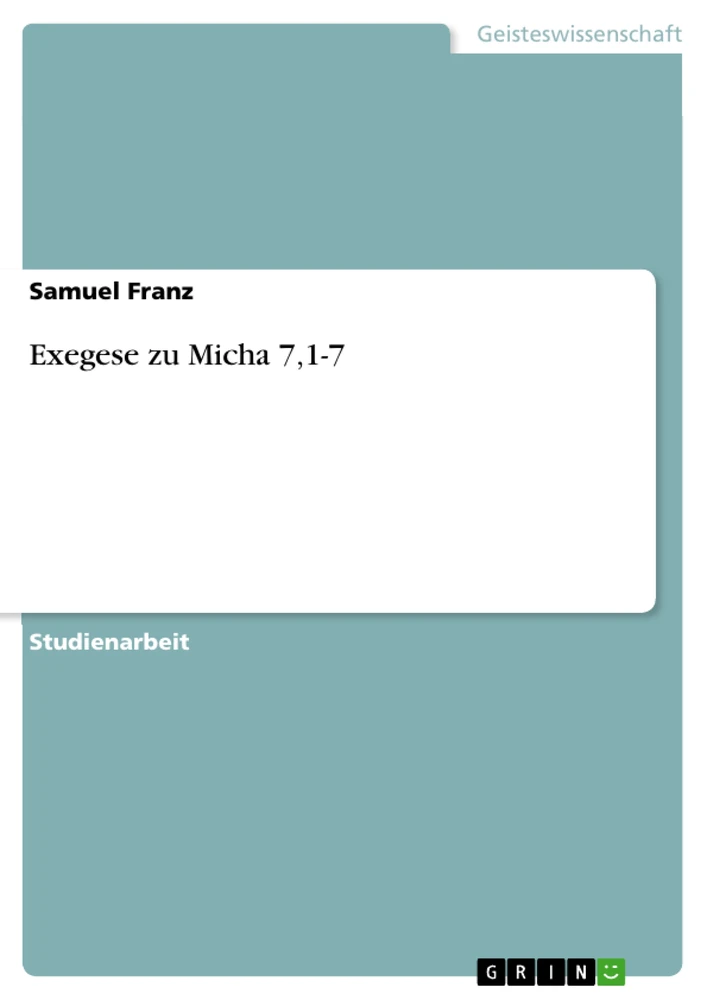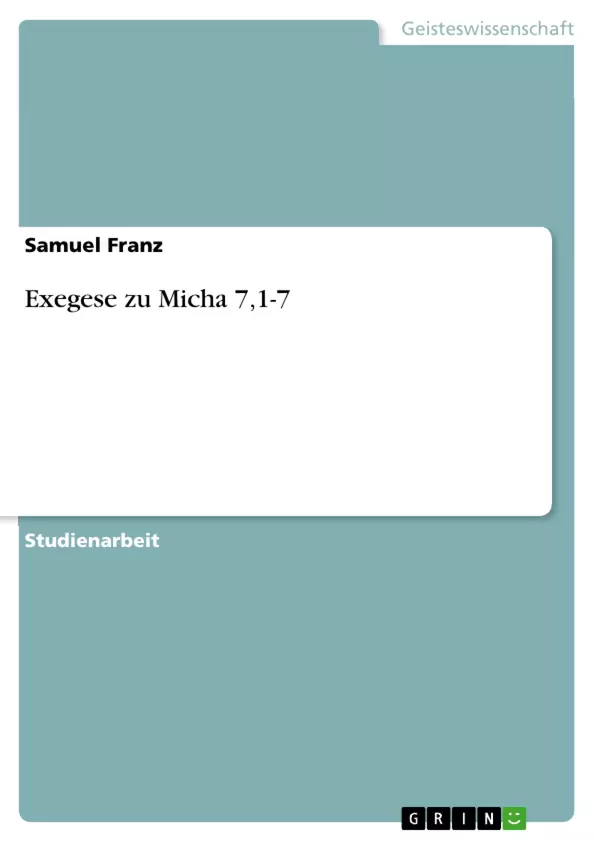Die Makrostruktur der sieben Michakapitel wird in der theologischen Literatur unterschiedlich gegliedert. Auffallend ist der ständige thematische Wechsel zwischen „Gericht und Gnade“ , zwischen „Unheils- und Heilsworten“ . Diese werden laut Schmitt traditionell – mit Heilsankündigung schließend – in Mi 1-2; 3-5 und 6-7 strukturiert, wodurch die „Abfolge Unheil (1,2-2,11) – Heil (2,12f) – Unheil (3,1-12) – Heil (4,1-5,14) – Unheil (6,1-7,7) – Heil (7,8-20)“ berücksichtigt wird. Micha wäre somit „nach einem dreifachen zweigliedrigen eschatologischen Schema aufgebaut“ . Allerdings ist Mi „2,12f. keine sehr markante Unterbrechung des ersten Unheilsankündigungsteiles“ , wodurch sich die Zweiergliederung Mi 1-5; 6-7 ergeben könnte. Darüber hinaus sind auch folgende Vierteilungen möglich: Erstens an den Heilsverheißungen orientiert („1,2-2,13; 3,1-4,8; 4,9-5,14; 6,1-7,20“ ) und zweitens die „Gliederung in […] 1,2-3,12 (Unheil) – 4,1-5,14 (Heil) – 6,1-7,7 (Unheil) – 7,8-20 (Heil)“ .
Jedoch bietet das Michabuch weitere Struktursignale, welche gegen eine Dreier- oder Vierergliederung, aber für eine zweiteilige Makrostruktur sprechen. „Hört, all ihr Völker“ und „Rache an den Nationen, die nicht gehört haben“ (Mi 5,14) stellt eine Rahmung dar. Der neu einsetzende Höraufruf in 6,1 würde den Abschnitt Mi 6-7 einleiten. „Beide Höraufrufe (1,2; 6,1) sind Aufrufe zur Teilnahme an einem ‚Rechtsstreit‘ zwischen JHWH und seinem Volk […]; auch dies bestätigt die Zäsur zwischen 5,14 und 6,1.“ Dies bedeute jedoch auch, dass die Imperative „hört“ in 3,1 und 3,9 übergangen werden. Indes bildet das wiederkehrende „an jenem Tag“ (2,4; 4,6; 5,9) und „am Ende der Tage“ (4,1) „mit dem dreifachen ‚jetzt‘ von 4,9.11.14 eine Zeitstruktur, die die sonstigen Strukturmerkmale in Mi 1-5 transzendiert“ . Meines Erachtens ist die Zweigliederung (Mi 1-5; 6-7) von dem „kunstvoll verschachtelten Text mit Vorwegnahmen und Wiederaufnahmen bei gleichzeitig deutlich erkennbaren thematischen Schwerpunktbildungen“ am besten argumentiert, zumal sie eine weitere Untergliederung nicht ausschließt. Demnach gehört meine Perikope in den zweiten Teil des Michabuches, genauer zu den Unheils- bzw. den Gerichtsworten dieses Abschnittes.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Kontext und literarische Gattung
- Historische Einordnung des Textes
- Situationsanalyse
- Verfasser
- Abfassungsort und Abfassungszeit
- Adressat
- Nachforschungen zur Zeitgeschichte
- Textkritik
- Textanalyse
- Synchrone Analyse
- Analyse des Textzusammenhangs
- Kontext und Abgrenzung
- Entstehungssituation
- Textinterne Analyse
- Lexikalisch-grammatikalische Analyse
- Semantisch-kommunikative Analyse
- Sprachliche Untersuchung
- Stilanalyse
- Form- und gattungsgeschichtliche Analyse
- Analyse auf Textebene
- Kohärenz und Struktur
- Pragmatische Analyse
- Rhetorische Analyse
- Narrative Analyse
- Diachrone Analyse
- Religionsgeschichtlicher Vergleich
- Literarische Analyse
- Traditionsgeschichtliche Analyse
- Redaktionsgeschichtliche Analyse
- Zusammenhangsexegese
- Definitive Übersetzung
- Fortlaufende Textauslegung
- Theologischer Ertrag
- Beiträge zu einer biblischen Theologie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Exegese des Textes Micha 7,1-7 und zielt darauf ab, den Text in seinen literarischen, historischen und theologischen Kontext einzuordnen. Die Arbeit analysiert den Text anhand verschiedener exegetischer Methoden und untersucht die Bedeutung des Textes für das Verständnis der biblischen Botschaft.
- Die literarische Gattung des Textes: Prophetische Literatur
- Die historische Einordnung des Textes: Zeit des Propheten Micha im südlichen Königreich Juda
- Die Analyse des Textes: Synchrone und diachrone Betrachtungsweise
- Die Interpretation des Textes: Theologischer Ertrag und Bedeutung für das Verständnis der biblischen Botschaft
- Die Einordnung des Textes in den Gesamtkontext der Bibel: Beiträge zu einer biblischen Theologie
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung
Die Einführung behandelt den Kontext des Textes Micha 7,1-7 innerhalb der „Zwölf Propheten“ sowie dessen literarische Gattung. Sie führt in die historische Einordnung des Textes ein, beleuchtet die Situationsanalyse, den Verfasser, den Abfassungsort und die Abfassungszeit sowie den Adressaten. Außerdem werden die Nachforschungen zur Zeitgeschichte behandelt.
Textanalyse
Das Kapitel „Textanalyse“ gliedert sich in synchrone und diachrone Analysen. Die synchrone Analyse befasst sich mit dem Textzusammenhang, der textinternen Analyse, der Analyse auf Textebene sowie der pragmatischen Analyse. Die diachrone Analyse hingegen beleuchtet den religionsgeschichtlichen Vergleich, die literarische Analyse, die traditionsgeschichtliche Analyse und die redaktionsgeschichtliche Analyse.
Zusammenhangsexegese
Der Abschnitt „Zusammenhangsexegese“ präsentiert eine definitive Übersetzung des Textes sowie eine fortlaufende Textauslegung. Darüber hinaus wird der theologische Ertrag des Textes beleuchtet und dessen Beitrag zu einer biblischen Theologie untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt zentrale Themen wie die prophetische Literatur, die historische Einordnung des Textes in die Zeit des Propheten Micha, die synchrone und diachrone Textanalyse sowie den theologischen Ertrag der Exegese. Weitere wichtige Begriffe sind „Gericht und Gnade“, „Unheils- und Heilsworten“, „Rechtsstreit zwischen JHWH und seinem Volk“, „Zeitstruktur“, „Makrostruktur“ und „prophetische Gattung“.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das zentrale Thema des Michabuches?
Das Buch ist geprägt vom ständigen Wechsel zwischen Gericht und Gnade sowie zwischen Unheils- und Heilsworten.
Wie wird die Makrostruktur von Micha 7,1-7 eingeordnet?
Die Perikope gehört zum zweiten Teil des Michabuches (Kapitel 6-7), der als Rechtsstreit zwischen Gott (JHWH) und seinem Volk eingeleitet wird.
Was bedeutet der „Höraufruf“ in der Exegese?
Die Imperative „Hört“ (z.B. in 6,1) fungieren als Struktursignale, die neue Abschnitte einleiten und zur Teilnahme an einem göttlichen Rechtsstreit auffordern.
Welche Methoden werden in dieser Exegese angewandt?
Es werden synchrone Analysen (Stil, Form, Gattung) und diachrone Analysen (Traditions-, Redaktions- und Religionsgeschichte) durchgeführt.
Wann und wo entstand der Text des Propheten Micha?
Der Text wird historisch in die Zeit des Propheten Micha im südlichen Königreich Juda eingeordnet.
- Quote paper
- Samuel Franz (Author), 2011, Exegese zu Micha 7,1-7, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/194343