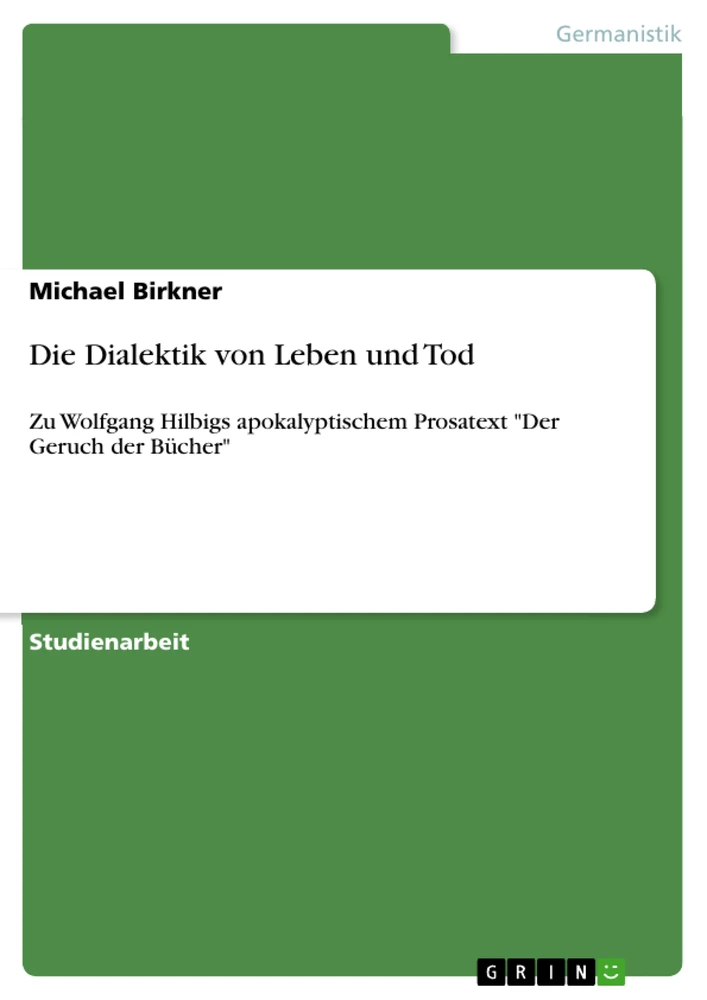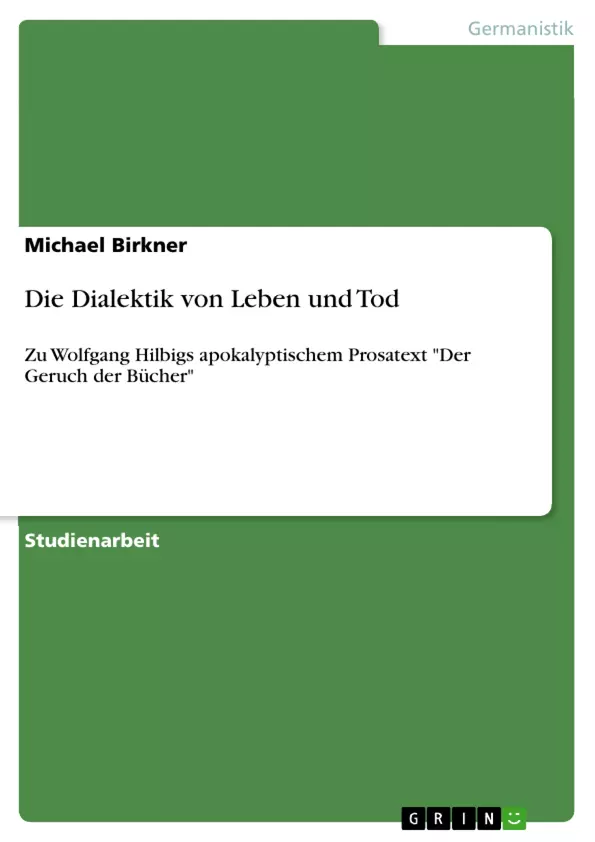Es ist ein für Hilbigs Schreiben typisches Verfahren, scheinbar belanglose Tätigkeiten, welchen seine zumeist von Müdigkeit befallenen Figuren nachgehen, durch die Schilderung eines ungewöhnlichen Vorkommnisses, einer schockartigen Erfahrung oder einer obsessiven Phantasie mit Bedeutung aufzuladen. Stehen die Figuren unter einem unausweichlichen Eindruck, der ihr Bewusstsein ganz besetzt hält, setzt eine Reflektionsbewegung ein, durch die sie sich der sinnlichen Wahrnehmungen und letztlich ihrer selbst zu vergewissern suchen. Diese Phantasmagorien sind es zugleich, welche das herrschende Bild von der Realität außer Kraft setzen und aus diesem getilgte Spuren der Wirklichkeit zum Vorschein bringen.
So beginnt die Erzählung "Der Geruch der Bücher" mit dem Erwachen des Ich-Erzählers in einer Ost-Berliner Wohnung, wo ihn der "dumpfe Geruch der Bücher" (3) einer dort platzierten immensen russischen Bibliothek in einen Zustand zwischen Wachen und Träumen versetzt. Die Bücher stammen aus dem Besitz eines intellektuellen Exilrussen, der eine Zeit lang die Wohnung gemietet hatte und - "an seinem plötzlich heimatlosen Besitz irre geworden" (3) - irgendwann vor ihnen geflüchtet war. Wie der Leser später erfährt, handelt es sich um Bücher, die im Heimatland des Russen verboten waren und die aus diesem Grund "verrufene und subversive" (9) Gerüche angenommen hatten. Die Geruchsaussonderung sei an diesem Wintermorgen "durch Licht oder Wärme" (3) verstärkt worden, da der Erzähler die Wohnung in der Nacht überheizt hat. Der Geruchseindruck ist schließlich so intensiv, dass er mit dem Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen, das Fenster öffnet.
Hilbig führt hier vor, wie die Obsession durch eine sinnliche Wahrnehmung eine Fluchtbewegung auslöst, der abgeschlossene Innenraum als Bild für das Gefängnis des Bewusstseins im Zustand der Erfahrung des Irrealen mit der Außenwelt konfrontiert wird.
Mit dem Geruchsmotiv, durch welches der Eindruck einer irrealen Atmosphäre vermittelt wird, geht funktional die Schneemetaphorik einher, die die Außenwelt ähnlich irreal erscheinen lässt. Der Erzähler erinnert sich an den gestrigen Tag...
Inhaltsverzeichnis
- I. Absage an den Realismus
- II. Die Erfahrung des Irrealen: Büchergeruch und Schneetreiben
- III. Das Wissen der Heizer: Die Dialektik von Tod und Leben
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay analysiert Wolfgang Hilbigs Prosatext "Der Geruch der Bücher" und befasst sich mit der Frage, wie Hilbig den Realismus-Begriff und die Möglichkeiten sprachlichen Ausdrucks in einem totalitären Kontext hinterfragt. Der Text zeichnet ein Bild der Verdrängung und Manipulation in der DDR und zeigt, wie die Sprache selbst zu einem Werkzeug der Kontrolle wird.
- Die Kritik am sozialistischen Realismus und dessen sprachliche Konstruiertheit
- Die Suche nach einer Sprache, die den Realitäten der DDR gerecht wird
- Die Dialektik von Leben und Tod als zentrales Motiv
- Die Rolle von Literatur und Sprache in der Konfrontation mit der Wirklichkeit
- Die Ambivalenz von Sprache und Realität im totalitären Staat
Zusammenfassung der Kapitel
I. Absage an den Realismus
In diesem Kapitel wird Hilbigs Kritik am sozialistischen Realismus und dessen sprachliche Konstruktion beleuchtet. Der Autor argumentiert, dass eine Orientierung an einem begrenzten Realismus-Begriff die Möglichkeiten der Sprache einschränkt und den Blick auf die "Wirklichkeit" vernebelt.
II. Die Erfahrung des Irrealen: Büchergeruch und Schneetreiben
Dieses Kapitel analysiert den Einsatz von Bildern und Motiven in "Der Geruch der Bücher", insbesondere die Rolle des Büchergeruchs und des Schneetreibens. Es geht darum, wie diese Elemente die Irrealität und die Verzerrung der Wahrnehmung in einem totalitären Staat veranschaulichen.
III. Das Wissen der Heizer: Die Dialektik von Tod und Leben
In diesem Kapitel wird die zentrale Thematik des Textes, die Dialektik von Leben und Tod, beleuchtet. Es wird untersucht, wie die Arbeit der Heizer in "Der Geruch der Bücher" ein Sinnbild für die menschlichen Abgründe und die Vergänglichkeit des Lebens darstellt.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Textes sind: Realismus, Sprache, Wirklichkeit, Totalitarismus, DDR, Leben, Tod, Verdrängung, Manipulation, Sprache als Kontrollinstrument, Literatur als Widerstand.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Wolfgang Hilbigs Erzählung "Der Geruch der Bücher"?
Die Erzählung thematisiert die Erfahrung der Irrealität in einem totalitären Staat (DDR) und nutzt den intensiven Geruch verbotener Bücher als Auslöser für Reflexion und Fluchtbewegungen.
Was symbolisiert der "Geruch der Bücher" im Text?
Der Geruch steht für das Subversive und Verrufene von Literatur, die in einem totalitären System verboten war, und wirkt als physisch spürbare Spur der unterdrückten Wirklichkeit.
Welche Kritik übt Hilbig am Sozialistischen Realismus?
Hilbig kritisiert, dass dieser Realismus-Begriff sprachlich konstruiert ist und dazu dient, die tatsächliche Wirklichkeit zu vernebeln und zu manipulieren.
Was bedeutet die "Dialektik von Leben und Tod" in diesem Kontext?
Sie beschreibt das Spannungsverhältnis zwischen der lebendigen Erfahrung des Individuums und der erstarrten, lebensfeindlichen Struktur des totalitären Systems, oft versinnbildlicht durch die Arbeit der Heizer.
Welche Rolle spielt die Sprache in Hilbigs Werk?
Sprache wird sowohl als Werkzeug der Kontrolle durch den Staat als auch als Mittel des Widerstands und der Selbstvergewisserung des Individuums dargestellt.
Was bewirken die "Phantasmagorien" in der Erzählung?
Diese obsessiven Phantasien setzen das herrschende Bild der Realität außer Kraft und bringen verdrängte Spuren der Wirklichkeit ans Licht.
- Arbeit zitieren
- Magister Artium Michael Birkner (Autor:in), 1995, Die Dialektik von Leben und Tod, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/194417