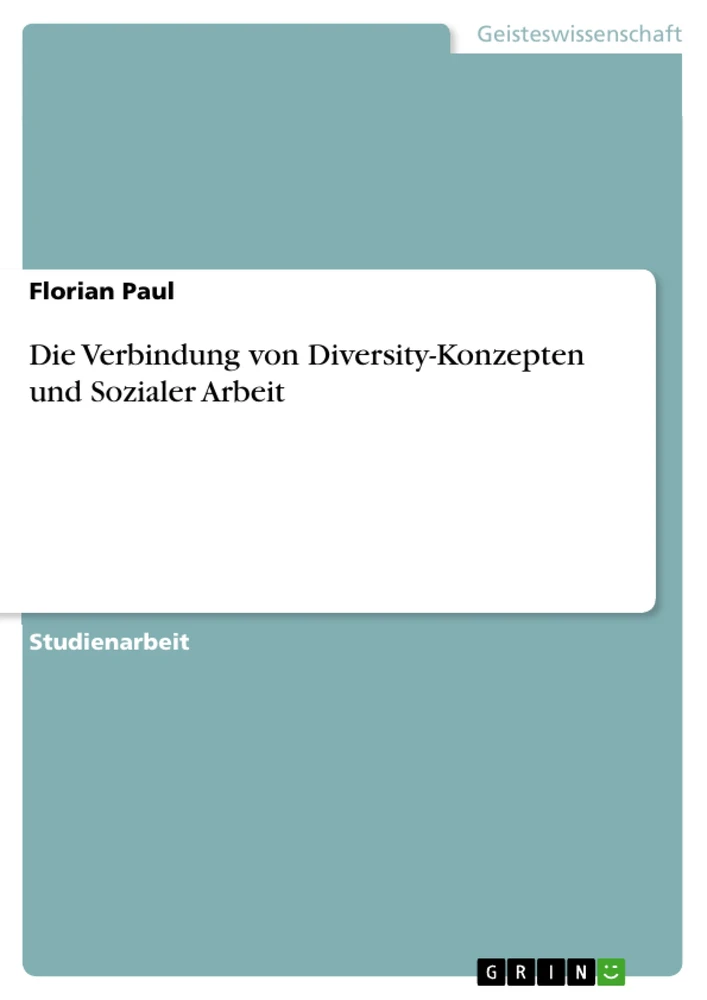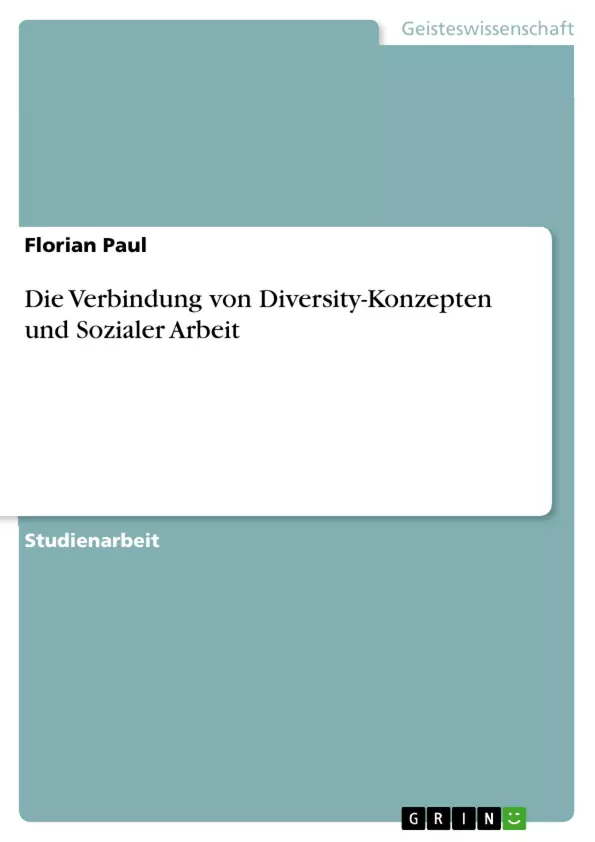Ausgehend von dem lange Zeit vorherrschenden Verständnis der Differenzminimierung als Aufgabe der Sozialen Arbeit, soll über den Grundsatz der Differenzakzeptanz und das Konzept der Lebensweltorientierung der Bogen zum bertriebswirtschaftlichen "Diversity-Management" gespannt werden. Es soll versucht werden zu klären, wo sich die Soziale Arbeit von diesem Verständnis von diversity abgrenzen muss und wo Anknüpfungspunkte vorhanden sind. Abschließend soll geklärt werden, wo sich die Profession unter Umständen sogar weiterentwickeln muss, um dem ganzheitlichen Anspruch von diversity politics gerecht werden zu können, denn "es bedarf der kritischen Reflexion des eigenen Selbstverständnisses und einer bewussten Gegensteuerung gegen das Fortschreiben der Normalität, will man die Dominanzverhältnisse nicht einfach reproduzieren"(Rommelspacher 2003, S. 79).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Verständnis von Differenz in der Sozialen Arbeit
- Akzeptanz von Differenzen und die Lebensweltorientierung in der Sozialen Arbeit
- Das Konzept des "Diversity-Managements" in Unternehmen - Abgrenzung, Gemeinsamkeiten und Bedeutung für die Soziale Arbeit
- Fazit - Die Repolitisierung der Sozialen Arbeit in Praxis und Lehre als Voraussetzung für die Umsetzung von diversity politics
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Verbindung von Diversity-Konzepten und der Sozialen Arbeit. Sie untersucht, inwiefern die Soziale Arbeit von diesen Konzepten lernen kann und ob sich Verbindungen herstellen lassen, um den Umgang mit Differenzen in der Gesellschaft zu verbessern.
- Das Verständnis von Differenz in der Sozialen Arbeit und die Kritik an der Differenzminimierung
- Die Bedeutung der Akzeptanz von Differenzen und Lebensweltorientierung in der Sozialen Arbeit
- Das Konzept des "Diversity-Managements" in Unternehmen und seine Relevanz für die Soziale Arbeit
- Die Repolitisierung der Sozialen Arbeit als Voraussetzung für die Umsetzung von diversity politics
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die These auf, dass die Soziale Arbeit den Umgang mit Vielfalt bisher nur isoliert behandelt und eine ganzheitliche Sichtweise fehlt. Sie beleuchtet die Notwendigkeit der Repolitisierung der Sozialen Arbeit, um den Herausforderungen der Diversity-Thematik gerecht zu werden.
- Das Verständnis von Differenz in der Sozialen Arbeit: Dieses Kapitel analysiert das traditionell vorherrschende Verständnis von Differenzminimierung in der Sozialen Arbeit und zeigt die Kritik auf, die von verschiedenen Bewegungen geäußert wurde. Es wird deutlich, dass die Soziale Arbeit in der Vergangenheit die Bedürfnisse und Lebensrealitäten von marginalisierten Gruppen nicht ausreichend berücksichtigt hat.
- Akzeptanz von Differenzen und die Lebensweltorientierung in der Sozialen Arbeit: Dieses Kapitel befasst sich mit der Notwendigkeit, Differenzen zu akzeptieren und die Lebenswelten von Klienten/innen in den Mittelpunkt der Arbeit zu stellen. Es beleuchtet die Bedeutung der Lebensweltorientierung als Ansatzpunkt für eine gerechtere und inklusivere Soziale Arbeit.
- Das Konzept des "Diversity-Managements" in Unternehmen: Dieses Kapitel untersucht das Konzept des "Diversity-Managements" und seine Relevanz für die Soziale Arbeit. Es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen beiden Bereichen beleuchtet und es wird diskutiert, wie die Soziale Arbeit von diesem Konzept profitieren kann.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beleuchtet die folgenden Schlüsselbegriffe: Soziale Arbeit, Diversity, Differenz, Akzeptanz, Lebensweltorientierung, Diversity-Management, Repolitisierung, gesellschaftliche Norm, Machtverhältnisse, Menschenrechte.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel von Diversity-Konzepten in der Sozialen Arbeit?
Ziel ist der Wechsel von der Differenzminimierung hin zur Differenzakzeptanz, um die Vielfalt der Lebenswelten der Klienten ganzheitlich zu würdigen.
Wie unterscheidet sich "Diversity-Management" in Unternehmen von Sozialer Arbeit?
Während Unternehmen Diversity oft zur Effizienzsteigerung nutzen, sollte die Soziale Arbeit einen menschenrechtlich orientierten und machtkritischen Ansatz verfolgen.
Was bedeutet "Repolitisierung" der Sozialen Arbeit?
Es bedeutet, soziale Probleme nicht nur als individuelle Defizite zu sehen, sondern die zugrunde liegenden gesellschaftlichen Dominanzverhältnisse und Diskriminierungen kritisch zu hinterfragen.
Warum ist Lebensweltorientierung für Diversity wichtig?
Sie stellt sicher, dass die spezifischen sozialen, kulturellen und ökonomischen Bedingungen der Klienten die Basis für die Unterstützung bilden, statt eine abstrakte "Normalität" vorauszusetzen.
Welche Rolle spielen Machtverhältnisse beim Thema Diversity?
Diversity Politics erfordert die Reflexion des eigenen Selbstverständnisses, um zu verhindern, dass bestehende Machtstrukturen in der Beratung einfach reproduziert werden.
- Quote paper
- Florian Paul (Author), 2012, Die Verbindung von Diversity-Konzepten und Sozialer Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/194483