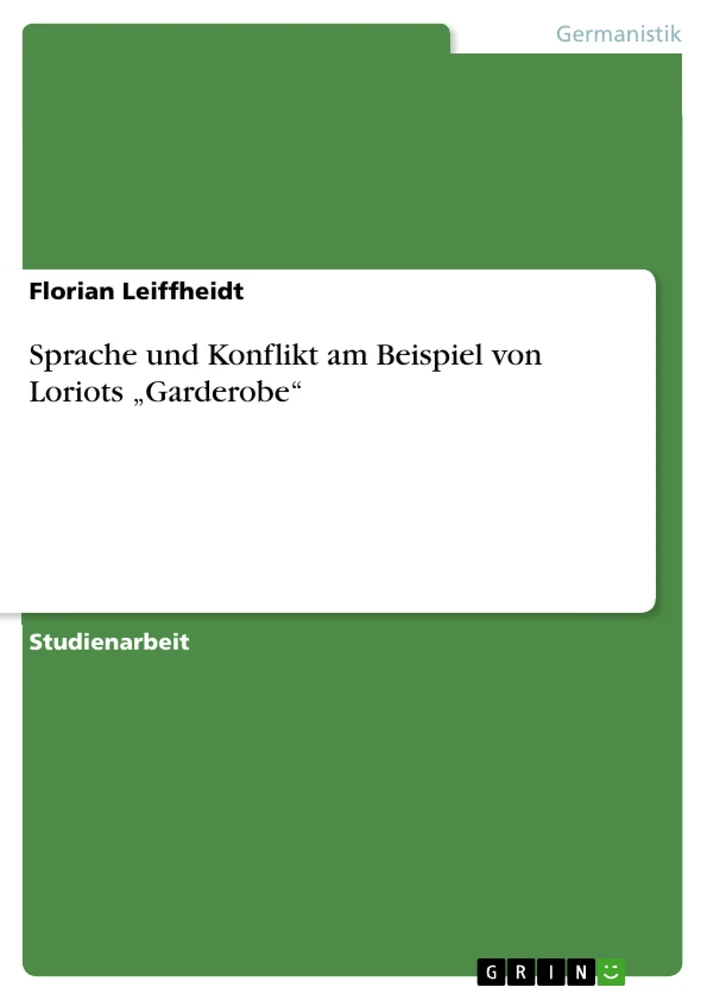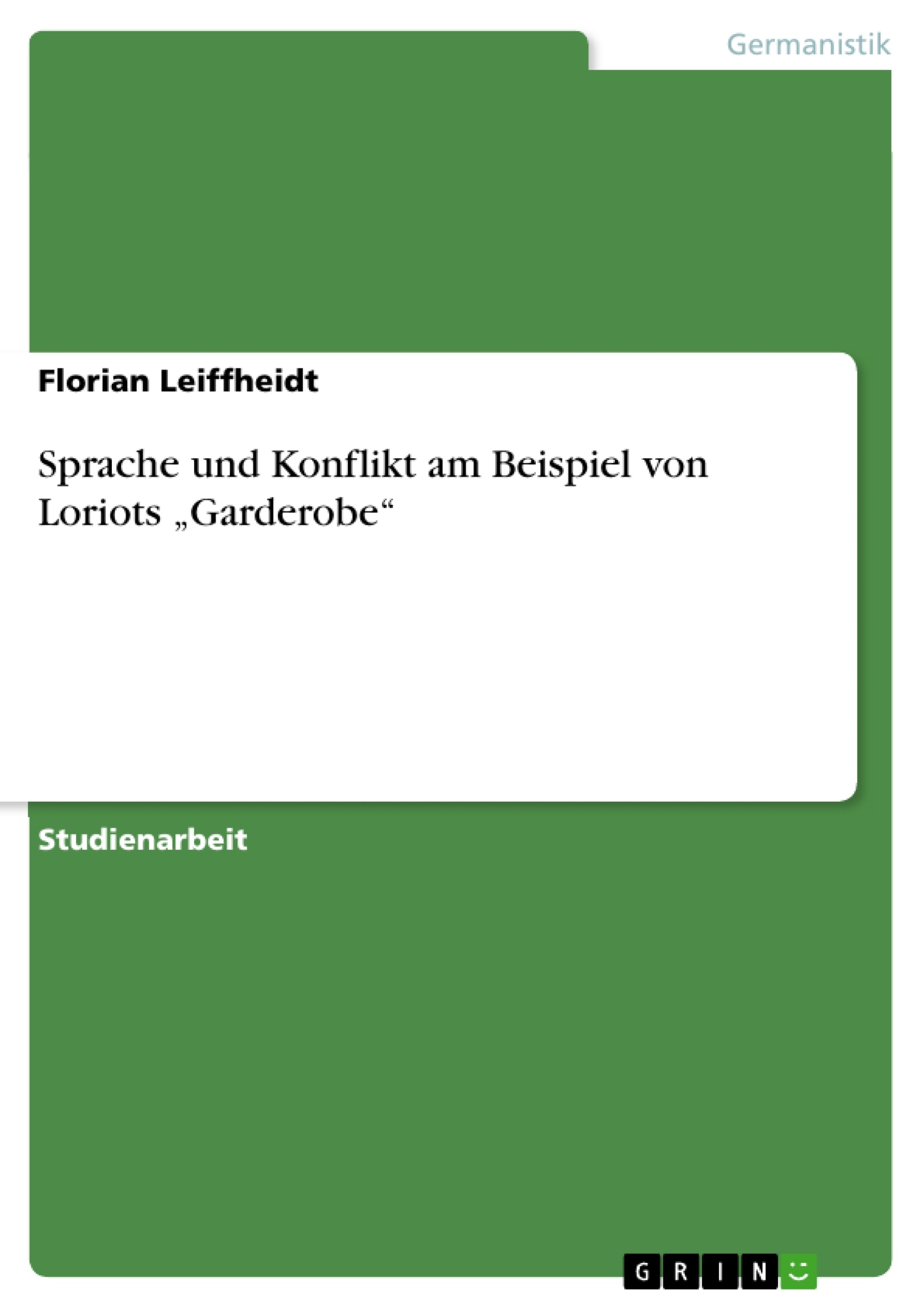Kommunikation generell ist, da sie zwischen mindestens zwei Akteuren stattfindet, von Störungen und Missverständnissen bedroht und kann bei eben diesen zu Konflikten führen. Diese Konflikte können größeren Ausmaßes sein, etwa gesellschaftlicher Art bei missverständlichen Aussagen zu sensiblen Themen, man erinnere sich beispielsweise an die Aussagen einer Politikerin der Partei DIE LINKE zum Kommunismus oder den Aussagen Thilo Sarrazins bezüglich der Integrationsdebatte. Beide Fälle zogen lange und intensive Diskussionen nach sich und häufig konnte man vernehmen, es handele sich um so genannte missverständliche Aussagen.
Doch können diese Konflikte und Missverständnisse nicht nur auf der großen gesellschaftlichen Bühne, sondern auch im kleinsten Kreise interpersoneller Kommunikation stattfinden, so zum Beispiel in der Kommunikation zwischen Mann und Frau. Häufig, besonders in den letzten Jahren, schmückt gerade dieses Thema die Programme sämtlicher humoristischer Programme, welche vorgeben, eine Anleitung zum besseren Verständnis des anderen Geschlechts zu geben. Aber sind Männer und Frauen wirklich so verschieden? Und wenn dem so ist, wo genau liegen die Unterschiede in ihren kommunikativen Praktiken? Und was passiert, wenn genau diese Praktiken mit all ihren Unterschieden unberücksichtigt und ohne Kompromisse aufeinandertreffen? Auf diese Fragen soll in dieser Arbeit eingegangen werden.
Zunächst soll die Kommunikation allgemein an zwei Beispielen genauer erläutert werden, zum einen dem Konzept Schulz von Thuns, zum anderen folgt eine Erklärung der Konversationsmaximen von Paul Grice. Im Anschluss an den Teil der Kommunikationstheorien schließt sich die knappe Darlegung grundlegender Unterschiede in der typiscjem Männer- und Frauenkommunikation an, welche als Vorüberlegung zur Beschäftigung mit dem Dialog von Loriot angesehen werden kann. Letzlich soll die geschlechtsspezifische Kommunikation samt ihrem Konfliktpotenzial durch eine Grobanalyse des Loriot-Dialoges veranschaulicht und abschließend zusammengefasst werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Grundlagen der Kommunikation nach Friedemann Schulz von Thun
- die vier Seiten einer Nachricht
- 3. Die Konversationsmaximen nach Paul Grice
- 4. Geschlechtsspezifische Kommunikationsmerkmale
- 4.1. Kommunikationsmerkmale der „männlichen“ Kommunikation
- 4.2. Kommunikationsmerkmale der „weiblichen“ Kommunikation
- 5. Konfliktfelder der Geschlechterkommunikation am Beispiel von Loriots „Garderobe“ - eine Grobanalyse
- 6. Zusammenfassung
- 7. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Komplexität der Kommunikation und die Entstehung von Missverständnissen, insbesondere im Kontext der geschlechtsspezifischen Kommunikation. Sie analysiert, wie unterschiedliche kommunikative Praktiken zu Konflikten führen können. Die Arbeit nutzt das Konzept der vier Seiten einer Nachricht nach Schulz von Thun und die Konversationsmaximen von Grice als theoretische Grundlage. Der Dialog aus Loriots „Garderobe“ dient als Fallbeispiel zur Veranschaulichung der behandelten Themen.
- Die Mehrschichtigkeit von Kommunikation und die daraus resultierenden Missverständnisse
- Das Modell der vier Seiten einer Nachricht nach Schulz von Thun
- Die Konversationsmaximen nach Grice und ihre Bedeutung für gelingende Kommunikation
- Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Kommunikation
- Konfliktpotenziale in der Geschlechterkommunikation am Beispiel von Loriots „Garderobe“
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der kommunikativen Störungen und Missverständnisse ein, die zu Konflikten führen können, sowohl im gesellschaftlichen Kontext als auch in der zwischenmenschlichen Kommunikation, insbesondere zwischen Männern und Frauen. Sie stellt die Forschungsfrage nach den Unterschieden in der männlichen und weiblichen Kommunikation und den daraus resultierenden Problemen. Die Arbeit skizziert den methodischen Ansatz, der die Kommunikationstheorien von Schulz von Thun und Grice nutzt, um anschließend den Dialog von Loriot zu analysieren.
2. Die Grundlagen der Kommunikation nach Friedemann Schulz von Thun – die vier Seiten einer Nachricht: Dieses Kapitel erläutert das Modell der vier Seiten einer Nachricht nach Friedemann Schulz von Thun. Es beschreibt die Sach-, Selbstoffenbarungs-, Beziehungs- und Appellseite jeder Nachricht und verdeutlicht, wie die Mehrdeutigkeit von Botschaften zu Missverständnissen führen kann. Das Kapitel betont die Komplexität der zwischenmenschlichen Kommunikation und wie leicht selbst unmissverständliche Worte in unterschiedliche Zusammenhänge gestellt werden können, abhängig von der Interpretation des Empfängers. Der Fokus liegt darauf, wie die unterschiedlichen Aspekte einer Nachricht – Sachinhalt, Selbstoffenbarung, Beziehung und Appell – interagieren und zu Missverständnissen führen können.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse der Geschlechterkommunikation anhand von Loriots "Garderobe"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Komplexität der Kommunikation und die Entstehung von Missverständnissen, insbesondere im Kontext der geschlechtsspezifischen Kommunikation. Sie untersucht, wie unterschiedliche kommunikative Praktiken zu Konflikten führen können, unter Verwendung des Dialogs aus Loriots "Garderobe" als Fallbeispiel.
Welche Theorien werden verwendet?
Die Arbeit basiert auf dem Modell der vier Seiten einer Nachricht nach Friedemann Schulz von Thun und den Konversationsmaximen von Paul Grice. Diese Theorien dienen als theoretische Grundlage zur Analyse der Kommunikation und der Entstehung von Missverständnissen.
Welche Aspekte der Kommunikation werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Mehrschichtigkeit von Kommunikation und die daraus resultierenden Missverständnisse. Im Fokus stehen das Modell der vier Seiten einer Nachricht, die Konversationsmaximen und ihre Bedeutung für gelingende Kommunikation, sowie geschlechtsspezifische Unterschiede in der Kommunikation und das Konfliktpotenzial in der Geschlechterkommunikation.
Wie wird Loriots "Garderobe" in die Analyse einbezogen?
Der Dialog aus Loriots "Garderobe" dient als Fallbeispiel zur Veranschaulichung der behandelten Themen und zur konkreten Analyse der geschlechtsspezifischen Kommunikationsmerkmale und der daraus resultierenden Konflikte.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Grundlagen der Kommunikation nach Schulz von Thun (inkl. der vier Seiten einer Nachricht), Konversationsmaximen nach Grice, geschlechtsspezifische Kommunikationsmerkmale, Konfliktfelder der Geschlechterkommunikation am Beispiel von Loriots "Garderobe", Zusammenfassung und Literaturverzeichnis.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Komplexität der Kommunikation und die Entstehung von Missverständnissen, insbesondere im Kontext der geschlechtsspezifischen Kommunikation, zu untersuchen und zu analysieren, wie unterschiedliche kommunikative Praktiken zu Konflikten führen können.
Welche konkreten Themen werden in den einzelnen Kapiteln behandelt?
Die Einleitung führt in das Thema ein und formuliert die Forschungsfrage. Kapitel 2 erläutert das Modell der vier Seiten einer Nachricht. Kapitel 3 behandelt die Konversationsmaximen. Kapitel 4 analysiert geschlechtsspezifische Kommunikationsmerkmale. Kapitel 5 analysiert Konfliktpotenziale in Loriots "Garderobe". Kapitel 6 fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche methodischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit nutzt einen analytischen Ansatz, basierend auf den Kommunikationstheorien von Schulz von Thun und Grice, um den Dialog aus Loriots "Garderobe" zu analysieren und die geschlechtsspezifische Kommunikation zu untersuchen.
- Quote paper
- Florian Leiffheidt (Author), 2012, Sprache und Konflikt am Beispiel von Loriots „Garderobe“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/194493