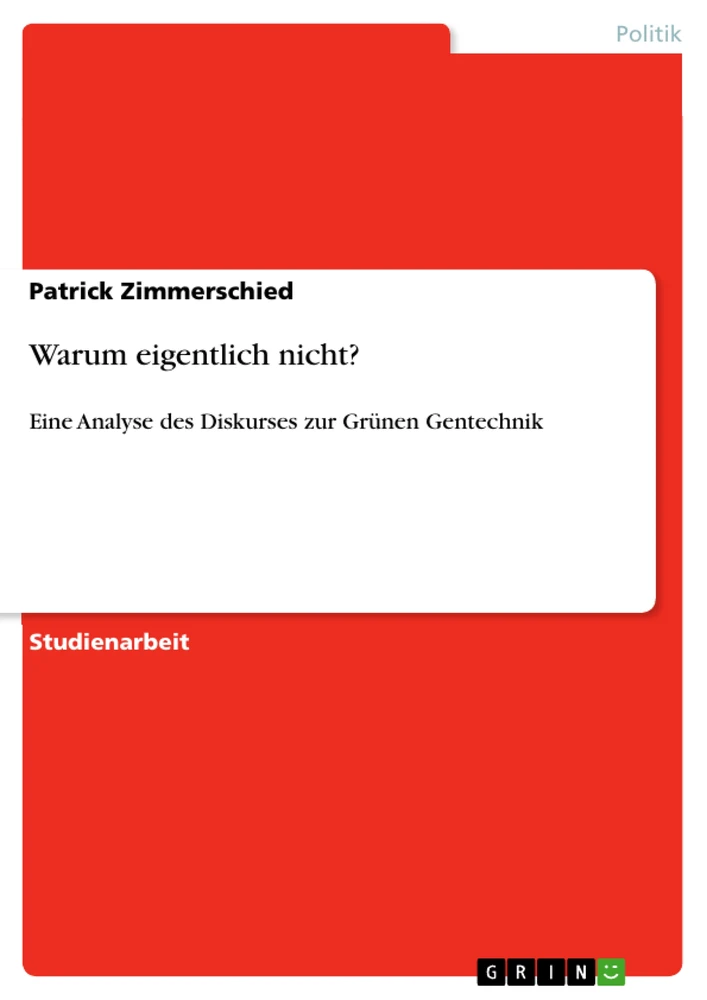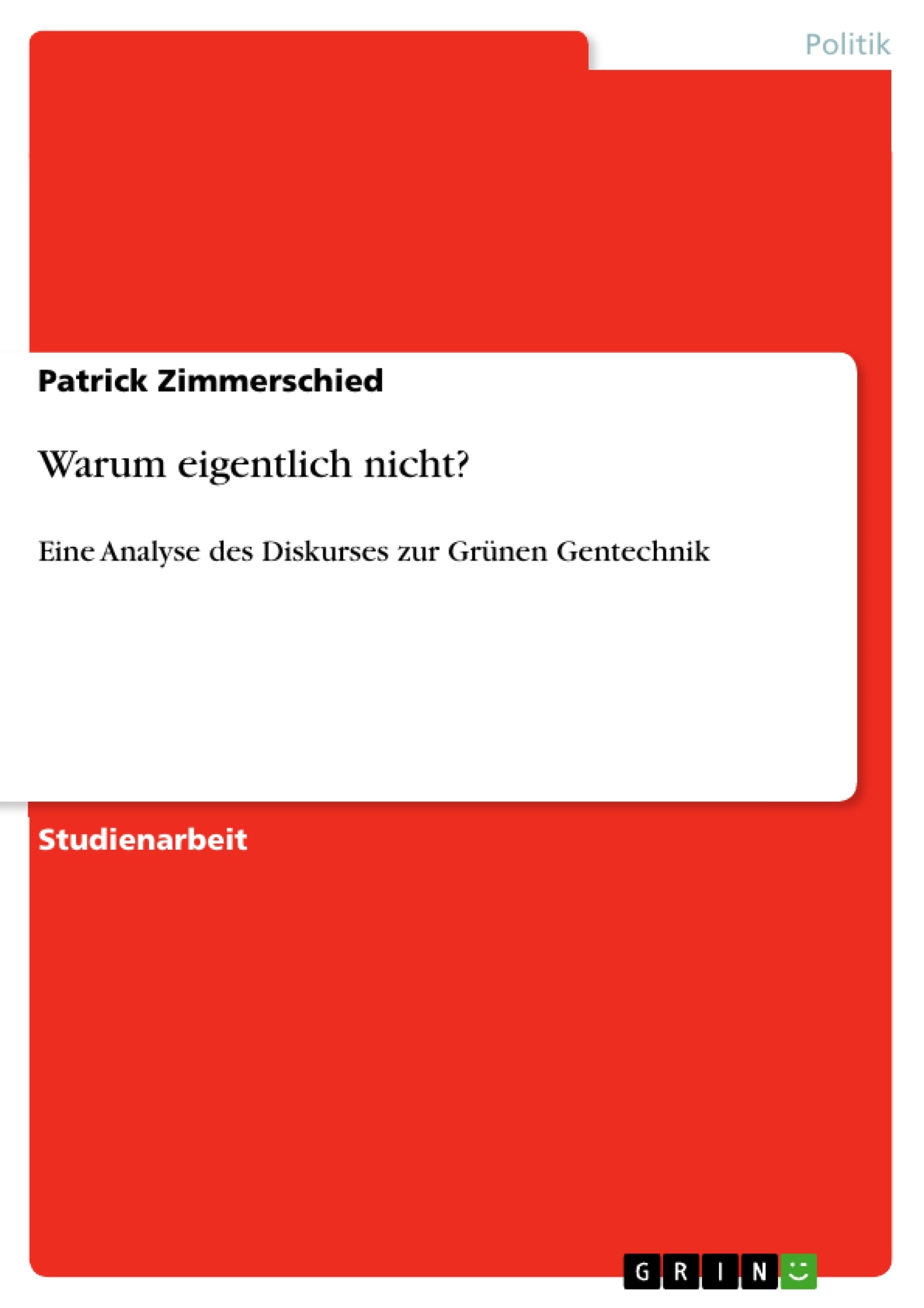In dieser Arbeit möchte ich eine Diskursanalyse zum Thema der Grünen Gentechnik in Deutschland durchführen. Hierzu gebe ich im ersten Kapitel einen Überblick über das Verhältnis der Öffentlichkeit zur Gentechnik im Allgemeinen. Wobei ich mich auf die Probleme des Risikos konzentriere und ethische Fragestellungen im engeren Sinne, die spezieller im Bereich der Roten Gentechnik aufgeworfen werden, nur am Rande berücksichtige.
Anschließend analysiere ich insgesamt 40 Interviews mit Wissenschaftlern, Aktivisten, Politikern und Unternehmern zum Thema Grüne Gentechnik. Hierbei betrachte ich die Handlungsfäden, das Policy-Vokabular und die epistemische Grundeinstellung. Außerdem vergleiche ich sowohl die vier genannten Akteursgruppen, als auch die zwei Gruppen von Befürwortern und Gegnern der Grünen Gentechnik, hinsichtlich Gemeinsamkeiten und Unterschieden in diesen Bereichen.
Im dritten Kapitel untersuche ich eine schriftliche Debatte zur Grünen Gentechnik zwischen einem Runden Tisch des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und Vertretern des Deutschen Naturschutzrings (DNR), des Bundes Ökologischer Lebensmittelwirtschaft (BÖLW), des Naturschutzbundes Deutschland (NABU), des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler (VDW) und Greenpeace.
Ich analysiere die drei Texte, die diesen Dialog dokumentieren, darauf, ob die Ergebnisse aus den Interviews hier bestätigt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Dissens - Mensch oder Natur?
- Interviews
- Runder Tisch Pflanzengenetik
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Diskurs zur Grünen Gentechnik in Deutschland. Die Analyse fokussiert auf die öffentliche Wahrnehmung und die ethischen Herausforderungen im Kontext der Gentechnik. Dabei werden insbesondere die Risikofaktoren und die ethischen Implikationen der Grünen Gentechnik, im Gegensatz zu den eher medizinischen Aspekten der Roten Gentechnik, beleuchtet.
- Öffentliches Misstrauen gegenüber der Gentechnik und die Rolle von Risiko und Vertrauen in der Debatte
- Die Rolle von Experten und Wissenschaftlern im Diskurs und die Frage nach ihrer Einflussnahme auf die öffentliche Meinung
- Ethische Dimensionen der Gentechnik und die Frage nach der Integrität der Natur
- Analyse von Interviews mit verschiedenen Akteuren (Wissenschaftler, Aktivisten, Politiker, Unternehmer) zur Grünen Gentechnik
- Untersuchung einer schriftlichen Debatte über Grüne Gentechnik zwischen einem Runden Tisch des Bundesministeriums und Umweltverbänden
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Forschungsfrage und den Forschungsrahmen des Projekts vor. Der Fokus liegt auf der Analyse des Diskurses zur Grünen Gentechnik in Deutschland, wobei die öffentliche Wahrnehmung und die ethischen Herausforderungen im Kontext der Gentechnik im Vordergrund stehen.
- Der Dissens - Mensch oder Natur?: Dieses Kapitel beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven auf die Gentechnik. Es wird die Frage nach dem Verhältnis von Mensch und Natur im Kontext der Gentechnik diskutiert und die ethischen Dilemmata, die sich aus der Eingriffsmöglichkeit des Menschen in die Natur ergeben, werden beleuchtet.
- Interviews: Dieses Kapitel analysiert Interviews mit verschiedenen Akteuren (Wissenschaftler, Aktivisten, Politiker, Unternehmer) zur Grünen Gentechnik. Der Fokus liegt auf der Analyse ihrer Handlungsfäden, ihres Policy-Vokabulars und ihrer epistemischen Grundeinstellung. Außerdem werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Akteursgruppen und zwischen Befürwortern und Gegnern der Grünen Gentechnik herausgearbeitet.
Schlüsselwörter
Grüne Gentechnik, Diskursanalyse, Risikowahrnehmung, ethische Aspekte, öffentliche Meinung, Expertenmeinung, Vertrauen, Natur, Umwelt, Politik, Wissenschaft, Akteursgruppen, Befürworter, Gegner, Policy-Vokabular, epistemische Grundeinstellung
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema dieser Diskursanalyse?
Die Arbeit analysiert den öffentlichen und fachlichen Diskurs zur Grünen Gentechnik in Deutschland, wobei ethische Fragen und Risikowahrnehmungen im Fokus stehen.
Welche Akteursgruppen wurden für die Analyse interviewt?
Es wurden insgesamt 40 Interviews mit Wissenschaftlern, Aktivisten, Politikern und Unternehmern ausgewertet.
Worin besteht der zentrale Dissens in der Gentechnik-Debatte?
Der Hauptkonflikt dreht sich um das Verhältnis von Mensch und Natur sowie um die ethische Vertretbarkeit von Eingriffen in die genetische Integrität von Pflanzen.
Welche Rolle spielen Umweltverbände in diesem Diskurs?
Verbände wie Greenpeace, BUND und NABU beteiligten sich an schriftlichen Debatten mit dem Bundesministerium, um ihre Kritik an der Grünen Gentechnik zu untermauern.
Was wird unter dem Begriff „Policy-Vokabular“ verstanden?
Es bezeichnet die spezifische Fachsprache und Argumentationsmuster, die verschiedene Akteursgruppen nutzen, um ihre Positionen politisch durchzusetzen.
- Quote paper
- Patrick Zimmerschied (Author), 2012, Warum eigentlich nicht?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/194553