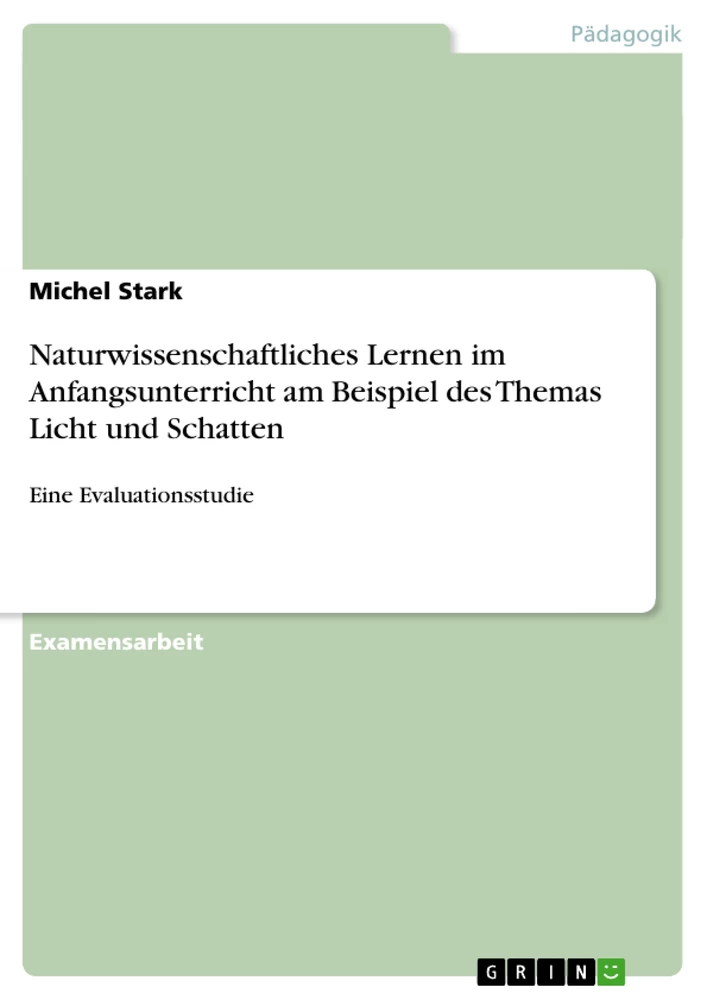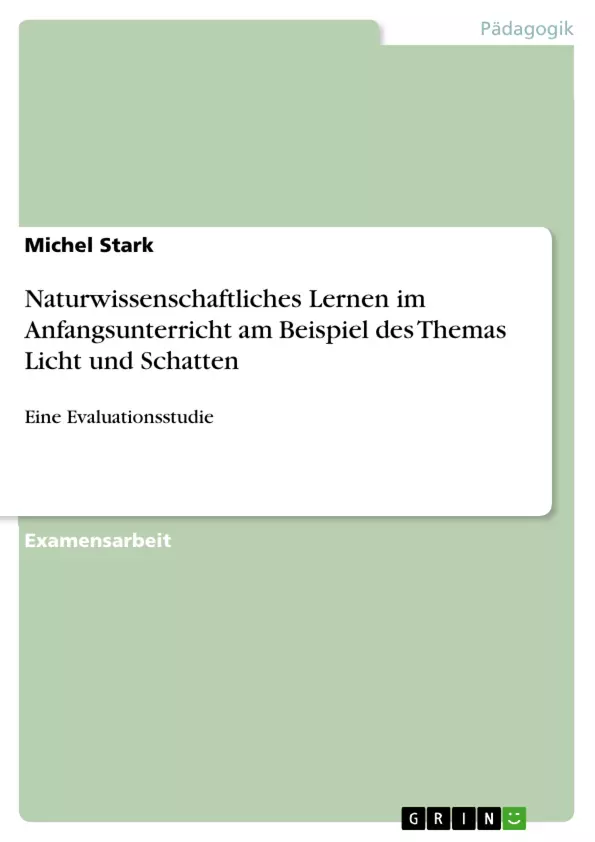1. Einleitung
“Wenn es regnet, ist der Schatten nicht da: Er geht in uns rein, um nicht nass zu werden.“ (REGGIO CHILDREN 2002, S. 30).
Kindliche Aussagen, wie die dieses etwa dreijährigen Kindes, lassen Erwachsene schmunzeln. Doch die komplexen Denkprozesse und -leistungen, die im Inneren des Kindes ablaufen, damit es zu einer solchen Erkenntnis kommen kann, bleiben dabei meist verborgen. Wie gelangt ein Kind von seiner individuellen Wahrnehmung zu solch einer Erklärung für das Verschwinden des Schattens? Inwiefern ist die Erklä-rung vom Kind bewusst gesteuert oder unbewusst? Eine Antwort darauf zu finden, wird ein Inhalt dieser Arbeit sein.
Das kindliche Denken hat schon lange eine besondere Faszination auf mich ausge-übt. Im Gegensatz zu dem besonders von Wissen und Erfahrungen geleiteten Er-kenntnisprozessen der Erwachsenen, sind Kinder in ihrem Denken viel weniger durch vermitteltes und erworbenes Wissen eingeengt und können daher zu erstaunli-chen und sehr kreativen Lösungsansätzen, Erkenntnissen oder Erklärungen gelangen. Gerade das Kleinkindalter ist von den kindlichen Bemühungen geprägt, die Welt um sich herum verstehen und erschließen zu wollen. Diese sensible Phase, die HARTMUT HACKER auch als „offene Zeitfenster“ bezeichnet (vgl. HACKER 2008, S.58) kann also einen besonderen Einblick in das kindliche Denken geben. Gleichzeitig existie-ren in dieser Zeitspanne auch weitreichende Möglichkeiten, das Interesse und die Motivation der Kinder für Lernsituationen aufzugreifen und zu fördern. Insbesondere naturwissenschaftliche Experimente sollen die Möglichkeit für neue Erfahrungen bieten, da Kinder schon sehr früh einen intuitiven Zugang zu den Naturphänomenen entwickeln (vgl. LÜCK 2008, S. 179). Deshalb werde ich in der vorliegenden Arbeit eine vorgegebene Lernepoche mit naturwissenschaftlichen Experimenten erproben und dabei die Möglichkeit nutzen, das kindliche Denken genauer zu analysieren.
Bereits im 19. Jahrhundert forderte FRIEDRICH FRÖBEL in seiner Konzeption des Kindergartens eine spielerische Begegnung der Kinder mit der Natur (vgl. BERGER 2000, S. 18). Auch in der DDR war das naturwissenschaftliche Lernen ein fester Be-standteil des Elementarbereichs. Doch erst seit Beginn des 21. Jahrhunderts wurde das naturwissenschaftliche Lernen auch in der Elementarpädagogik empirisch er-forscht. Einen wesentlichen Beitrag dazu hat GISELA LÜCK geleistet. LÜCK hat in ihren Untersuchungen unter anderem festgestellt, dass auch Klein- und Vorschulkinder
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Kognitive Lernvoraussetzungen von Kindern für das naturwissenschaftliche Lernen
- 2.1 Der Prozess der Begriffsbildung nach Lev Semenovič Vygotskij
- 2.1.1 Die Phase des Synkretismus
- 2.1.2 Die Phase der Komplexbildung
- 2.1.3 Die Phase des begrifflichen Denkens
- 2.2 Wissenschaftliche Begriffe und Alltagsbegriffe
- 2.3 Schlussfolgerungen aus Vygotskijs Theorie der Begriffsbildung für die Organisation von Lernprozessen
- 2.1 Der Prozess der Begriffsbildung nach Lev Semenovič Vygotskij
- 3. Evaluation der Lernepoche „Licht und Schatten“
- 3.1 Problemstellung und wissenschaftliche Fragen
- 3.2 Bedingungen der Untersuchung
- 3.2.1 Personale Bedingungen
- 3.2.1.1 Das Lernumfeld
- 3.2.1.2 Gruppenspezifische Bedingungen
- 3.2.2 Materielle Bedingungen
- 3.2.2.1 Der „Waldemarhof e. V.“
- 3.2.3 Zeitliche Bedingungen
- 3.2.1 Personale Bedingungen
- 3.3 Methoden der Datenerhebung und -Auswertung für die Evaluation der Lernepoche
- 3.4 Ergebnisse der Untersuchung
- 3.4.1 Durchführung der Lernepoche
- 3.4.1.1 Das Experiment „Licht und Schatten“
- 3.4.1.2 Das Experiment „Schattenspiele“
- 3.4.1.3 Das Experiment „Licht und Farben“
- 3.4.2 Ermittlung des Lernfortschritts anhand von Einzelinterviews
- 3.4.3 Probleme bei der Auswertung
- 3.4.1 Durchführung der Lernepoche
- 3.5 Möglichkeiten zur Optimierung des Lernmaterials
- 4. Entwicklungsstand des begrifflichen Denkens
- 5. Reflexion des Arbeitsprozesses
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit evaluiert eine Lernepoche zum Thema Licht und Schatten im Elementarbereich und untersucht die kognitiven Lernvoraussetzungen von Kindern für naturwissenschaftliches Lernen. Die Studie analysiert den Lernprozess anhand von Experimenten und Interviews, um den Entwicklungsstand des begrifflichen Denkens der Kinder zu erfassen und das Lernmaterial zu optimieren.
- Kognitive Lernvoraussetzungen von Kindern im naturwissenschaftlichen Unterricht
- Anwendung der Theorie der Begriffsbildung nach Vygotskij
- Evaluation einer Lernepoche zum Thema Licht und Schatten
- Analyse des Lernfortschritts anhand von qualitativen Methoden
- Optimierungsmöglichkeiten des Lernmaterials
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Motivation der Autorin, das kindliche Denken im Kontext naturwissenschaftlichen Lernens zu erforschen, gehend von einer kindlichen Aussage über Schatten. Sie verweist auf die Bedeutung des frühen Kindesalters als „offenes Zeitfenster“ für den Zugang zu Naturphänomenen und erwähnt die historische und aktuelle Bedeutung naturwissenschaftlichen Lernens im Elementarbereich. Die Autorin kündigt die Evaluation einer Lernepoche zum Thema Licht und Schatten an.
2. Kognitive Lernvoraussetzungen von Kindern für das naturwissenschaftliche Lernen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es beschreibt Vygotskijs Theorie der Begriffsbildung mit ihren Phasen (Synkretismus, Komplexbildung, begriffliches Denken) und deren Relevanz für die Gestaltung von Lernprozessen im Elementarbereich. Der Unterschied zwischen wissenschaftlichen und Alltagsbegriffen wird erläutert, um die Herausforderungen des naturwissenschaftlichen Lernens im frühen Kindesalter zu verdeutlichen. Das Kapitel liefert somit das theoretische Fundament für die anschließende Evaluation.
3. Evaluation der Lernepoche „Licht und Schatten“: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik und die Ergebnisse der Evaluation einer Lernepoche zum Thema Licht und Schatten. Es werden die methodischen Bedingungen der Untersuchung (personale, materielle, zeitliche) detailliert dargestellt, gefolgt von einer Erläuterung der Methoden der Datenerhebung (Einzelinterviews, Gedächtnisprotokolle) und -auswertung. Die Ergebnisse werden in Bezug auf den Lernfortschritt der Kinder in verschiedenen Aspekten des Themas (Entstehung von Licht und Schatten, Farben des Lichts, Bedeutung des Lichts) präsentiert. Schließlich werden Probleme bei der Auswertung und Möglichkeiten zur Optimierung des Lernmaterials diskutiert.
4. Entwicklungsstand des begrifflichen Denkens: Dieses Kapitel präsentiert eine Analyse des Entwicklungsstandes des begrifflichen Denkens der Kinder auf Basis der in Kapitel 3 gewonnenen Daten. Die Ergebnisse ermöglichen eine Einschätzung des Lernfortschritts und zeigen, wie sich das Verständnis der Kinder für die Konzepte von Licht und Schatten im Laufe der Lernepoche entwickelt hat. Dieser Abschnitt liefert die wesentlichen Ergebnisse der Studie bezüglich der kognitiven Entwicklung der Kinder.
Schlüsselwörter
Naturwissenschaftliches Lernen, Elementarpädagogik, Licht und Schatten, Begriffsbildung, Vygotskij, Evaluation, qualitative Forschung, Lernprozess, Kindliches Denken, Experiment, Interview.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Evaluation einer Lernepoche "Licht und Schatten"
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit evaluiert eine Lernepoche zum Thema "Licht und Schatten" im Elementarbereich und untersucht die kognitiven Lernvoraussetzungen von Kindern für naturwissenschaftliches Lernen. Sie analysiert den Lernprozess anhand von Experimenten und Interviews, um den Entwicklungsstand des begrifflichen Denkens der Kinder zu erfassen und das Lernmaterial zu optimieren.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf Vygotskijs Theorie der Begriffsbildung. Es werden die drei Phasen des Begriffsbildungsprozesses (Synkretismus, Komplexbildung, begriffliches Denken) beschrieben und ihre Relevanz für die Gestaltung von Lernprozessen im Elementarbereich erläutert. Der Unterschied zwischen wissenschaftlichen und Alltagsbegriffen wird ebenfalls thematisiert.
Wie wurde die Lernepoche "Licht und Schatten" evaluiert?
Die Evaluation umfasste die detaillierte Beschreibung der methodischen Bedingungen (personale, materielle, zeitliche). Es wurden qualitative Methoden wie Einzelinterviews und Gedächtnisprotokolle eingesetzt. Die Ergebnisse wurden in Bezug auf den Lernfortschritt der Kinder in verschiedenen Aspekten des Themas (Entstehung von Licht und Schatten, Farben des Lichts, Bedeutung des Lichts) präsentiert. Probleme bei der Auswertung und Optimierungsmöglichkeiten des Lernmaterials wurden diskutiert.
Welche Experimente wurden im Rahmen der Lernepoche durchgeführt?
Die Lernepoche beinhaltete die Experimente "Licht und Schatten", "Schattenspiele" und "Licht und Farben". Diese Experimente dienten der praktischen Auseinandersetzung der Kinder mit dem Thema.
Welche Methoden der Datenerhebung und -auswertung wurden angewendet?
Die Datenerhebung erfolgte hauptsächlich durch Einzelinterviews. Die Auswertung der Daten konzentrierte sich auf die Analyse des Lernfortschritts der Kinder und die Identifizierung von Herausforderungen und Optimierungspotenzialen im Lernmaterial.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Ergebnisse der Studie zeigen den Entwicklungsstand des begrifflichen Denkens der Kinder im Kontext des Themas "Licht und Schatten". Es wird analysiert, wie sich das Verständnis der Kinder im Laufe der Lernepoche entwickelt hat. Die Ergebnisse liefern wichtige Erkenntnisse für die Optimierung des Lernmaterials und die Gestaltung naturwissenschaftlichen Unterrichts im Elementarbereich.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Naturwissenschaftliches Lernen, Elementarpädagogik, Licht und Schatten, Begriffsbildung, Vygotskij, Evaluation, qualitative Forschung, Lernprozess, Kindliches Denken, Experiment, Interview.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Kognitive Lernvoraussetzungen von Kindern für das naturwissenschaftliche Lernen, Evaluation der Lernepoche "Licht und Schatten", Entwicklungsstand des begrifflichen Denkens und Reflexion des Arbeitsprozesses. Jedes Kapitel wird durch eine Zusammenfassung im HTML-Dokument erläutert.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die kognitiven Lernvoraussetzungen von Kindern für naturwissenschaftliches Lernen zu untersuchen und eine Lernepoche zum Thema "Licht und Schatten" zu evaluieren. Ziel ist es, den Lernprozess zu analysieren, den Entwicklungsstand des begrifflichen Denkens zu erfassen und das Lernmaterial zu optimieren.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Lehrende im Elementarbereich, Pädagogen, Wissenschaftler im Bereich der Elementarpädagogik und alle, die sich für naturwissenschaftliches Lernen im frühen Kindesalter interessieren.
- Quote paper
- Michel Stark (Author), 2011, Naturwissenschaftliches Lernen im Anfangsunterricht am Beispiel des Themas Licht und Schatten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/194556