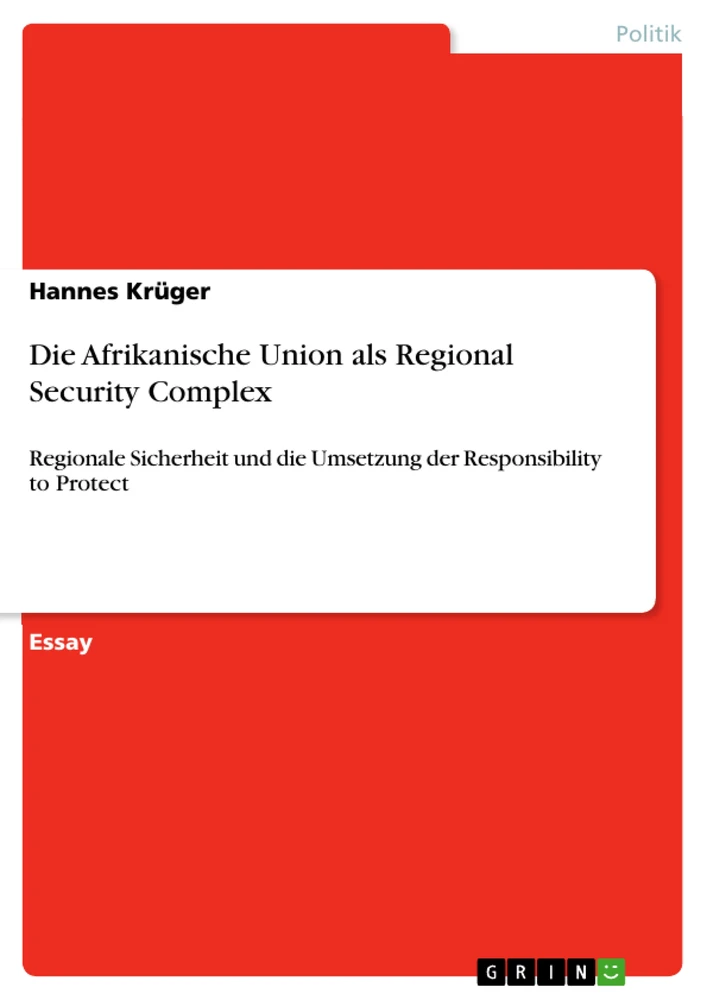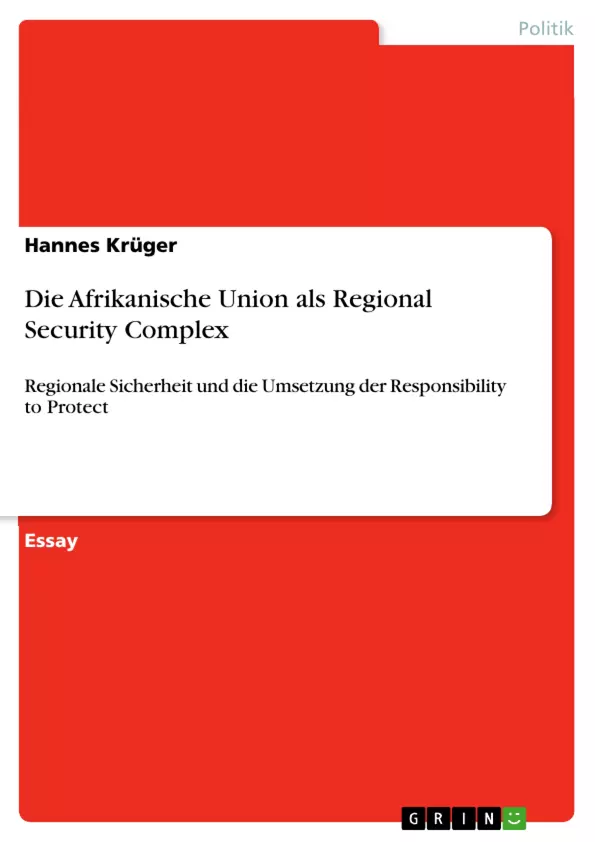In dieser Arbeit wird die "Regional Security Complex Theorie" (RSCT)von Buzan und Wæver auf die Afrikanische Union angewendet. Im Zuge der zunehmenden Globalisierung und vor dem Hintergrund des beendeten Kalten Krieges findet eine zunehmende Regionalisierung statt, durch welche sich unterschiedliche Staaten zu regionalen Gruppierungen zusammenschließen.
Der Argumentation der RSCT folgend, werden dabei auch die Sicherheitspolitiken der einzelnen Statten innerhalb eines solchen regionalen Komplexes zusammengefügt, wobei sich dies nicht nur auf die politisch-militärischen Themen beschränkt, sondern mittels dem Prozess der "Versicherheitlichung" auf all anderen Lebensbereiche auswirkt.
Konkret wird in dieser Arbeit untersucht, ob die Afrikanische Union sich inzwischen durch die Umsetzung ihrer kontinentweiten Afrikanischen Friedens- und Sicherheitsarchitektur (AFSA) zu einem RSC entwickelt hat. Dies wird anhand der Umsetzung und Institutionalisierung der internationalen Norm der Responsibility to Protect (RtP) analysiert. Dabei wird die Theorie ebenso vorgestellt wie die konkrete Zusammensetzung der AFSA auf kontinentaler wie auch auf regionaler Ebene in den unterschiedlichen sub-regionalen Organisationen (ECOWAS, IGAD, SADC, ECCAS).
Dabei kommt heraus, dass sich die Mitgliedsstaaten der Afrikanische Union zwar sicherheitspolitisch zunehmend eng verknüpft haben und auch die Norm der RtP, zumindest in legaler Hinsicht, etabliert ist. Allerdings ist die praktische Umsetzung noch nicht ausgereift genug und die Abhängigkeit von nicht-afrikanischem Kapital sowie die noch immer zahlreichen gewaltsamen Konflikte auf diesem Kontinent bedingen die Schlussfolgerung, dass es sich bei der Afrikanischen Union bisher lediglich um einen institutionalisierten Proto-Complex handelt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Regional Security Complex Theorie
- Das Sicherheitsverständnis der Regional Security Complex Theorie und die Responsibility to Protect
- Die Responsibility to Protect als Regime in einem Regional Security Complex
- Die Afrikanische Union als Regional Security Complex
- Die Sub-Regionalorganisationen der Afrikanischen Union als Sub-Complexe und tragende Säulen der afrikanischen Friedens- und Sicherheitspolitik
- Einschränkungen der Anwendbarkeit der Theorie
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Ausarbeitung untersucht die Möglichkeiten der Afrikanischen Union (AU) bezüglich ihrer Kapazitäten und Potenziale zur Eindämmung regionaler Konflikte. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob sich die AU mittels der die Region umfassenden Friedens- und Sicherheitsarchitektur (AFSA) zu einem Regional Security Complex (RSC) entwickelt. Die Arbeit konzentriert sich dabei auf das Regime der Responsibility to Protect (R2P) und deren Umsetzung in der Afrikanischen Union. Die These lautet, dass die AU ein institutionalisierter Proto-Complex ist, der zur Umsetzung der R2P ein den Kontinent überspannendes Institutionsgefüge etabliert hat, durch welches alle afrikanischen Staaten eine gemeinsame Sicherheitsregion bilden.
- Die Regional Security Complex Theory von Buzan und Wæver
- Das Sicherheitsverständnis eines Regional Security Complex und dessen Anwendbarkeit auf die R2P
- Die Afrikanische Union als ein RSC unter besonderer Berücksichtigung der R2P
- Die Rolle der Sub-Regionalorganisationen innerhalb der AU als Sub-Complexe
- Einschränkungen und Kritikpunkte bei der Anwendung der RSC Theorie auf die AU
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Einleitung stellt die These der Arbeit vor und skizziert die Problematik des sich verändernden internationalen Systems nach dem Ende des Kalten Krieges. Die Globalisierung und die damit einhergehende Bildung regionaler Organisationen und Zusammenschlüsse im Sinne eines neuen Regionalismus, werden als Hintergrund für die Untersuchung der AU als potenziellen RSC dargestellt.
- Kapitel 2: Das zweite Kapitel beleuchtet den theoretischen Kontext und erläutert die Grundannahmen der Regional Security Complex Theorie von Buzan und Wæver.
- Kapitel 3: Dieses Kapitel beschreibt das Sicherheitsverständnis, das einem Regional Security Complex zugrunde liegt, und untersucht die Anwendbarkeit dieser Prinzipien auf die Responsibility to Protect.
- Kapitel 4: Im Fokus dieses Kapitels stehen die Strukturen der AFSA, welche die AU als ein RSC ausweisen, insbesondere unter Berücksichtigung der R2P. Es werden die Regional Economic Communities (REC) als zentrale Sub-Complexe innerhalb der AU betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen der Regional Security Complex Theory, der Responsibility to Protect, der Afrikanischen Union, der Friedens- und Sicherheitsarchitektur (AFSA), der Sub-Regionalorganisationen und dem Konzept des Proto-Complex. Sie analysiert die Implementierung der R2P in einem regionalen Kontext, insbesondere in Afrika, und beleuchtet die Herausforderungen und Chancen der AU als ein potenzieller Regional Security Complex.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die zentrale These bezüglich der Afrikanischen Union (AU) in dieser Arbeit?
Die These lautet, dass die AU bisher ein institutionalisierter "Proto-Complex" ist, der eine kontinentweite Friedens- und Sicherheitsarchitektur zur Umsetzung der Responsibility to Protect (R2P) etabliert hat.
Was bedeutet "Responsibility to Protect" (RtP/R2P) im Kontext der AU?
Es handelt sich um eine internationale Norm zum Schutz der Bevölkerung vor Massenverbrechen, die die AU rechtlich in ihrem Institutionsgefüge verankert hat.
Welche Rolle spielen Organisationen wie ECOWAS oder SADC innerhalb der AU?
Diese Sub-Regionalorganisationen fungieren als "Sub-Complexe" und bilden die tragenden Säulen der afrikanischen Friedens- und Sicherheitspolitik.
Warum wird die AU nur als "Proto-Complex" und nicht als voller Sicherheitskomplex eingestuft?
Gründe hierfür sind die noch mangelhafte praktische Umsetzung der Normen, die Abhängigkeit von ausländischem Kapital und die Vielzahl anhaltender gewaltsamer Konflikte.
Welche Theorie dient als Grundlage für die Untersuchung der AU?
Die Arbeit nutzt die "Regional Security Complex Theorie" (RSCT) von Buzan und Wæver.
- Arbeit zitieren
- Hannes Krüger (Autor:in), 2011, Die Afrikanische Union als Regional Security Complex, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/194583