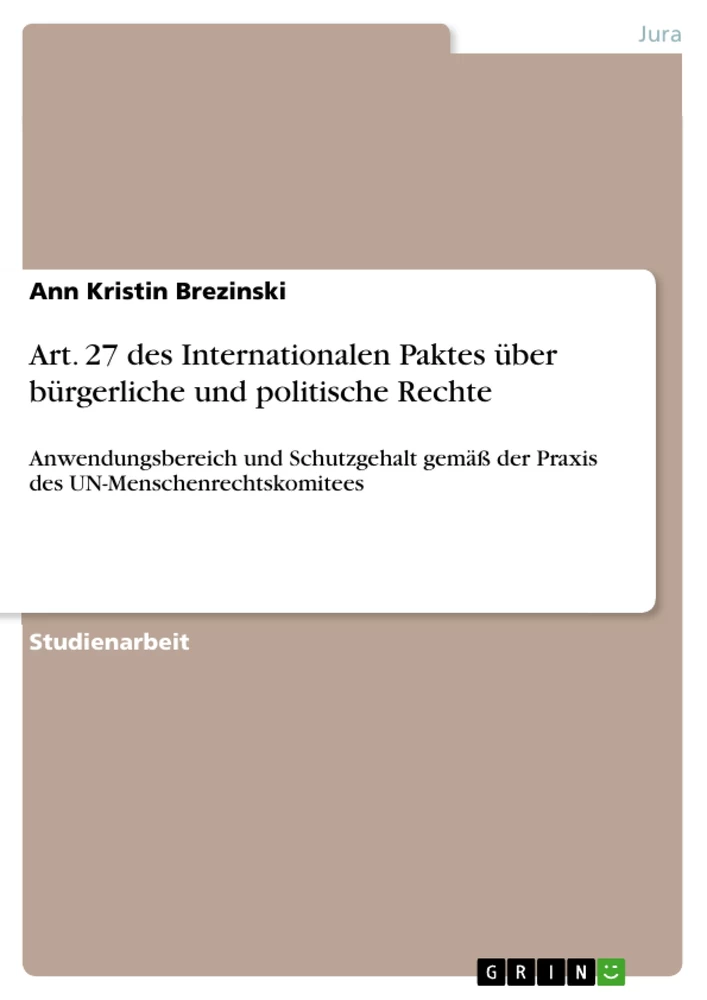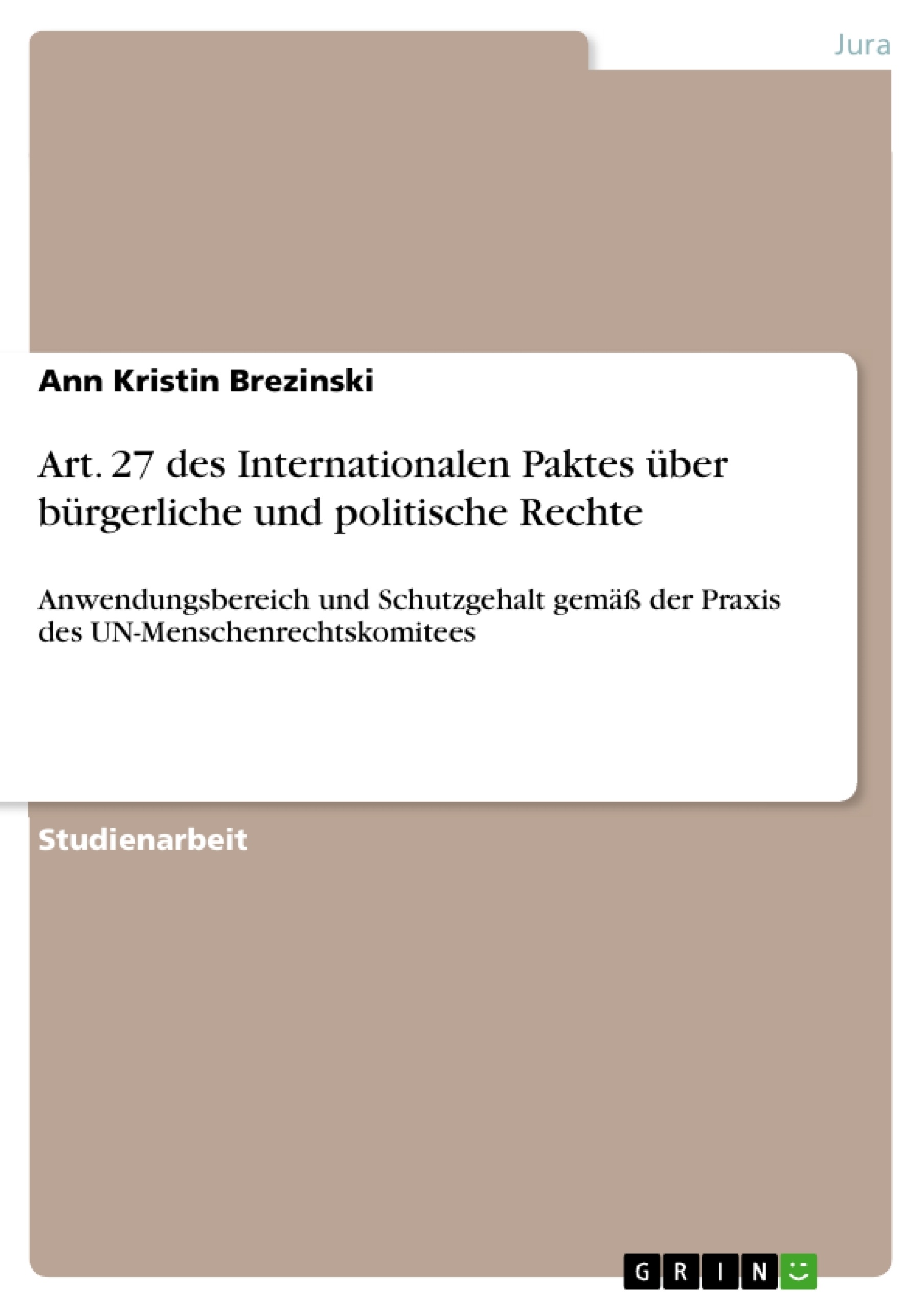Gegenwärtig gibt es auf der Welt 193 vollständig von den Vereinten Nationen anerkannte souveräne Staaten. In fast jedem dieser Staaten leben Menschen, die sich durch ihre ethnische, sprachliche oder religiöse Identität von der Mehrheit der Bevölkerung unterscheiden. Das Staatsvolk, im Sinne der „Gesamtheit der Personen, die durch Staatsangehörigkeit einem Staate zugehören“ , ist in den wenigsten Staaten deckungsgleich mit einer Nation im Sinne einer sozialen Gruppe, die sich aufgrund kollektiver Handlungsfähigkeit, vielfältiger, historisch gewachsener Beziehungen sprachlicher, kultu-reller, religiöser oder politischer Art ihrer Zusammengehörigkeit und besonderer Interessen bewusst ist. Die meisten Staaten umfassen somit Bevölkerungsgruppen, deren nationale Identität von der der Mehrheitsbevölkerung abweicht.
Gewalt gegen diese Personen hat seit dem Zweiten Weltkrieg mehr als 10 Millionen Menschenleben gekostet. Friedliche Beziehungen zwischen Minderheiten und zwischen Minderheit und Mehrheit auf der Grundlage gegenseitigen Respekts bedeuten eine Anerkennung der Würde und Gleichheit der Menschen, auf der die Charta der Vereinten Nationen gegründet ist.
Die Vereinten Nationen haben sich lange schwer getan eine Regelung zum Schutz von Minderheiten zu erlassen. Die bisher konkreteste Grundlage zum Thema Minderheitenschutz findet sich in Art. 27 des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte. Fraglich ist wie weit dieser Artikel reicht und inwiefern er durchgesetzt wird und ob ein ausreichender Minderheitenschutz auf internationaler Ebene tatsächlich existiert.
Diese Fragen und solche nach den Ursachen für die langsame Entwicklung des internationalen Minderheitenschutzes versucht die vorliegende Arbeit zu ergründen, beginnend mit der historischen Entwicklung des Minderheiten-schutzes, der Suche nach einer Definition des Minderheitenbegriffs, sowie der Entstehung und Natur des internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte. Im Anschluss daran werden die Anwendung und die Durchsetzung des Art. 27 IPbpR überprüft, wobei es weniger darum gehen soll die genauen Gegebenheiten in den einzelnen Vertragsstaaten aufzuzählen, sondern einen globalen Überblick über den Minderheitenschutz der Vereinten Nationen zu verschaffen.
Inhaltsverzeichnis
A. Einleitung
B. Minderheitenschutz
I. Historische Entwicklung des Minderheitenschutz
II. Der Minderheitenbegriff
1. Definition
2. Religiose Minderheiten
3. Sprachliche Minderheiten
4. Ethnische Minderheiten
5. Indigene Volker
III. Minderheitenschutz durch Menschenrechtsschutz
IV. Der Internationale Pakt uber burgerliche und politische Rechte und das
Fakultativprotokoll
V. Anwendungsbereich und Schutzgehalt des Art. 27 IPbpR
1. Staatsangehorigkeit
2. Rechtspflichten aus Art. 27 IPburg
a) Art. 27 IPburg als Abwehrrecht („respect“ und „protect“)
aa) Abwehrrecht gegenuber dem Staat
bb) Abwehrrecht gegenuber Privatpersonen
b) Art. 27 IPbpR als Leistungsrecht („fulfil“)
aa) Verpflichtung zur staatlichen Leistungspflicht
bb) Umfang der MaBnahmen zum Erhalt und zur Forderung der
Minderheitenkultur
3. Art. 27 IPbpR als Individual- oder Kollektivrecht
a) Anwendung
b) Kollision
VI. Durchsetzung des Art. 27 IPbpR in der Praxis des UN-
Menschenrechtskomitees
1. Staatenberichtsverfahren
2. Zwischenstaatliches Beschwerdeverfahren
3. Individualbeschwerdeverfahren
C. Fazit
Häufig gestellte Fragen
Was schützt Artikel 27 des IPbpR?
Artikel 27 schützt das Recht von Angehörigen ethnischer, religiöser oder sprachlicher Minderheiten, ihre eigene Kultur zu pflegen, ihre Religion auszuüben und ihre Sprache zu gebrauchen.
Wer gilt völkerrechtlich als „Minderheit“?
Obwohl eine universelle Definition schwierig ist, werden Gruppen mit eigener Identität, die numerisch unterlegen und nicht dominant sind, meist als Minderheiten anerkannt.
Ist Art. 27 ein Individual- oder ein Kollektivrecht?
Formal ist es ein Individualrecht („Personen, die ... angehören“), das jedoch in Gemeinschaft mit anderen Mitgliedern der Gruppe ausgeübt wird, was ihm eine kollektive Dimension verleiht.
Wie wird der Minderheitenschutz international durchgesetzt?
Die Durchsetzung erfolgt primär durch das UN-Menschenrechtskomitee mittels Staatenberichtsverfahren und Individualbeschwerdeverfahren.
Muss man Staatsangehöriger sein, um unter Art. 27 geschützt zu sein?
Nach moderner Auslegung des UN-Menschenrechtskomitees ist die Staatsangehörigkeit keine zwingende Voraussetzung; auch dauerhaft ansässige Personen können geschützt sein.
Was ist der Unterschied zwischen „respect“, „protect“ und „fulfil“?
Der Staat muss die Rechte achten (nicht stören), schützen (vor Eingriffen Dritter bewahren) und gewährleisten (Maßnahmen zur Förderung der Kultur ergreifen).
- Quote paper
- Ann Kristin Brezinski (Author), 2010, Art. 27 des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/194622