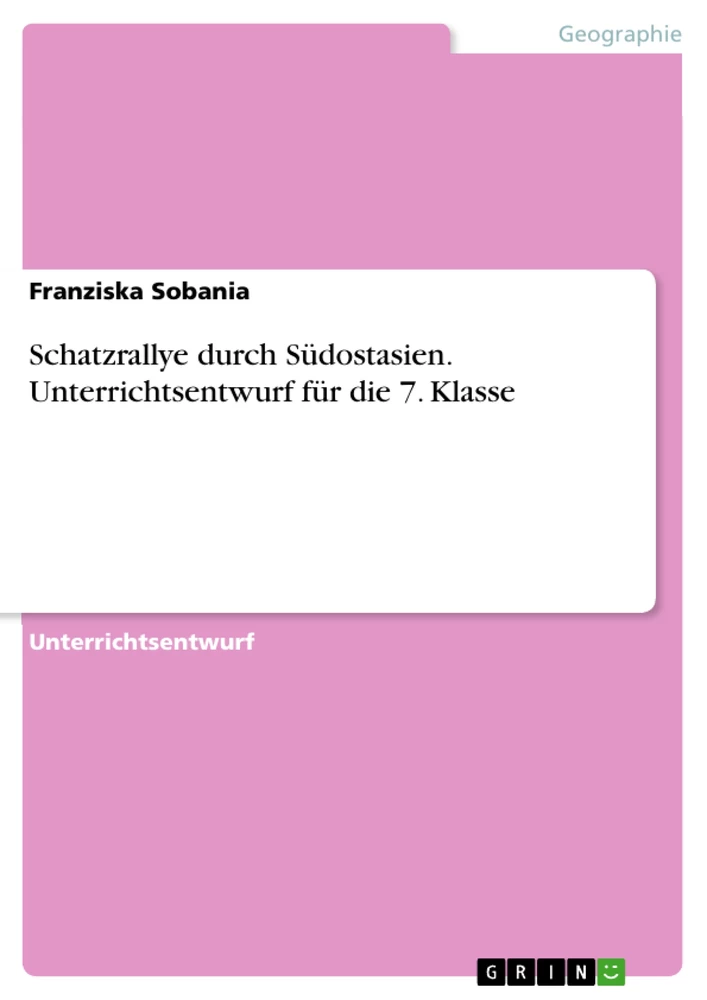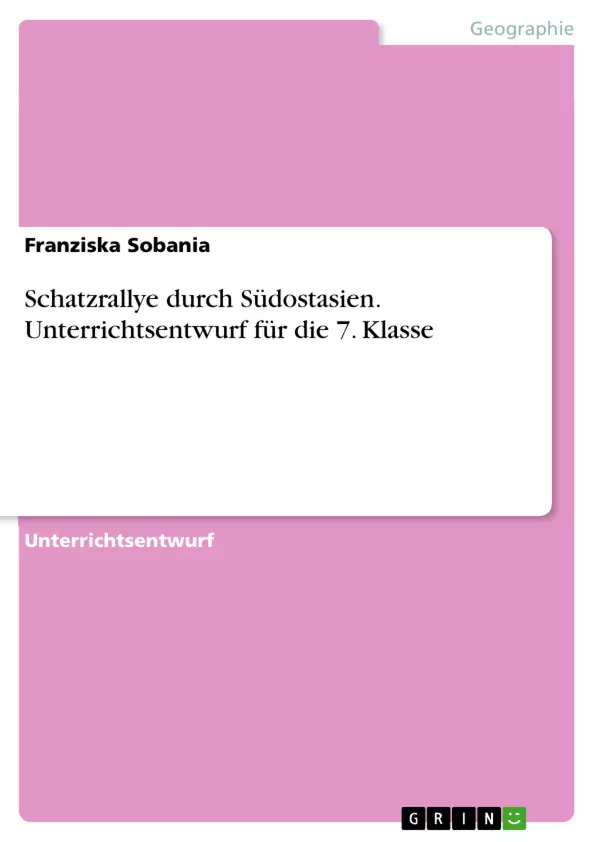Der Entwurf bietet eine didaktische und methodische Vorbereitung einer Gruppenarbeit zur Topographie Südostasiens für eine 7. Klasse.
Die Lernenden erwerben Kenntnisse über die naturräumliche Gliederung und Topographie des südostasiatischen Raums. In diesem Zusammenhang festigen sie den Umgang mit geographischen Arbeitstechniken, indem sie diese zunehmend selbstständig anwenden. Durch das Arbeiten im Team schulen sie die gemeinsame Planung und Umsetzung von Arbeitsaufträgen und fördern dadurch ihre Selbst- und Sozialkompetenz.
Inhaltsverzeichnis
1) Ziele der Stunde
1.1) Grobziel
1.2) Feinziele
2) Situation der Lerngruppe
2.1) Allgemeine Situation der Lerngruppe
2.1.1) Entwicklungs- und lernpsychologische Voraussetzungen
2.1.2) Sozial-kulturelle Voraussetzungen
2.1.3) Sozial-kommunikative Voraussetzungen
2.2) Äußere Lernbedingungen
2.3) Eigene Lehrsituation
3) Didaktische Überlegungen und methodisches Herangehen
3.1) Einordnung der geplanten Unterrichtssituation in die Stoffeinheit
3.2) Einbettung der geplanten Unterrichtssituation
3.3) Sach-Struktur-Diagramm
3.4) Sachanalyse
3.5) Didaktische Reduktion
3.6) Didaktische Überlegungen und methodische Entscheidungen
4) Geplanter Unterrichtsverlauf
5) Anhang (Auszüge)
5.1) Sitzplan der Agententeams
5.5) Zusatzaufgaben
Bibliographie
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Lernziel der "Schatzrallye durch Südostasien"?
Lernende sollen Kenntnisse über die Topographie und naturräumliche Gliederung Südostasiens erwerben und geographische Arbeitstechniken festigen.
Für welche Klassenstufe ist dieser Entwurf konzipiert?
Der Unterrichtsentwurf ist speziell für die 7. Klasse entwickelt worden.
Welche Sozialform wird im Unterricht angewendet?
Es wird vorwiegend in Gruppenarbeit (Agententeams) gearbeitet, um die Sozial- und Selbstkompetenz zu fördern.
Was beinhaltet die Sachanalyse des Entwurfs?
Die Sachanalyse bietet eine fachliche Aufarbeitung der geographischen Gegebenheiten Südostasiens als Grundlage für den Unterricht.
Welche methodischen Entscheidungen wurden getroffen?
Der Entwurf nutzt spielerische Elemente wie eine Rallye, um die Motivation zu steigern und die Topographie erlebbar zu machen.
- Quote paper
- Franziska Sobania (Author), 2012, Schatzrallye durch Südostasien. Unterrichtsentwurf für die 7. Klasse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/194692