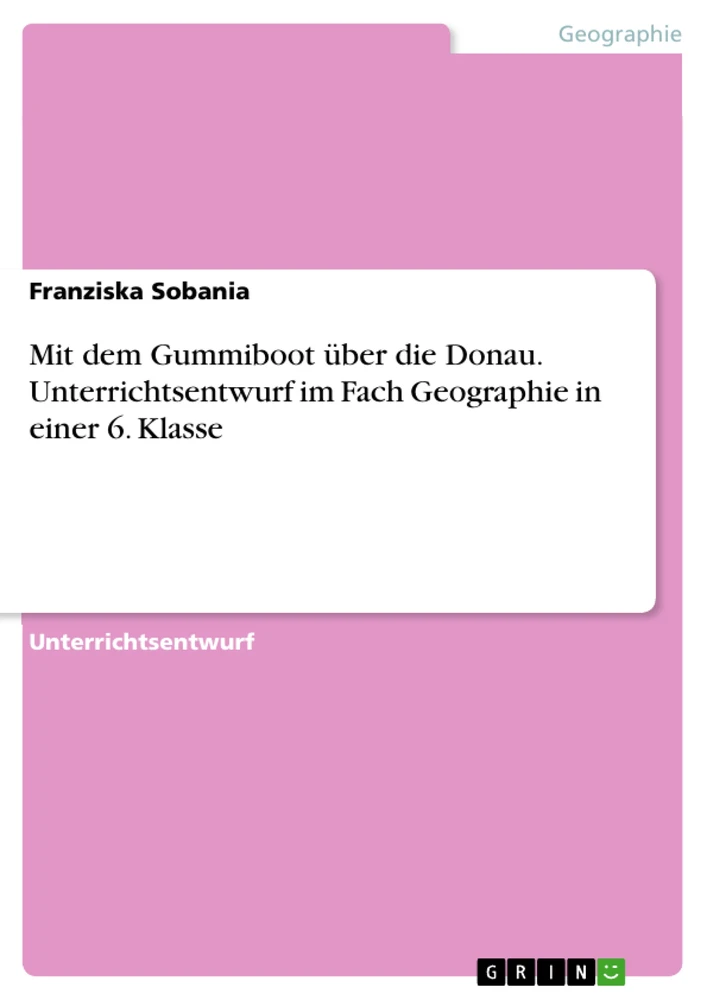Der Entwurf beinhaltet eine didaktische und methodische Planung einer Gruppenarbeit zur Thematik Donau, in der wirtschaftliche, topographische und vegetationsgeographische (Flora und Fauna) Aspekte näher beleuchtet werden. Die Stunde wurde in einer 6. Klasse umgesetzt.
Die Schüler gewinnen einen Überblick über Europa mit seinen wirtschafts- und sozialgeographischen Merkmalen sowie der physisch-geographischen Vielfalt. Diese werden verschiedenen Großregionen und Ländern zugeordnet, um daran deren spezifischen Charakter zu verdeutlichen. Die Lernenden setzen sich anhand ausgewählter Beispiele mit topographischen und wirtschaftlichen Faktoren näher auseinander. Dabei eignen sie sich verstärkt die Methodenkompetenz an, indem sie sich mithilfe von einfachen Texten und Karten informieren und einfache Schaubilder, Diagramme sowie Profile auswerten. Die Schüler gewinnen zunehmend Fertigkeiten, ihre Arbeitsergebnisse abwechslungsreich darzustellen.
Inhaltsverzeichnis
- 1) Ziele der Stunde
- 1.1) Grobziel
- 1.2) Feinziele
- 2) Situation der Lerngruppe
- 2.1) Allgemeine Situation der Lerngruppe
- 2.1.1) Entwicklungs- und lernpsychologische Voraussetzungen
- 2.1.2) Sozial-kulturelle Voraussetzungen
- 2.1.3) Sozial-kommunikative Voraussetzungen
- 2.2) Äußere Lernbedingungen
- 2.3) Eigene Lehrsituation
- 3) Didaktische Überlegungen und methodisches Herangehen
- 3.1) Einordnung der geplanten Unterrichtssituation in die Unterrichtseinheit
- 3.2) Einbettung der geplanten Unterrichtssituation
- 3.3) Sach-Struktur-Diagramm
- 3.4) Sachanalyse
- 3.5) Didaktische Reduktion
- 3.6) Didaktische Überlegungen und methodische Entscheidungen
- 4) Geplanter Unterrichtsentwurf
- 5) Anhang (Auszüge)
- 5.1) Sitzplan
- 5.2) Besondere Funktionen in der Gruppe
- 5.3) Material
- 5.3.1) Material der Infoexperten
- 5.3.2) Material der Länderexperten
- 5.3.3) Material der Landschaftsexperten
- 5.3.4) Material der Pflanzen- und Tierexperten
- 5.3.5) Material der Wirtschaftsexperten
- 5.4) Beobachtungsbogen
- Literatur- und Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser schriftliche Unterrichtsentwurf dient als Vorbereitung für die erste benotete Lehrprobe im Fach Geographie. Der Fokus liegt auf der Vermittlung von geographischen Kenntnissen zum Thema Donau und seinen angrenzenden Ländern. Die Stunde soll die Schüler befähigen, einen Überblick über Europa und seine geographischen Merkmale zu gewinnen, dabei die Donau als verbindendes Element zu betrachten und die Besonderheiten verschiedener Regionen entlang des Flusses zu analysieren.
- Gewinnung eines Überblicks über Europa und seine wirtschafts- und sozialgeographischen Merkmale
- Analyse der physischgeographischen Vielfalt Europas
- Zusammenhänge zwischen geografischen Merkmalen und der spezifischen Charakteristik von Regionen
- Anwendung von Methodenkompetenz: Auswertung von Texten, Karten und Schaubildern
- Entwicklung von Präsentationsfähigkeiten
Zusammenfassung der Kapitel
1) Ziele der Stunde
Das Kapitel beschreibt die Lernziele der Unterrichtsstunde, die sich an den Kompetenzen des Thüringer Lehrplans für Geographie orientieren. Es werden sowohl das Grobziel (Überblick über Europa und seine geographischen Merkmale) als auch Feinziele in den Bereichen Sachkompetenz, Methodenkompetenz, Sozialkompetenz und Selbstkompetenz erläutert.
2) Situation der Lerngruppe
Dieses Kapitel analysiert die Lerngruppe hinsichtlich ihrer Entwicklungspsychologie, Sozial-kulturellen Voraussetzungen und äußeren Lernbedingungen. Es wird auf die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Schüler und deren individuellen Förderbedarfe eingegangen.
3) Didaktische Überlegungen und methodisches Herangehen
Dieses Kapitel erläutert die didaktischen Überlegungen und methodischen Entscheidungen, die der Unterrichtsstunde zugrunde liegen. Es beinhaltet die Einordnung der Unterrichtseinheit in den Gesamtkontext des Unterrichts, die Sachanalyse, die didaktische Reduktion und die Wahl der Unterrichtsmethoden.
4) Geplanter Unterrichtsentwurf
Dieser Abschnitt präsentiert den detaillierten Ablauf der geplanten Unterrichtsstunde, inklusive der einzelnen Unterrichtsphasen, Lernmaterialien und methodischen Ansätzen.
5) Anhang (Auszüge)
Der Anhang enthält zusätzliche Informationen, die für die Durchführung der Unterrichtsstunde relevant sind. Beispielsweise finden sich hier der Sitzplan der Klasse, die Materiallisten für die Expertengruppen und ein Beobachtungsbogen zur Evaluation der Unterrichtsstunde.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themenschwerpunkte dieser Unterrichtsstunde sind: Europa, Donau, Geographie, wirtschafts- und sozialgeographische Merkmale, physischgeographische Vielfalt, Regionen, Länder, Methodenkompetenz, Sachkompetenz, Sozialkompetenz, Selbstkompetenz, Lernziele, Lerngruppe, Didaktik, Methodik, Unterrichtsentwurf, Expertengruppen, Beobachtungsbogen.
- Quote paper
- Franziska Sobania (Author), 2011, Mit dem Gummiboot über die Donau. Unterrichtsentwurf im Fach Geographie in einer 6. Klasse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/194693