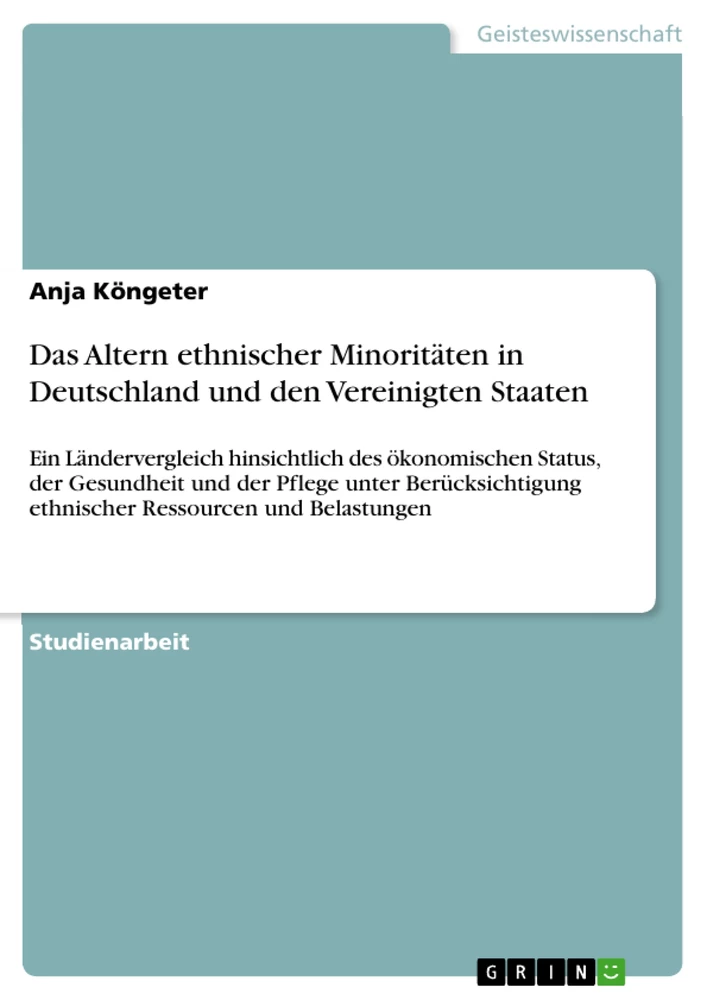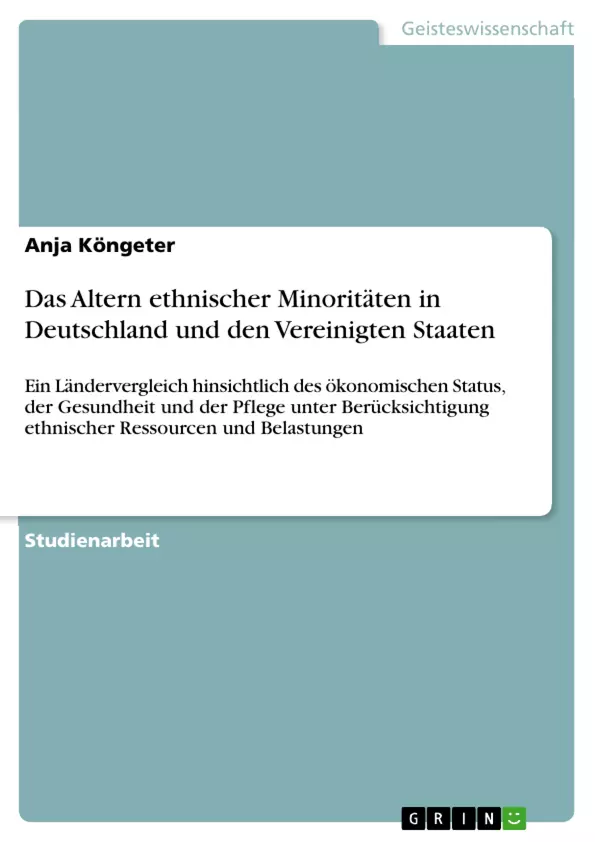In einer globalisierten Welt treffen innerhalb derselben Ländergrenzen unterschiedliche Ethnizitäten aufeinander. Unabhängig von ihrer Abstammung können beim Kontakt mit der einheimischen Bevölkerung wechselseitige Abgrenzungsprozesse einsetzen: Der „American Dream“ eines multikulturellen „Schmelztiegels“ hat sich als ein unerreichbarer Traum entpuppt: Die kulturellen Wurzeln bleiben bei ethnischen Minoritäten auch nach vielen Generationswechseln präsent. Für die einheimische Bevölkerung dagegen stellt diese kulturelle Verankerung häufig eine kollektive und individuelle Herausforderung dar.
Ein Umdenken hinsichtlich eines multiethnischen Lebens „auf einem grauen Planeten“ scheint unausweichlich: Wie kann ein gerechtes, gesundes und menschenwürdiges Leben geschaffen werden – unabhängig von Alter und Ethnizität?
Folgende drei Forschungsfelder sollen in dieser Arbeit untersucht werden, da sie für die alternde Bevölkerungsgruppe besonders relevant und durch politische Maßnahmen beeinflussbar sind: Der ökonomische Status, der Gesundheitsstatus und formelle/informelle Pflege.
Des Weiteren werden mithilfe politikwissenschaftlicher, gerontologischer und soziologischer Theorien mögliche Auswirkungen von Ethnizität auf diese drei Untersuchungsfelder unter-sucht. Vor allem der Belastungs- und Ressourcenansatz steht hierbei im Mittelpunkt der Analyse. Relevante makrostrukturelle Determinanten auf nationalstaatlicher Ebene sollen mithilfe Gosta Esping-Andersens Typologie der Wohlfahrtsstaatsregime untersucht werden.
Gliederung
- Quote paper
- Bachelor of Arts Anja Köngeter (Author), 2012, Das Altern ethnischer Minoritäten in Deutschland und den Vereinigten Staaten , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/194738