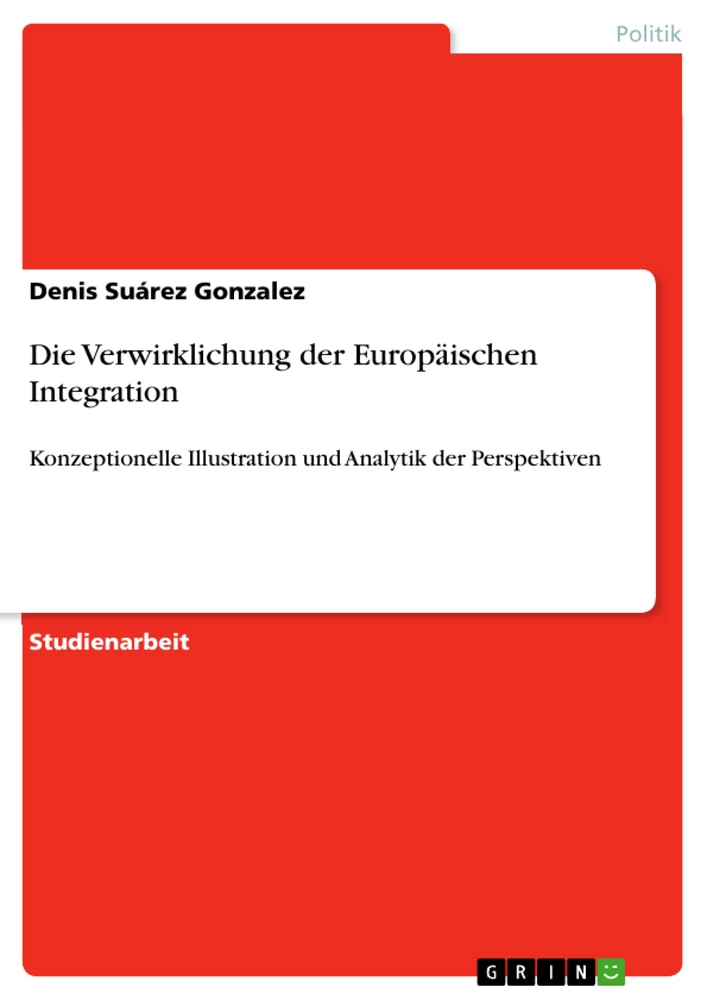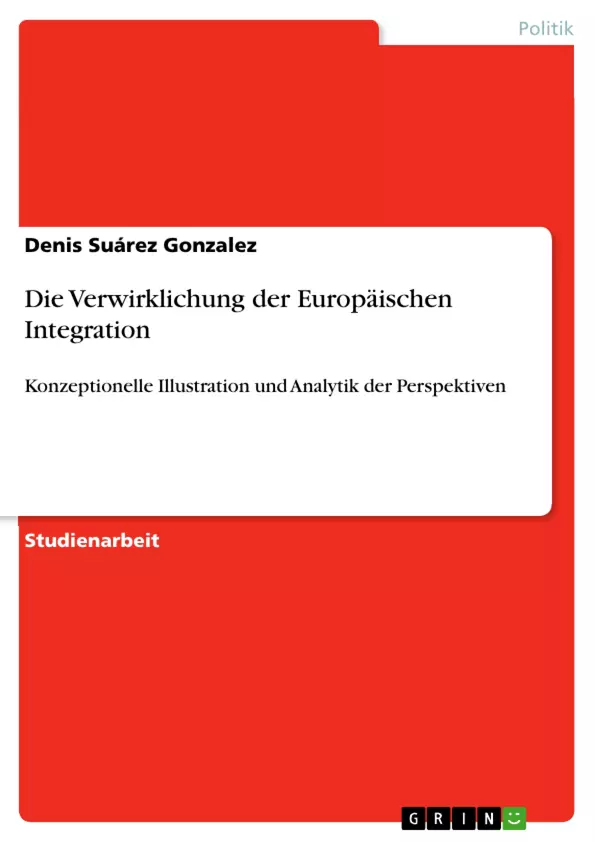Europa befindet sich seit dem 1. Dezember 2009 auf einer neuen Stufe im Prozess der Europäischen Integration. Seitdem ist nunmehr über ein Jahr der Bewährungsprobe der reformierten Europäischen Union vergangen. „In dem Wunsch, Demokratie, Effizienz in der Arbeit der Organe weiter zu stärken, damit diese in die Lage versetzt werden, die ihnen übertragenen Aufgaben in einem einheitlichen institutionellen Rahmen besser wahrzunehmen [...]“ wurde zum genannten Datum der jüngste Schritt der Europäischen Integration voll-zogen. Diese entwickelte sich bisher schon weit über ein halbes Jahrhundert hinweg. In diesem Zeitraum gab es Höhen und Tiefen, die durchlebt werden mussten, um Europa jene Gestalt zu geben, in der sie sich heute präsentiert. Diese Reifephase formte den europäischen Wirtschaftsraum, in dem bereits mehr als eine halbe Milliarde Menschen leben und handeln. Somit ergibt sich zugleich eine stetig wachsende Verantwortung gegenüber seiner Bewohner, die für jeden einen Anreiz schaffen sollte, sich mit seinen Spezifika auseinanderzusetzen. [...]
Ziel dieser Arbeit ist es, den Verlauf des Integrationsprozesses mit seinen wichtigsten Eckpunkten, den ihm zugrundeliegenden Zeitgeist, der zu seinem offiziellen Beginn führte und eine Analyse des gegenwärtigen Integrationsstandpunktes der Union darzulegen. [...]
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1. Einleitung
1.1. Einführung in die Thematik
1.2. Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
2. Konzeptionelle Grundlagen
2.1. Genesis der europäischen Integration
2.2. Die Chronologie des europäischen Integrationsprozesses
2.2.1. Phase Eins: Die Gründungsverträge (1950-1958)
2.2.2. Phase Zwei: Konsolidierung und allmähliche Erweiterung (1958-1986)
2.2.3. Phase drei: Die Institutionelle Reform und Vollendung des Binnenmarktes (1986-1993)
2.2.4. Phase vier: Die Konstitutionalisierungsphase (Seit 1993)
3. Würdigung des Europäischen Union
3.1. Faszination: Vorteile und Errungenschaften eines gemeinsamen Europas
3.1.1. Werte und Ziele der Europäischen Union
3.1.2. Die klare Festlegung der Zuständigkeiten
3.1.3. Jetzt erstmalig möglich: Der freiwillige Austritt
3.1.4. Die Stärkung der demokratische Grundlage
3.2. Frustration: Problemattische Facetten in einer kritischen Würdigung
4. Quo vadis Europa - Eine zusammenfassende Betrachtung
Anhang
Literaturverzeichnis
Sachwortverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was war der jüngste große Schritt der europäischen Integration?
Der 1. Dezember 2009 markiert mit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon eine neue Stufe der Integration, die darauf abzielte, Demokratie und Effizienz der EU-Organe zu stärken.
Welche Phasen der europäischen Integration werden unterschieden?
Die Arbeit unterteilt den Prozess in vier Phasen: 1. Die Gründungsverträge (1950-1958), 2. Konsolidierung und Erweiterung (1958-1986), 3. Institutionelle Reform und Binnenmarkt (1986-1993) und 4. Die Konstitutionalisierungsphase (seit 1993).
Was sind die zentralen Vorteile der Europäischen Union?
Zu den Errungenschaften gehören gemeinsame Werte und Ziele, die Stärkung der demokratischen Grundlage sowie die Schaffung eines gemeinsamen Wirtschaftsraums für über eine halbe Milliarde Menschen.
Gibt es ein Recht auf Austritt aus der EU?
Ja, mit den neueren Reformen wurde erstmalig die Möglichkeit eines freiwilligen Austritts aus der Europäischen Union rechtlich klar festgelegt.
Welche Rolle spielt der „Zeitgeist“ im Integrationsprozess?
Die Arbeit analysiert, wie der jeweilige Zeitgeist nach dem Zweiten Weltkrieg die Motivation für den offiziellen Beginn und den Verlauf der Integration bis zum heutigen Standpunkt geprägt hat.
- Arbeit zitieren
- B. Sc. Denis Suárez Gonzalez (Autor:in), 2011, Die Verwirklichung der Europäischen Integration, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/194778