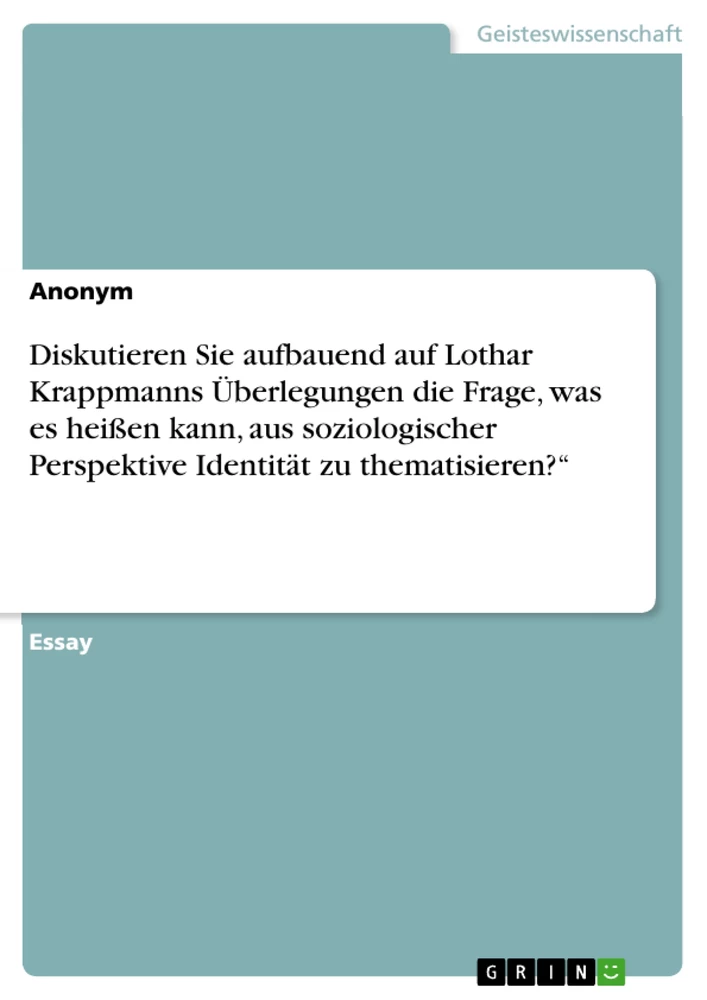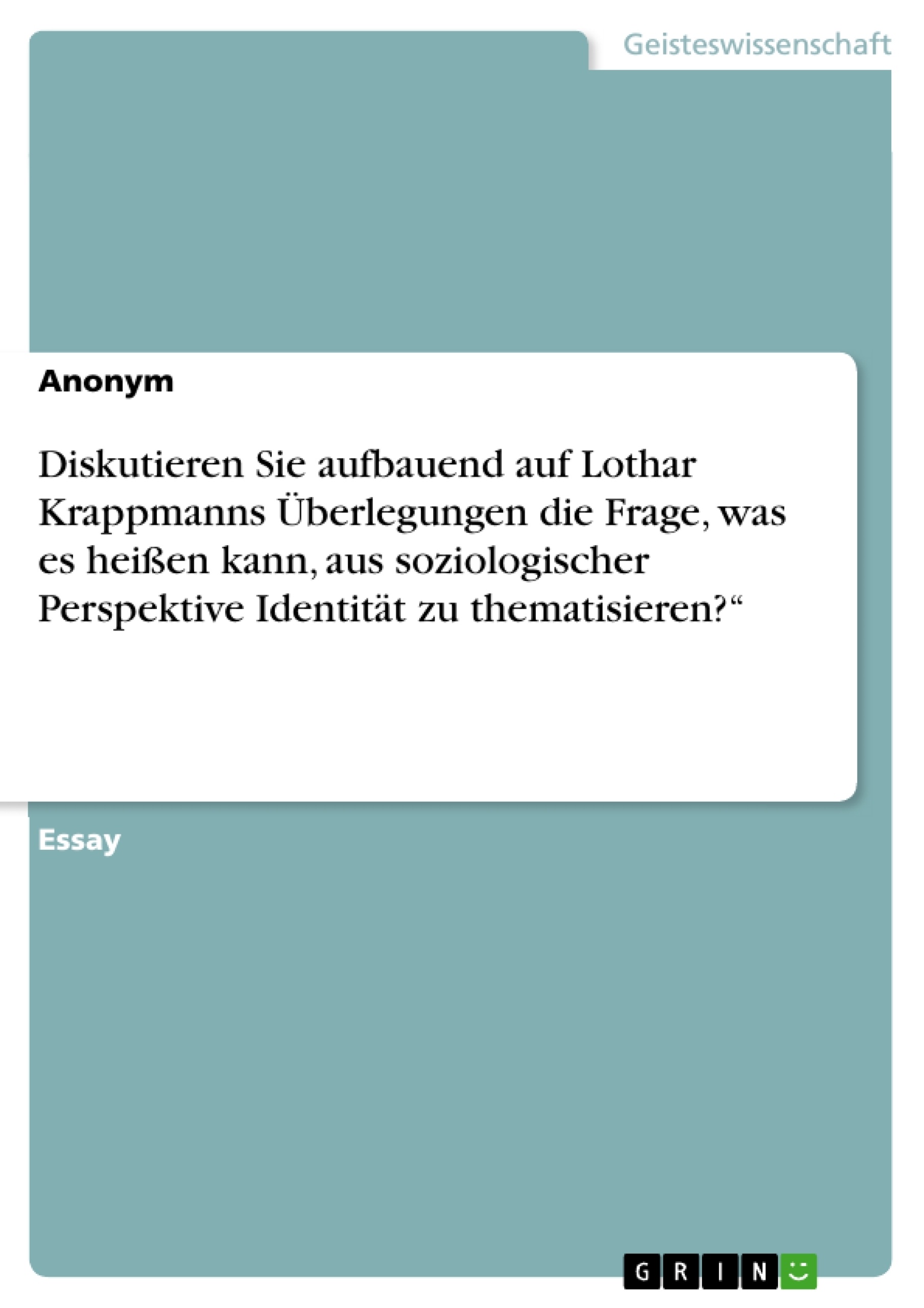Das vorliegende Essay befasst sich mit der Identitätstheorie Lothar Krappmanns, sowie den Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche soziale Interaktion. Es wird sein Konzept der „balancierten Identität vorgestellt und der symbolische Interaktionismus beleuchtet werden. Des Weiteren soll auf die Frage eingegangen werden, was es bedeutet, auf soziologische Sichtweise das Problem der Identitätsbildung zu betrachten.
Friedrich-Schiller-Universität Institut für Soziologie
Essayfrage:
„Diskutieren Sie aufbauend auf Lothar Krappmanns Überlegungen die Frage, was es heißen kann, aus soziologischer Perspektive Identität zu thematisieren?“
Abstrakt:
Das vorliegende Essay befasst sich mit der Identitätstheorie Lothar Krappmanns, sowie den Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche soziale Interaktion. Es wird sein Konzept der „balancierten Identität vorgestellt und der symbolische Interaktionismus beleuchtet werden. Des Weiteren soll auf die Frage eingegangen werden, was es bedeutet, auf soziologische Sichtweise das Problem der Identitätsbildung zu betrachten.
Der deutsche Soziologe und Pädagoge Lothar Krappmann gilt als einer der bedeutendsten Vertreter des symbolischen Interaktionismus in Deutschland und setzte sich in seiner Dissertation zum Thema „Soziologische Dimension der Identität“ mit der Identitätsbildung sowie den Rahmenbedingungen für die Teilnahme an Interaktionsprozessen auseinander.
Für Krappmann ist die menschliche Identität keine feststehende oder von Geburt an vorhandene Eigenschaft des Menschen, also keine „anthropologische Naturkonstante“[1], sondern er sieht die Identitätsbildung vielmehr als einen dynamischen Prozess, dessen Grundlage die Teilnahme an Interaktionsprozessen bildet. Mit jedem neuen Interaktionsprozess und mit jeder neuen Kommunikation in welche der Einzelne involviert ist, kann sich seine Identität verändern. Seine Annahme basiert auf der Beobachtung, dass sich jeder Mensch in den verschiedenen sozialen Systemen entsprechend seiner Interaktionspartner anders verhält: so werden wir beispielsweise „über politische Probleme mit einem Studentenvertreter anders sprechen als mit einen Mitglied der Regierungspartei“. [2]
Er definiert Identität wie folgt: „Die Identität interpretiert das Individuum im Hinblick auf die aktuelle Situation und unter Berücksichtigung des Erwartungshorizonts seiner Partner. (,..)vielmehr stellt sie eine immer wieder neue Verknüpfung früherer und anderer Interaktionsbeteiligungen des Individuums mit den Erwartungen und Bedürfnissen, die in der aktuellen Situation auftreten, dar. [3] Die Voraussetzung eine Identitätsbildung ist demnach die Leistung, sich während Interaktionsprozessen immer wieder neu definieren zu können.
Krappmann bezieht sich mit seinen Annahmen auf Emile Durkheim und seine Theorie der differenzierten Moderne, in der, angetrieben durch eine fortschreitende Arbeitsteilung in der Gesellschaft, die Entwicklung von Identität gefördert wird. Dies passiert, weil es durch die Ausdifferenzierung der Gesellschaft zur Herausbildung unterschiedlicher Normen- und Wertesysteme kommt, denen sich das Individuum konfrontiert sieht.
In diesem Ansatz verdeutlicht sich Krappmanns soziologische Betrachtungsweise, da er gesellschaftliche Entwicklungen als entscheidende Faktoren für die Identitätsbildung betrachtet.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Situation, dass der Einzelne die verschiedenen Erwartungen und Normen ständig neu Abwägen muss und sich gleichzeitig in seiner Besonderheit und Einzigartigkeit präsentieren soll, immer mit dem Ziel einer gelingenden Interaktion, bezeichnet Krappmann als „balancierte Individualität“.
Es kommt hierbei zu einem Abwägen der „sozialen Identität“, die geformt ist durch die Anforderungen des Interaktionspartners und der gesellschaftlichen Normen, und der „persönlichen Identität“, also der eigenen Selbsteinschätzung und dem Bedürfnis nach einer Individualität. Dieses Abwägen bildet die Balance der „Ich-Identität“ Das Auftreten immer neuer Normensysteme und die voranschreitende funktionale Differenzierung der Gesellschaft erschweren diesen „Balanceakt“.
Wenn die Identitätsbildung erfolgreich ist, so ordnet der Einzelne die gemachten Erfahrungen mit den diversen Interaktionspartnern einer möglichst konstanten und durchgängigen Biographie zu. Mit der Verknüpfung der einzelnen Situationen schafft sich das Individuum eine Handlungsorientierung, welche es zur Abwägung von neuen Situationen verwenden kann. Laut Krappmann ist es „zu erwarten, dass, ein Individuum dann, wenn es frühere Handlungsbeteiligungen und außerhalb der aktuellen Situation bestehende Anforderungen in seine Bemühungen um Identität aufnimmt, auch tatsächlich ein höheres Maß an Konsistenz im Verhalten zeigen wird.“[4]
Die Identitätsentwicklung ist folglich die Summe vieler Interaktionsprozesse, die das Individuum miteinander verknüpft um ein Bild seiner Selbst zu erhalten. Dadurch entwickelt jeder Mensch seine eigene Identität, die ihn von anderen unterscheidet. Die Individuen arbeiten demnach ständig an ihrer Identität, sie müssen sie verteidigen und neu konstruieren, „um aus sozialen Erwartungen nicht herauszufallen und doch eigenen Wünschen Anerkennung zu verschaffen.“ [5] [6]
Die sozialen Interaktionen finden in der Regel statt, wenn Individuen in Beziehung treten, sprich verbale oder non-verbale Kommunikation betreiben. Krappmann scheint hier die Umgangssprache als geeignetste, die im Wesentlichen drei Funktionen im Interaktionsprozess zwischen Personen erfüllen muss, um das Entstehen von Identität möglich zu machen.
Zum einen muss die Umgangssprache möglichst viele Informationen der Erwartungshaltung der einzelnen Akteure übertragen und den Informationsverlust gering halten. Demnach muss sie in der Lage sein, die Erwartungen für den anderen Akteur möglichst vollständig zu übersetzen. Ferner dient sie Sprache als „Instrument der Problemlösung“ und muss deswegen über einen ausdifferenzierten und umfangreichen Apparat an Begrifflichkeiten verfügen[7] Sie muss auch zusätzliche Informationen (verbale aber vor allem non-verbale) weiterleiten können, um die besondere Einstellung der Akteure zu dem Inhalt der Kommunikation vermitteln zu können und so den Charakter einer sozialen Beziehung zu kennzeichnen. Besonders Gestik und Mimik, aber auch der Ton einer Unterhaltung lassen viele Rückschlüsse auf die Beziehung schließen.
Um die Identität zu wahren bzw. zu bilden muss die Sprache folglich die Erwartungen der Akteure darstellen können und Raum für Diskussionen lassen.
Krappmann gilt als Vertreter des symbolischen Interaktionismus, welcher sich der Bedeutung der Sozialisation zur Identitätsbildung beschäftigt. Er stützt sich hierbei auf den amerikanischen Interaktionismus, der die Möglichkeit bietet, Bereiche des menschlichen Verhaltens von soziologischer Seite zu betrachten und er psychische Struktur des Individuums als innere Reproduktion eines sozialen Systems begreifen lässt. Diese Theorie besagt, dass alle sozialen Interaktionen symbolisch vermittelt werden, wobei das Symbol der Sprache das am häufigsten genutzte darstellt. Obwohl es dem symbolischen Interaktionismus an einer begrifflichen Systematik fehlt und sein Vorgehen oft unreflektiert scheint, spricht sich Krappmann dennoch dafür aus, da seine Methoden und Inhalte für eine soziologische Betrachtung der Identitätsbildung von Nützen seien.
So geht der Interaktionismus beispielsweise in seiner Analyse von Alltagserfahrungen aus oder aber ist wie Krappmann der Auffassung, dass das Individuum nur durch soziale Beziehungen und soziale Kontakte an Identität gewinnen kann. Auch betrachtet der Interaktionismus das soziale Geschehen nicht als statischen, sondern als einen dynamischen Prozess, bei dem jedes Individuum von neuem teilnehmen muss, um seine Identität zu bestätigen.
Eine Betrachtung der Identität unter psychosozialen Ansätzen lehnt er ab, da sie für ihn ein zu starres und statisches Bild der Identität entwerfen.
Er kritisiert die Psychoanalysten dafür, dass ihr Bild der Identität an „festen Identifikationen, stabilen Selbstbildern und eingedruckten Identitätsthemen oder reifizierten Rollen festgemacht wird“% Auf Grund dessen hält er den Interaktionismus als geeignetste Methode für eine soziologische Betrachtungsweise der Identität.
Es lässt sich festhalten, dass die soziologische Betrachtung der Identität bzw. der Identitätsbildung sich nach Krappmann immer durch eine Analyse der strukturellen Gegebenheiten ableiten lässt: „Diese Gegebenheiten sind als die Bedingung der Möglichkeit, Identität zu wahren, und diese wiederum als Voraussetzung für eine erfolgreiche soziale Interaktion zu betrachten.“[8]
Krappmann beschäftigt sich in seiner Analyse primär damit, welche Bedingungen für die Identitätsbildung vorherrschen bzw. unter welchen Bedingungen sich eine Identität in unserer Gesellschaft behaupten muss. Das Individuum, welches seine Identität auf Basis differierender Normen- und Wertesysteme bilden muss, wird demnach stark durch Entwicklungen des sozialen Systems beeinflusst. Demnach geht es ihm im Gegensatz zur Psychoanalyse weniger um die inneren, individuellen Prozesse einer Identitätsbildung, sondern um die gesellschaftlichen Rahmenbedinungen des sozialen Systems, unter denen ein Individuum seine Identität herausbildet. Seiner Theorie nach entwickelt sich eine Identität durch die Teilnahme an sozialen Interaktionen, wobei soziale Interaktionen auch nur durch das Vorhandensein von Identitäten möglich sind. Es lässt sich also eine Wechselwirkung datieren, bei der sich die Identität und die sozialen Systeme gegenseitig beeinflussen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
[...]
[1] Krappmann, Lothar, Soziologische Dimension der Identität. Strukturelle Bedingungen für die Teilnahme an Interaktionsprozessen, Ernst Klett Verlag: Stuttgart 1972, S. 11.
[2] Ebd. S. 7.
[3] Ebd. S. 9.
[4] Krappmann, Soziologische Dimension der Identität, S. 9.
[5] Ebd. S. 81.
[6] Abels, Heinz/ König, Alexandra, Sozialisation. Soziologische Antworten auf die Frage, Wer wir werden, was wir sind, wie gesellschaftliche Ordnung möglich ist und wie Theorien der Gesellschaft und der Identität ineinander spielen, Verlag für Sozialwissenschaften: Wiesbaden 2010, S. 140.
[7] Krappmann, Soziologische Dimension der Identität, S. 13.
[8] Krappmann, Soziologische Dimension der Identität, S. 19. Ebd. S. 10.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2011, Diskutieren Sie aufbauend auf Lothar Krappmanns Überlegungen die Frage, was es heißen kann, aus soziologischer Perspektive Identität zu thematisieren?“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/194861