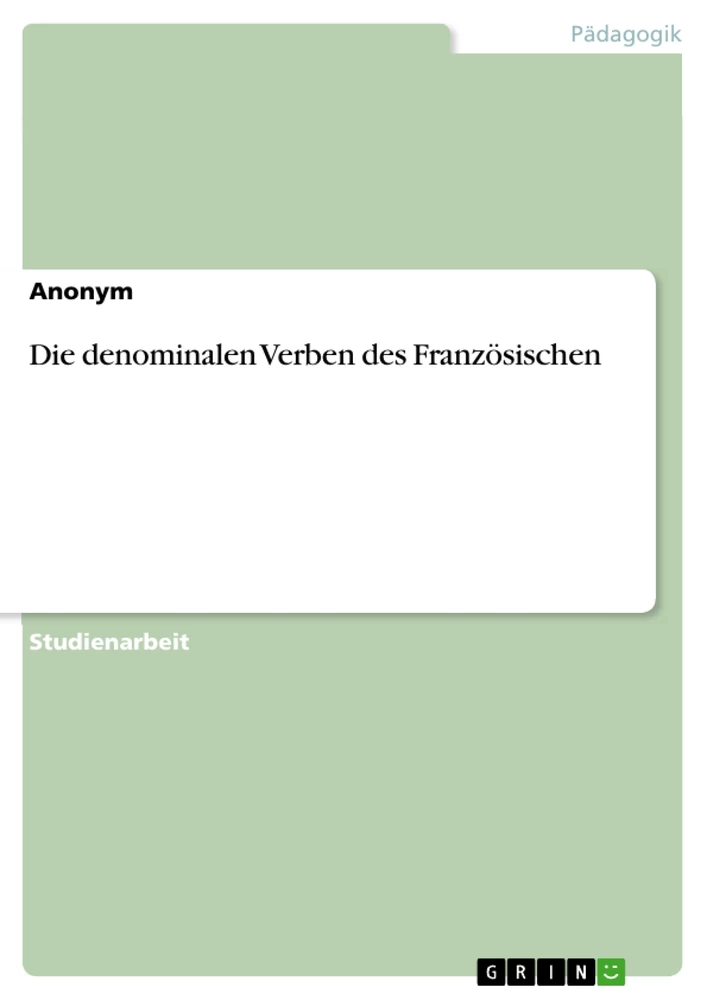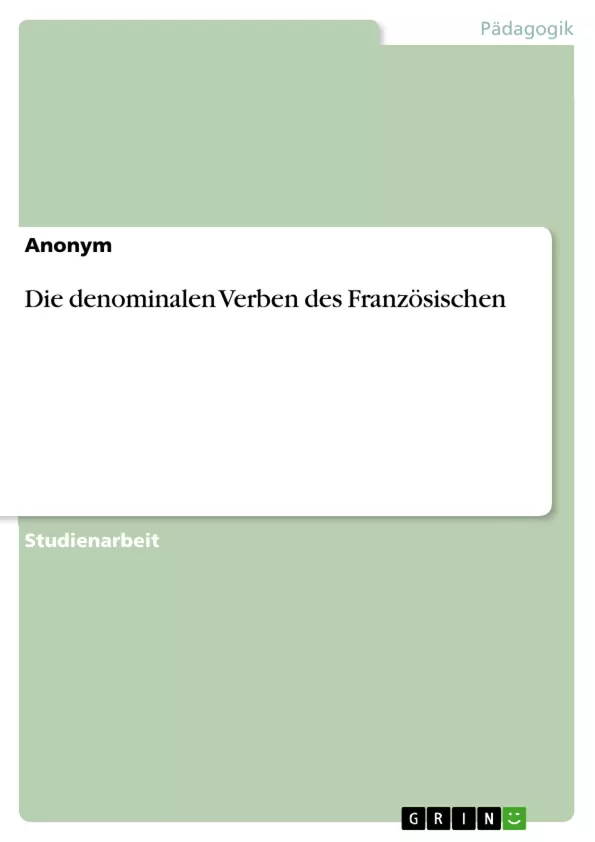In allen indoeuropäischen Sprachen findet man eine nicht unbedeutende Kategorie von Verben, die sehr zahlreich ist. Bei dieser wichtigen Art handelt es sich um denominale Verben, das heißt, Verben, die von einer nominalen Basis (Substantiv oder Adjektiv) abgeleitet worden sind. Ohne eine gute sprachwissenschaftliche Kenntnis und ohne diachronisch-historische Untersuchungen ist es oft schwer zu bestimmen, ob das Verb oder das Substantiv die Basis gebildet haben. Nichtsdestotrotz ist die Formation der denominalen Verben immer noch sehr lebendig und quasi täglich werden neue davon gebildet.1
In den vergangenen Jahrzehnten wurde vor allem in der sowjetischen Linguistik an konkreten und allgemeinen Fragen verbaler Derivation gearbeitet, überwiegend am Material der russischen Sprache.2 Auch Untersuchungen zur deutschen und romanischen verbalen Wortbildung wurden unternommen; im Französischen allerdings noch nicht so zahlreich wie im Slawischen.
Die vorliegende Arbeit soll sich im Rahmen der französischen Wortbildung mit den denominalen Verben des Französischen beschäftigen. Dazu soll zuallererst eine Definition gegeben und Verfahren aufgezeigt werden, mit Hilfe derer denominale Verben entstehen können. Auch die Beziehung zwischen Verben und den diese Verben motivierenden Substantive bzw. Adjektive soll herausgearbeitet werden. Im Anschluss werden die denominalen Verben nach semantischen Sinngruppen klassifiziert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition
- Nullsuffigierung (implizite Derivation)
- Explizite Derivation
- Suffigierung
- Präfigierung
- Parasynthetika
- Klassifizierung der denominalen Verben mit terminologischer Bedeutung
- Substantiv als subjektbezogenes Prädikatsnomen
- Substantiv als objektbezogenes Prädikatsnomen
- Ornative Verben
- Instrumentale Verben
- Lokative Verben
- Privative Verben
- Faktitive Verben
- Substantiv als Objekt
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht denominale Verben im Französischen. Ziel ist die Definition dieser Verben, die Darstellung ihrer Entstehungsprozesse und die Klassifizierung nach semantischen Gruppen. Der Fokus liegt auf der französischen Wortbildung und dem Verhältnis zwischen Verb und zugrundeliegendem Substantiv/Adjektiv.
- Definition und Bildung denominaler Verben im Französischen
- Klassifizierung denominaler Verben nach semantischen Kriterien
- Analyse verschiedener Derivationsverfahren (Nullsuffigierung, Suffigierung, Präfigierung, Parasynthese)
- Vergleich mit denominaler Verbbildung in anderen Sprachen (Deutsch, Englisch)
- Untersuchung der Produktivität denominaler Verbbildung im modernen Französisch
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der denominalen Verben in indogermanischen Sprachen ein, hebt deren Bedeutung und Häufigkeit hervor und verweist auf die Schwierigkeiten bei der Bestimmung der ursprünglichen Wortbasis (Verb oder Substantiv). Sie skizziert den Forschungsstand, insbesondere in der sowjetischen Linguistik und zu den deutschen und romanischen Sprachen, und benennt den Fokus der Arbeit auf die denominale Verbbildung im Französischen, mit dem Ziel der Definition, der Aufzeigung von Entstehungsprozessen und der semantischen Klassifizierung.
Definition: Dieses Kapitel definiert denominale Verben als Verben, die von einer nominalen Basis (Substantiv oder Adjektiv) abgeleitet sind. Es werden Beispiele gegeben und die umgekehrte Ableitung (deverbale Substantive) kurz erwähnt. Der morphologische Aufbau französischer Verben wird erläutert, wobei die Bedeutung der Derivation, insbesondere durch Suffigierung, hervorgehoben wird. Die produktiven Konjugationen (-er und -ir) werden als Basis für die Neubildung von Verben identifiziert, wobei die Unterscheidung zwischen grammatischen Endungen und Suffixen im Detail diskutiert wird. Schließlich wird der Unterschied zur denominalen Verbbildung im Deutschen und Englischen betont, die auch von Komposita und syntaktischen Gruppen abgeleitet werden können, im Gegensatz zum Französischen, das sich auf einfache Substantive beschränkt.
Nullsuffigierung (implizite Derivation): Dieses Kapitel behandelt die Ableitung denominaler Verben ohne explizites Ableitungsmorphem, also durch einfache Hinzufügung der Verbalendung (-er oder -ir). Es werden Beispiele aus alten und modernen Texten, einschließlich Lehnwörtern und individuellen Kreationen, gegeben. Die Bedeutung der Unterscheidung zwischen direkten und indirekten Ableitungen wird erläutert, sowie die Herausforderungen bei der Unterscheidung von Verben, die von verschiedenen Substantiven abgeleitet sind. Die Definition der einfachen Derivation durch Darmesteter und die Übereinstimmung mit Wandruszka werden angeführt.
Schlüsselwörter
Denominale Verben, Französische Wortbildung, Derivation, Suffigierung, Präfigierung, Parasynthese, Semantische Klassifizierung, Nullsuffigierung, Konjugation, Morphologie, Produktivität, Indogermanische Sprachen.
Häufig gestellte Fragen zur französischen denominalen Verbbildung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht denominale Verben im Französischen. Der Fokus liegt auf ihrer Definition, Entstehung, Klassifizierung nach semantischen Gruppen und dem Verhältnis zwischen Verb und zugrundeliegendem Substantiv/Adjektiv. Es wird ein Vergleich mit der denominalen Verbbildung in anderen Sprachen (Deutsch, Englisch) gezogen und die Produktivität dieser Bildungsweise im modernen Französisch untersucht.
Was sind denominale Verben?
Denominale Verben sind Verben, die von einer nominalen Basis (Substantiv oder Adjektiv) abgeleitet sind. Die Arbeit beschreibt verschiedene Ableitungsprozesse, darunter Nullsuffigierung (implizite Derivation), Suffigierung, Präfigierung und Parasynthese.
Welche Arten der Derivation denominaler Verben werden behandelt?
Die Arbeit behandelt explizite Derivationsmethoden wie Suffigierung und Präfigierung, sowie die implizite Derivation, die Nullsuffigierung, bei der die Verbalendung direkt an das Substantiv angehängt wird. Parasynthese wird ebenfalls als Derivationsmethode betrachtet.
Wie werden denominale Verben im Französischen klassifiziert?
Die Klassifizierung erfolgt nach semantischen Kriterien. Es werden verschiedene semantische Gruppen unterschieden, z.B. Verben, bei denen das Substantiv als Subjekt- oder Objektprädikatsnomen fungiert, ornative, instrumentale, lokative, privative und faktitive Verben. Die Arbeit beschreibt auch Fälle, in denen das Substantiv als direktes Objekt des Verbs dient.
Welche Rolle spielt die Morphologie?
Die morphologische Struktur französischer Verben spielt eine zentrale Rolle. Die Arbeit erläutert den Aufbau französischer Verben und die Bedeutung der Derivation, insbesondere durch Suffigierung. Die produktiven Konjugationen (-er und -ir) werden als Basis für die Neubildung von Verben identifiziert. Die Unterscheidung zwischen grammatischen Endungen und Suffixen wird detailliert diskutiert.
Wie wird die Nullsuffigierung (implizite Derivation) behandelt?
Die Nullsuffigierung, die Ableitung ohne explizites Ableitungsmorphem, wird ausführlich behandelt. Es werden Beispiele aus alten und modernen Texten, Lehnwörtern und individuellen Kreationen gegeben. Die Herausforderungen bei der Unterscheidung von Verben, die von verschiedenen Substantiven abgeleitet sind, werden ebenfalls thematisiert.
Wie werden deutsche und englische denominale Verben in die Untersuchung einbezogen?
Die Arbeit vergleicht die denominale Verbbildung im Französischen mit der in anderen Sprachen, insbesondere Deutsch und Englisch. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf den Unterschieden in den Derivationsmethoden. Während das Französische sich hauptsächlich auf einfache Substantive beschränkt, können im Deutschen und Englischen auch Komposita und syntaktische Gruppen als Basis für die Verbbildung dienen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Denominale Verben, Französische Wortbildung, Derivation, Suffigierung, Präfigierung, Parasynthese, Semantische Klassifizierung, Nullsuffigierung, Konjugation, Morphologie, Produktivität, Indogermanische Sprachen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2011, Die denominalen Verben des Französischen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/194962