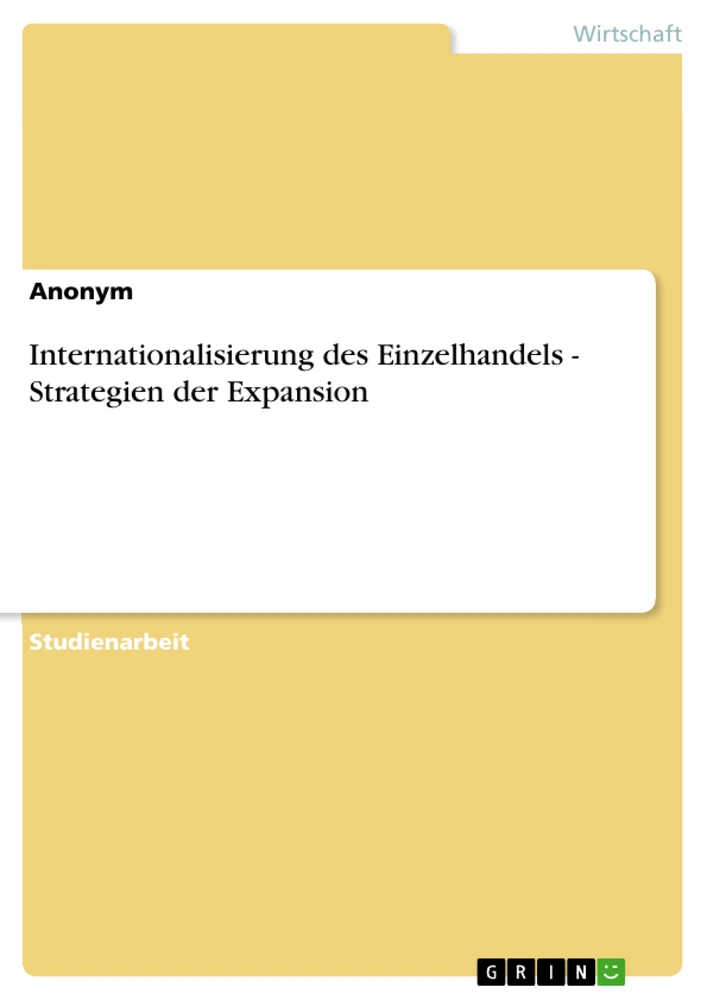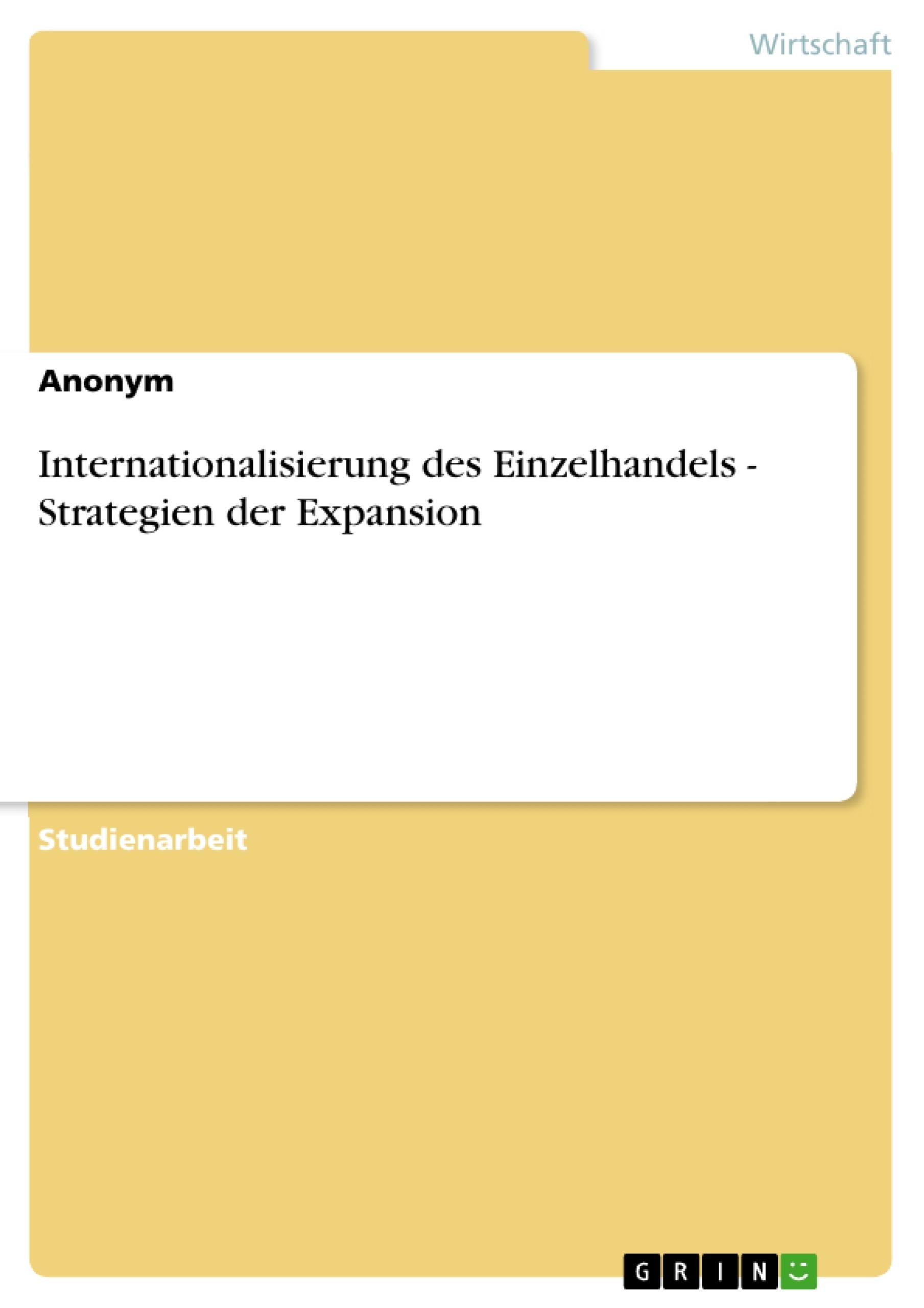Die vorliegende Untersuchung beschäftigt sich mit den Vor- und Nachteilen der Internationalisierung des Einzelhandels. Zu diesem Zwecke werden Begriffserklärung präsentiert, die wesentlichen Betriebssysteme einer aussichtsreichen Internationalisierung vorgestellt und analysiert und zudem wird näher auf die Expansionsmotive der Firmen und deren Möglichkeiten hinsichtlich des Markteintritts eingegangen. Auch auf die Risiken solcher Unternehmungen wird kurz eingegangen. Im Fazit werden die Ergebnisse noch einmal zusammenfassend aufbereitet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ausgangssituation
- Begriffsdefinition
- Internationalisierung
- Zentrale Geschäftsmodelle
- Erfolgsfaktoren für den Einzelhandel
- Gründe
- Push-Motive
- Pull-Motive
- Risiken
- Erfolgsversprechende Formen des Markteintritts
- Joint Venture
- Franchising
- Filialgründung
- Erfolgreiche Internationalisierung am Beispiel Aldi
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Untersuchung analysiert die Erfolgsfaktoren der Internationalisierung im Einzelhandel. Dazu werden zunächst der Begriff des Einzelhandels definiert und die wesentlichen Betriebssysteme einer erfolgreichen Internationalisierung untersucht. Anschließend werden die Expansionsmotive von Unternehmen sowie deren Markteintrittsmöglichkeiten beleuchtet. Darüber hinaus werden die Risiken solcher Unternehmungen betrachtet.
- Definition des Einzelhandels und seine Bedeutung
- Zentrale Geschäftsmodelle und Erfolgsfaktoren im internationalen Einzelhandel
- Expansionsmotive und -möglichkeiten von Unternehmen
- Risiken der Internationalisierung im Einzelhandel
- Beispiele erfolgreicher Internationalisierung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Ausgangssituation im Einzelhandel dar, die durch die Subprimekrise und die daraus resultierende Weltwirtschaftskrise geprägt ist. Der Einzelhandel wird als Hauptleidtragender dieser Krise identifiziert, wobei Marktsättigung, demographische Stagnation und Verunsicherung der Verbraucher als zentrale Gründe genannt werden. Der starke Verdrängungswettbewerb im Einzelhandel, insbesondere durch die Preispolitik der Discounter, führt zu sinkenden Gewinnmargen und einer Verdrängung kleinerer Unternehmen.
Internationalisierung
Das Kapitel erläutert die zentralen Geschäftsmodelle und Erfolgsfaktoren der Internationalisierung im Einzelhandel. Es werden verschiedene Aspekte wie die Anpassung an lokale Gegebenheiten, die Beziehung zu Zulieferern, die Herausforderungen durch den „Smart Shopper“ und die Preissturztendenzen im Lebensmittelhandel beleuchtet. Es wird auf die Bedeutung von modernen Ladenbaukonzepten und vertikalen Handelskonzepten hingewiesen, die die Kunden stärker in den Mittelpunkt stellen und eine Inszenierung der Produkte ermöglichen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter und Themengebiete der Untersuchung sind Internationalisierung, Einzelhandel, Geschäftsmodelle, Erfolgsfaktoren, Markteintrittsformen, Expansionsmotive, Risiken, sowie der „Smart Shopper“ und die Preissturztendenzen im Lebensmittelhandel.
Häufig gestellte Fragen
Warum internationalisieren sich Einzelhandelsunternehmen?
Gründe sind oft gesättigte Heimatmärkte (Push-Motive) oder attraktive Wachstumschancen und neue Zielgruppen im Ausland (Pull-Motive).
Welche Markteintrittsformen gibt es für den Einzelhandel?
Gängige Formen sind Joint Ventures (Partnerschaften), Franchising oder die Gründung eigener Filialen im Ausland.
Wer ist der „Smart Shopper“?
Ein moderner Konsumententyp, der preisbewusst einkauft, hohe Qualität fordert und Angebote über verschiedene Kanäle vergleicht.
Welche Risiken birgt die internationale Expansion?
Unternehmen stehen vor kulturellen Barrieren, rechtlichen Unsicherheiten, logistischen Herausforderungen und der Gefahr, lokale Kundenbedürfnisse falsch einzuschätzen.
Warum gilt Aldi als Beispiel für erfolgreiche Internationalisierung?
Aldi nutzt ein klares, effizientes Discount-Modell mit hoher Standardisierung, das erfolgreich auf verschiedene Ländermärkte übertragen wurde.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2007, Internationalisierung des Einzelhandels - Strategien der Expansion , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/194977