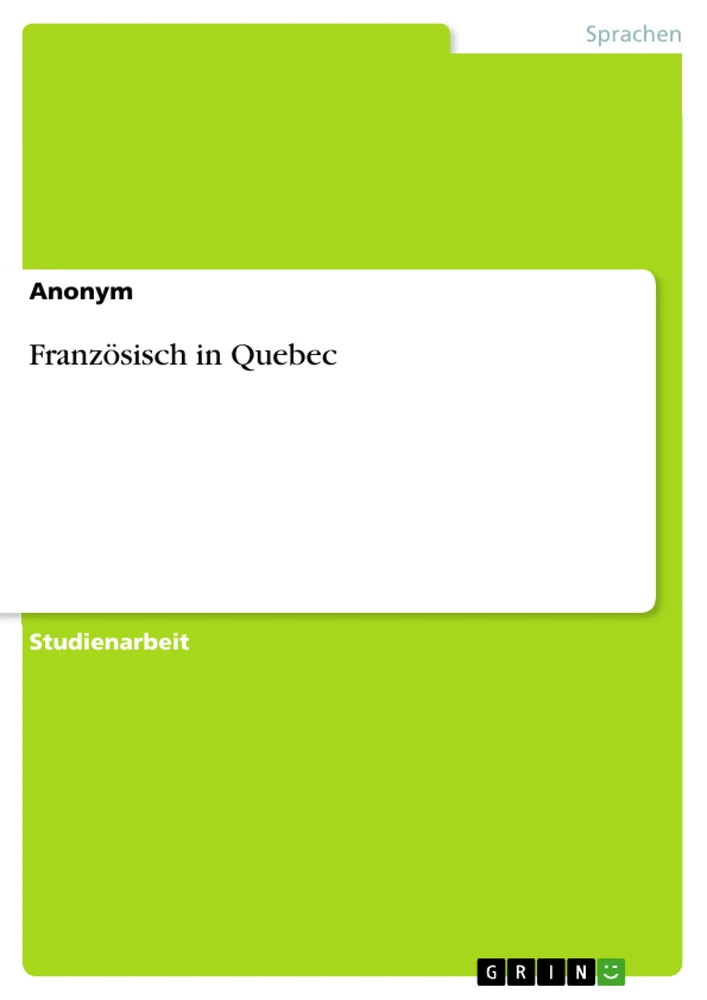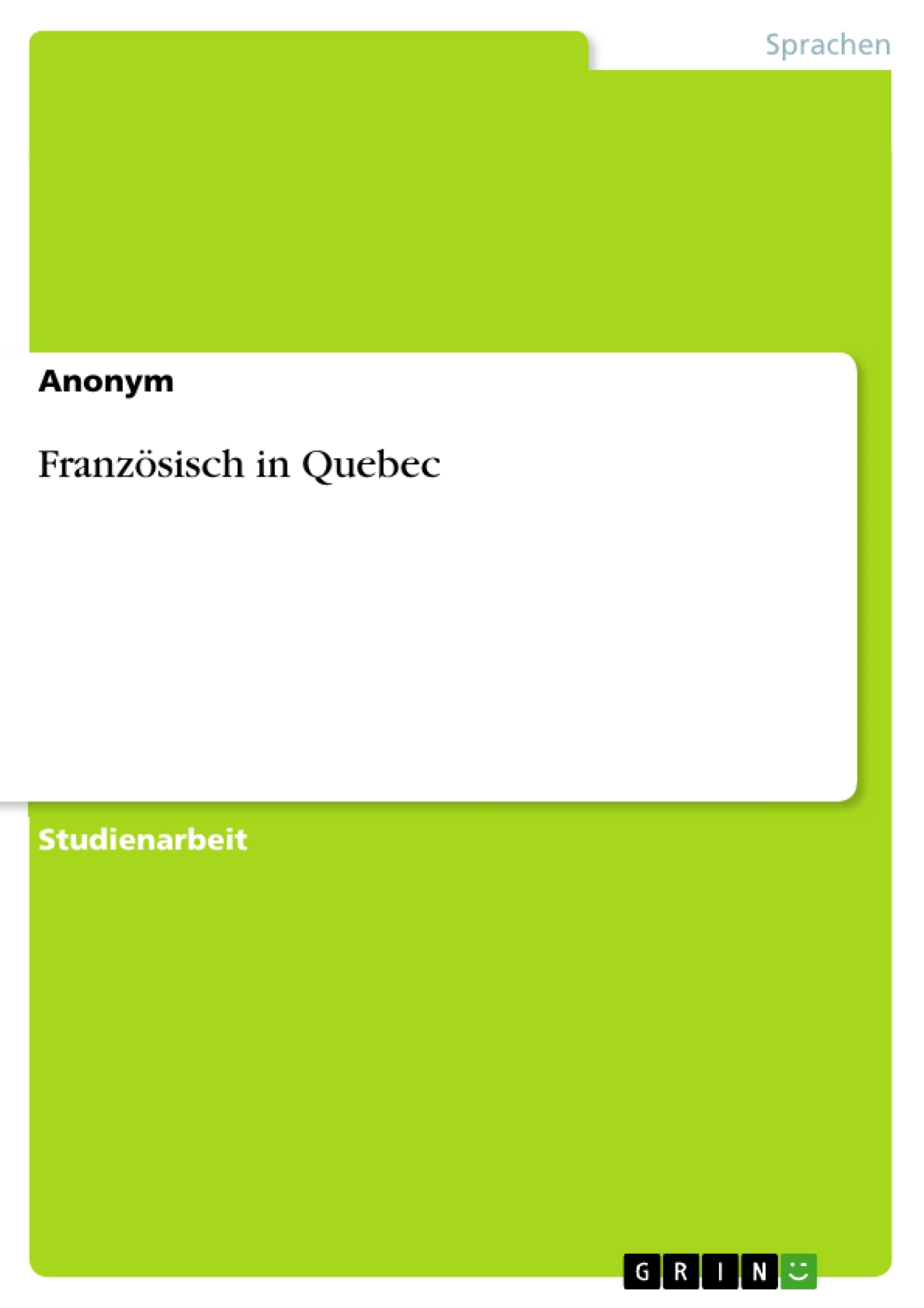Betrachtet man die Varietäten des Französischen, fällt deutlich auf, dass sich diese auch weit außerhalb des Mutterlandes Frankreich und seinen Departements wieder finden.
Die vorliegende Hausarbeit behandelt das Thema „Französisch in Kanada“ mit Hauptaugenmerk auf die Provinz Québec, die den größten frankophonen Bevölkerungsanteil Kanadas beansprucht und als einzige Französisch als Amtssprache festgelegt hat.
Mit knapp 7,5 Mio. Mitbürger und einer Fläche von ca. 1,5 Mio. km² ist die Provinz ungefähr zweieinhalb Mal so groß wie Frankreich, wird aber von wesentlich weniger Einwohnern besiedelt (vgl. Frankreich hat ca. 65 Mio. Einwohner).
Auffällig ist auch, dass Québec die frankophone Mehrheit über Jahrhunderte hinweg weit ab vom französischen Mutterland in einem ausschließlich anglophonen Gebiet bewahren konnte.
Im Folgenden wird daher unter Anderem auf die historisch-politische Entwicklung der Sprache, sowie auf Phonetik und Phonologie, Morphologie und Lexikologie des franςais québécois eingegangen, welches neben Québec auch in Ontario und den westlichen Provinzen Kanadas gesprochen wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sprachgeschichte
- Neufrankreich (1608-1763)
- Britische Kolonie (1763-1791)
- Kanadische Provinz (1791-1960)
- Separatismus (1960-heute)
- Sprachqualität des kanadischen Französisch
- Sprachliche Merkmale
- Phonetik und Phonologie
- Das konsonantische System
- Das vokalische System
- Morphologie
- Syntax
- Lexikologie
- Archaismen
- Anglizismen
- Amerindianismen
- Kanadianismen
- Phonetik und Phonologie
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Geschichte und die sprachlichen Merkmale des kanadischen Französisch, insbesondere in der Provinz Québec. Ziel ist es, einen Überblick über die Entwicklung der Sprache in einem anglophonen Umfeld zu geben und wichtige sprachliche Besonderheiten aufzuzeigen.
- Die historische Entwicklung des Französisch in Kanada von der Kolonialzeit bis zur Gegenwart.
- Der Einfluss der britischen Kolonialherrschaft und der daraus resultierenden politischen und sozialen Entwicklungen auf die Sprache.
- Die sprachlichen Merkmale des kanadischen Französisch im Vergleich zum europäischen Französisch.
- Die Rolle des Sprachgesetzes und des Separatismus in der Sprachentwicklung.
- Der Einfluss indigener Sprachen und des Englischen auf den Wortschatz des kanadischen Französisch.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Französisch in Kanada ein, mit Fokus auf Québec als größte frankophone Region. Sie hebt die Besonderheit hervor, dass eine frankophone Mehrheit über Jahrhunderte hinweg in einem anglophonen Gebiet bestehen konnte, und kündigt die folgenden Kapitel an, die sich mit der historischen Entwicklung, sowie den phonetischen, phonologischen, morphologischen und lexikalischen Aspekten des Québécois befassen.
Sprachgeschichte: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Französisch in Kanada, beginnend mit den ersten französischen Expeditionen und der Gründung Neufrankreichs durch Samuel de Champlain. Es beschreibt die Herausforderungen, denen sich die frankophone Bevölkerung gegenüber sah, darunter Auseinandersetzungen mit den Irokesen und den Engländern, sowie den Verlust von Gebieten an England im Vertrag von Utrecht. Der Kapitelverlauf schildert die Entwicklung bis zur britischen Kolonialherrschaft, die anfängliche Assimilationspolitik, und die spätere Anerkennung der französischen Sprache und Kultur durch den Québecer Act.
Sprachgeschichte (2.2 - 2.4): Der weitere Verlauf der Sprachgeschichte widmet sich der Etablierung des kanadischen Staates und der Teilung der Provinz Kanada in Upper und Lower Canada. Es werden die Entwicklungen im 19. Jahrhundert skizziert, die Herausforderungen der wirtschaftlichen Abhängigkeit von den USA, und der aufkommende Separatismus. Die Rolle von Sprachgesetzen wie dem Official Languages Act und Loi sur la langue officielle, und deren Einfluss auf die sprachliche Landschaft Québecs, werden ebenfalls erörtert.
Sprachqualität des kanadischen Französisch: Dieses Kapitel, dessen detaillierte Inhalte nicht in der Textvorlage zu finden sind, würde voraussichtlich die Besonderheiten des kanadischen Französisch im Vergleich zum europäischen Französisch behandeln und den Grad der Standardisierung und Variation analysieren. Es könnte auf die Entwicklung von Sprachnormen und die Frage der Sprachprestige eingehen.
Sprachliche Merkmale: Ohne detaillierte Informationen aus dem Originaltext kann hier nur eine allgemeine Aussage gemacht werden: Dieses Kapitel befasst sich mit den sprachlichen Merkmalen des kanadischen Französisch, unterteilt in Phonetik/Phonologie, Morphologie, Syntax und Lexikologie. Es würde detailliert auf die spezifischen lautlichen, morphologischen und syntaktischen Strukturen des Québécois eingehen und die Einflüsse anderer Sprachen (z.B. Englisch, indigene Sprachen) auf den Wortschatz untersuchen, z.B. Archaismen, Anglizismen, Amerindianismen und Kanadianismen.
Schlüsselwörter
Kanadisches Französisch, Québécois, Sprachgeschichte, Kolonialismus, Sprachpolitik, Sprachkontakt, Anglizismen, Amerindianismen, Separatismus, Sprachgesetzgebung, Phonetik, Phonologie, Morphologie, Syntax, Lexikologie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Kanadisches Französisch
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Geschichte und die sprachlichen Merkmale des kanadischen Französisch, insbesondere in der Provinz Québec. Der Fokus liegt auf der Entwicklung der Sprache in einem anglophonen Umfeld und der Darstellung wichtiger sprachlicher Besonderheiten.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung des Französisch in Kanada von der Kolonialzeit bis zur Gegenwart, den Einfluss der britischen Kolonialherrschaft, die sprachlichen Merkmale im Vergleich zum europäischen Französisch, die Rolle von Sprachgesetzen und Separatismus, sowie den Einfluss indigener Sprachen und des Englischen auf den Wortschatz.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Sprachgeschichte (einschließlich Unterkapitel zu Neufrankreich, der britischen Kolonialzeit, der kanadischen Provinz und dem Separatismus), ein Kapitel zur Sprachqualität des kanadischen Französisch, ein Kapitel zu den sprachlichen Merkmalen (Phonetik/Phonologie, Morphologie, Syntax, Lexikologie) und eine Schlussbetrachtung.
Wie wird die Sprachgeschichte des kanadischen Französisch dargestellt?
Die Sprachgeschichte wird chronologisch behandelt, beginnend mit den ersten französischen Expeditionen und der Gründung Neufrankreichs. Sie beschreibt die Herausforderungen der frankophonen Bevölkerung, den Einfluss der britischen Kolonialherrschaft, die Entwicklung von Sprachgesetzen und die Rolle des Separatismus in der Sprachentwicklung.
Welche sprachlichen Merkmale des kanadischen Französisch werden untersucht?
Die sprachlichen Merkmale werden auf den Ebenen der Phonetik und Phonologie, Morphologie, Syntax und Lexikologie untersucht. Es wird auf spezifische lautliche, morphologische und syntaktische Strukturen eingegangen und der Einfluss anderer Sprachen (Englisch, indigene Sprachen) auf den Wortschatz (Archaismen, Anglizismen, Amerindianismen, Kanadianismen) analysiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Kanadisches Französisch, Québécois, Sprachgeschichte, Kolonialismus, Sprachpolitik, Sprachkontakt, Anglizismen, Amerindianismen, Separatismus, Sprachgesetzgebung, Phonetik, Phonologie, Morphologie, Syntax, Lexikologie.
Welche Zielsetzung verfolgt die Hausarbeit?
Die Hausarbeit zielt darauf ab, einen Überblick über die Entwicklung des kanadischen Französisch in einem anglophonen Umfeld zu geben und wichtige sprachliche Besonderheiten aufzuzeigen. Sie soll die Herausforderungen und den Erfolg des Erhalts der französischen Sprache in Kanada beleuchten.
Wo finde ich detailliertere Informationen zu den einzelnen Kapiteln?
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Kapiteln sind in der vollständigen Hausarbeit enthalten. Die hier bereitgestellte Zusammenfassung bietet einen Überblick über die wichtigsten Inhalte und Themen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2009, Französisch in Quebec, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/195007