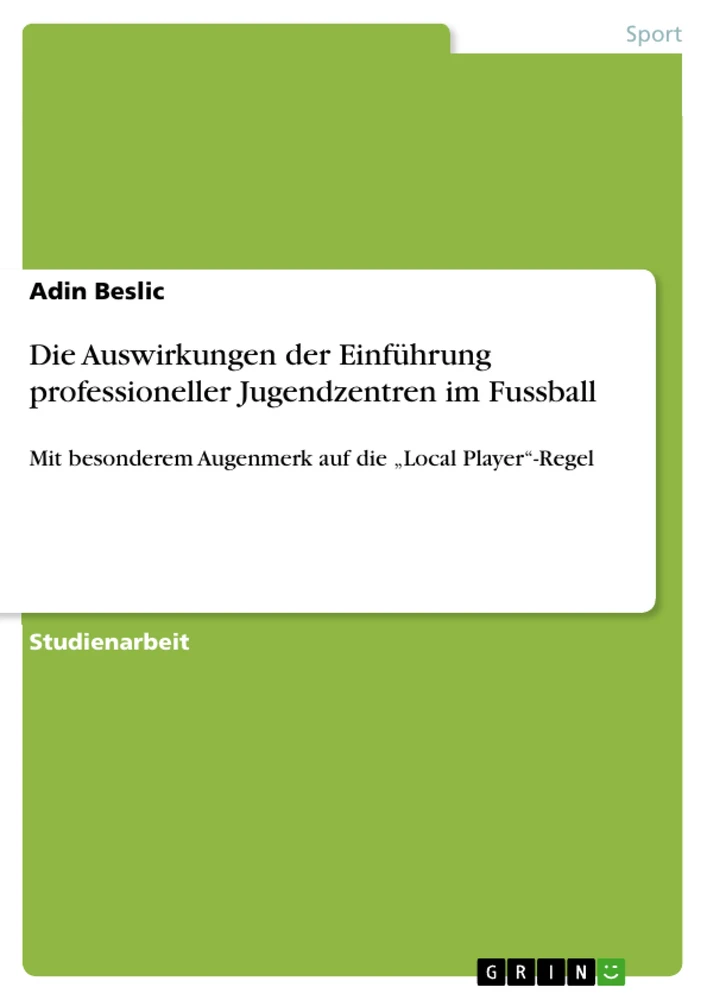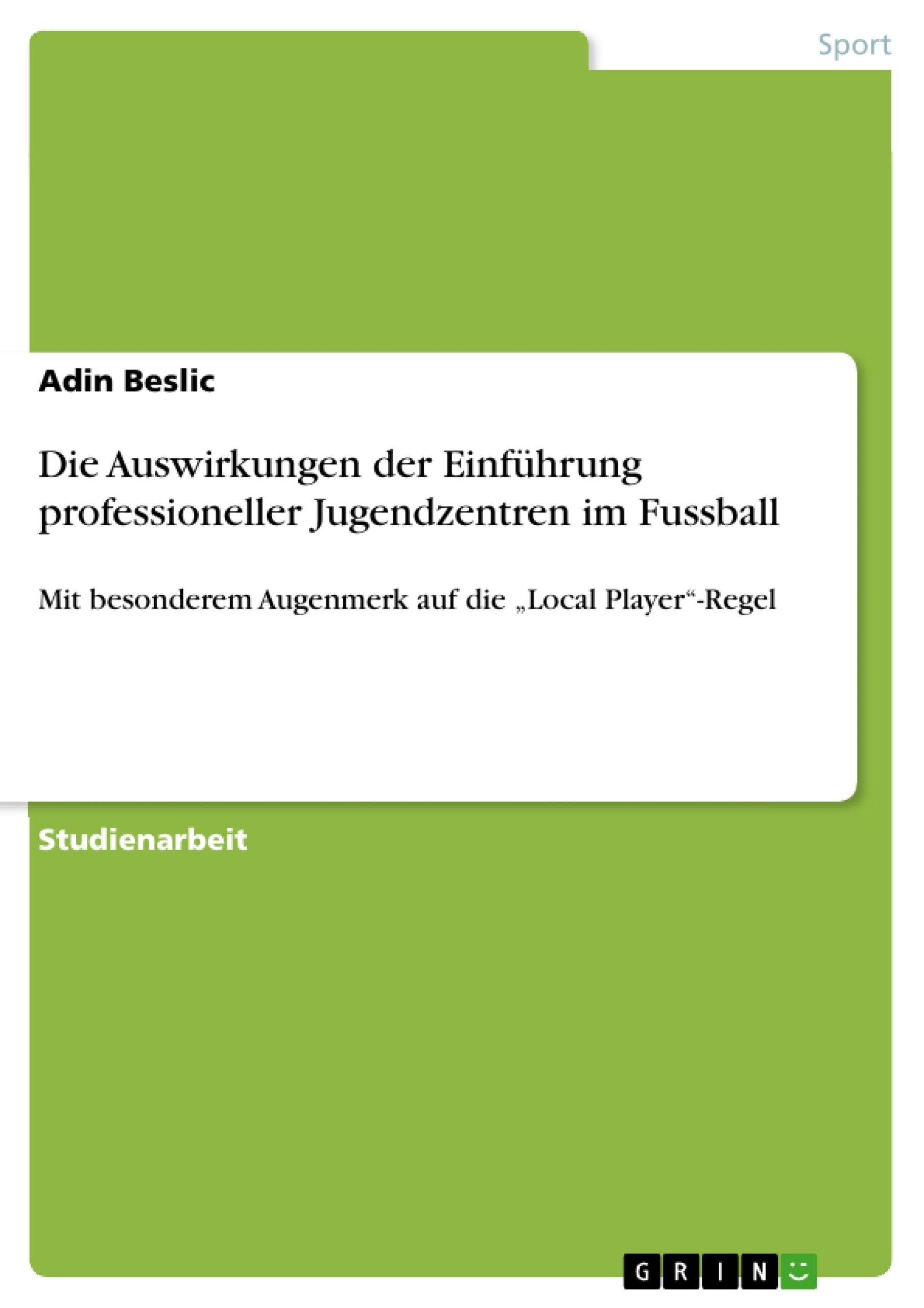Es ist knapp über ein Jahr her, dass die deutsche Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika, Fußballfans rund um den Globus mit ihrer frischen, offensiven und technisch brillanten Weise Fussball zu spielen begeisterte. Dabei beeindruckte ein junges deutsches Team mit einem Durchschnittsalter von unter 25 Jahren, ausschließlich aus Bundesliga-Spielern bestehend, die Welt mit wunderschönem und äußerst erfolgreichem Offensivfußball.
Anfang des Jahrtausends, also vor rund zehn Jahren, wäre dieses Szenario noch undenkbar gewesen. Damals war das Medienecho gewaltig, als die deutsche Mannschaft schon in der Vorrunde der Europameisterschaft in Holland und Belgien ausschied. Man warf dem Team vor, dass sie satt und überaltert wären, ohne dass junge Talente in die Kader der Bundesligaclubs drängen würden und sich so für die Nationalelf spielerisch bewerben könnten.
Spätestens dann wurde dem Deutschen Fussball Bund (DFB) bewusst, dass sie etwas unternehmen mussten. Sie reagierten relativ schnell und forderten von allen Clubs der 1. – und 2. Bundesliga eine verpflichtende Einführung von Leistungszentren für Nachwuchsspieler. Man koppelte die Errichtung und Unterhaltung eines Jugendleistungszentrums mit dem Erwerb der Lizenz, ohne die man nicht spielberechtigt für die beiden Profiligen in Deutschland ist. Damit wurde 2001 der Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft des deutschen Fußballs gelegt, durch den man heute noch enorm profitiert.
Im Rahmen dieser Arbeit soll dargestellt werden wie die Einführung von Jugendleistungszentren von statten gegangen ist, an welche Rahmenbedingungen das Ganze geknöpft ist, was sie für Wirkungen und wie die Vereine davon profitiert haben. Darüber hinaus soll untersucht werden, ob und in welchem Zusammenhang, die „Local Player“ - Regel, ihren Einfluss zum jetzigen Status hatte. War die Einführung dieser Regel ein „Witz“, so wie es damalige und noch aktuelle Team-Manager der Nationalmannschaft nannte oder wird sie tatsächlich mit Überzeugung durchgesetzt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Teil
- Gesetzliche Grundlagen
- Local Player Regel
- Analyse der Jugendarbeit
- Sportliches Abschneiden der A-Jugenden
- Verschiedene Konzepte von Jugendarbeiten
- Bayer Leverkusen
- FSV Mainz 05
- Ajax Amsterdam
- Integration der Jugendspieler in die 1.Mannschaft
- Erklärung der Methodik
- Ergebnisse der Tabelle
- Kategorisierung der Einsatzzeiten
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Einführung von Jugendleistungszentren im deutschen Profifußball und den Auswirkungen auf die Entwicklung von Nachwuchsspielern, insbesondere im Hinblick auf die „Local Player“-Regel. Die Arbeit untersucht die Rahmenbedingungen der Einführung, die strukturellen Voraussetzungen der Zentren sowie die Integration von Jugendspielern in die erste Mannschaft.
- Einführung von Jugendleistungszentren im deutschen Profifußball
- Entwicklung von Nachwuchsspielern
- Die „Local Player“-Regel
- Integration von Jugendspielern in die erste Mannschaft
- Strukturelle Voraussetzungen der Jugendleistungszentren
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Bedeutung der Einführung von Jugendleistungszentren im deutschen Profifußball vor dem Hintergrund der Entwicklung der deutschen Nationalmannschaft. Im theoretischen Teil werden die gesetzlichen Grundlagen und die „Local Player“-Regel näher betrachtet. Die Analyse der Jugendarbeit umfasst die sportlichen Leistungen der A-Jugenden sowie verschiedene Konzepte der Jugendarbeit in verschiedenen Vereinen. Schließlich wird die Integration von Jugendspielern in die erste Mannschaft analysiert, wobei die Methodik, Ergebnisse und Einsatzzeiten der Spieler im Vordergrund stehen.
Schlüsselwörter
Jugendleistungszentren, „Local Player“-Regel, deutsche Nationalmannschaft, Profifußball, Nachwuchsförderung, Jugendarbeit, Integration von Jugendspielern, Bundesliga, Leistungszentren.
Häufig gestellte Fragen zu Jugendleistungszentren im Fußball
Warum führte der DFB 2001 verpflichtende Leistungszentren ein?
Nach dem frühen Ausscheiden bei der EM 2000 wurde klar, dass die Förderung junger Talente professionalisiert werden muss, um international konkurrenzfähig zu bleiben.
Was besagt die "Local Player"-Regel?
Sie verpflichtet Clubs, eine bestimmte Anzahl an Spielern im Kader zu haben, die im eigenen Verein oder in Deutschland ausgebildet wurden.
Welche Vereine gelten als Vorbilder in der Jugendarbeit?
In der Arbeit werden Konzepte von Bayer Leverkusen, dem FSV Mainz 05 und Ajax Amsterdam als beispielhaft analysiert.
Hatten die Leistungszentren Einfluss auf die WM 2010?
Ja, die technisch brillante Spielweise des jungen deutschen Teams 2010 wird direkt auf die Früchte der Nachwuchsförderung seit 2001 zurückgeführt.
Wie wird die Integration in die erste Mannschaft gemessen?
Die Arbeit analysiert die Einsatzzeiten von Nachwuchsspielern in den Profikadern und kategorisiert diese nach ihrer sportlichen Relevanz.
- Arbeit zitieren
- Adin Beslic (Autor:in), 2012, Die Auswirkungen der Einführung professioneller Jugendzentren im Fussball, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/195063