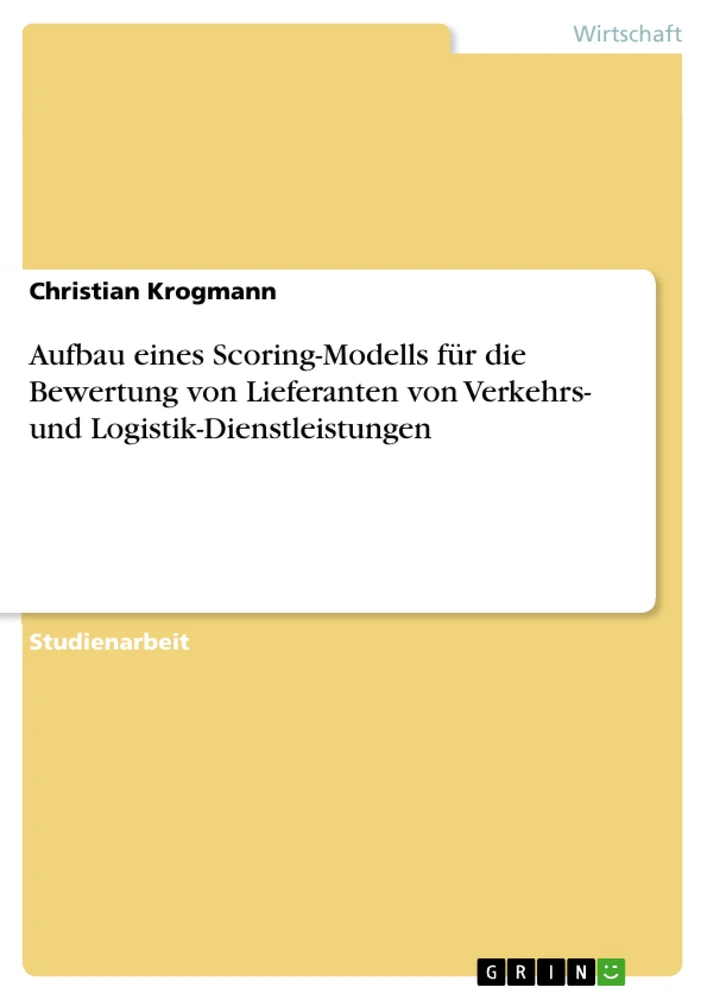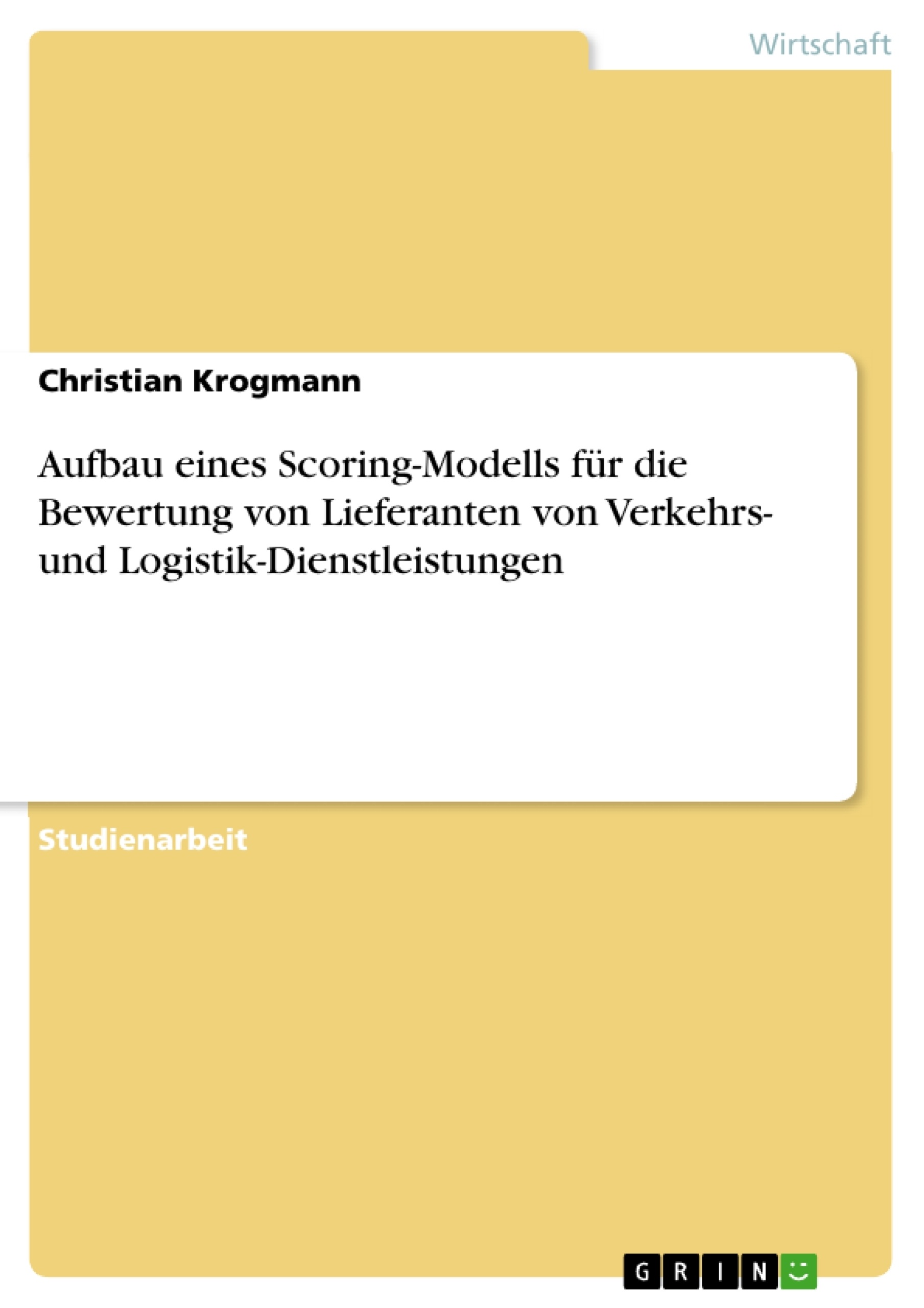Die Globalisierung hat heute weitreichende Auswirkungen auf die Unternehmen und deren Wettbewerb. Unternehmen können sich immer schwieriger nur durch ihre Produkte und deren Qualität einen Vorteil gegenüber anderen verschaffen. Entgegen dieser traditionellen Sichtweise wird heutzutage für diese Unternehmen daher die effiziente Gestaltung ihrer Logistikketten immer wichtiger, um sich dadurch einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Durch die verstärkte Konzentration der Unternehmen auf ihre Kernkompetenzen kommt folglich den Lieferanten eine große Bedeutung zu. Betrachtet man beispielsweise Just-in-time- oder Just-in-sequence-Konzepte, bei denen Waren erst kurz vor dem Bedarfszeitpunkt geliefert werden, stellt man fest, dass Lieferanten mittlerweile eine große Verantwortung bei der Beschaffung tragen. Dies äußert sich beispielsweise dadurch, dass die Beziehungen zwischen Kunden und Lieferanten oftmals durch Abschluss längerfristiger Verträge eingegangen werden. Ein nicht unerheblicher Teil des Beschaffungsrisikos wird dabei auf den Lieferanten abgewälzt. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in weiteren Logistikkonzepten wieder. Exemplarisch seien hier Konzepte wie z. B. das Vendor Managed Inventory (VMI) oder auch das Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment (CPFR) genannt.
Diese gestiegene Bedeutung für die Lieferanten hat zur Folge, dass die beschaffenden Unternehmen systematischer bei der Auswahl der Lieferanten vorgehen (müssen). Diese systematische Vorgehensweise wird in der Praxis als Lieferantenmanagement bezeichnet. Zu Zeiten klassischer Zulieferbeziehungen spielte das Lieferantenmanagement und die damit eng verbundene Bewertung von Lieferanten in vielen Unternehmen keine große Rolle. Hier stand eine oberflächliche, historische und insbesondere oft subjektive Auswahl der Lieferanten im Vordergrund. Mittlerweile ist es jedoch in vielen Unternehmen üblich, dass das Lieferantenmanagement als ein strategischer Erfolgsfaktor angesehen wird. Die Folge davon ist eine eher analytische Betrachtungs- und Handlungsweise bei der Lieferantenauswahl. Voraussetzung für das Betreiben eines professionellen Lieferantenmanagements ist jedoch ein aussagekräftiges und leistungsfähiges Lieferantenbewertungssystem.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Erläuterung wichtiger Begrifflichkeiten für die Lieferantenbewertung
- Lieferantenmanagement und Beschaffung
- Lieferantenanalyse und Lieferantenbeobachtung
- Ziele der Lieferantenbewertung
- Vorstellung der Methodik für die Lieferantenbewertung
- Allgemeine und verfahrensspezifische Anforderungen
- Klassifikation allgemeiner Kriterien
- Einordnung und Vorstellung der Scoring-Methode
- Vor- und Nachteile der Scoring-Methode
- Anwendung der Scoring-Methode auf den Verkehrs- und Logistikbereich
- Vorstellung einer beispielhaften Ausgangssituation
- Umsetzung der Methode
- Auswahl geeigneter Kriterien
- Gewichtung der Kriterien
- Bewertung der Kriterien
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Aufbau eines Scoring-Modells zur Bewertung von Lieferanten im Verkehrs- und Logistikbereich. Ziel ist die Entwicklung eines praktikablen Systems zur systematischen und objektiven Lieferantenauswahl, das den gestiegenen Anforderungen effizienter Logistikketten gerecht wird.
- Lieferantenmanagement und dessen Bedeutung im Kontext der Globalisierung
- Analyse und Bewertung von Lieferanten als strategischer Erfolgsfaktor
- Entwicklung und Anwendung einer Scoring-Methode zur Lieferantenbewertung
- Kriterienauswahl und -gewichtung für ein effektives Scoring-Modell
- Anwendung des Modells im Verkehrs- und Logistiksektor
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die zunehmende Bedeutung effizienter Logistikketten im globalisierten Wettbewerb. Unternehmen konzentrieren sich auf Kernkompetenzen und delegieren Aufgaben an Lieferanten, was zu neuen Herausforderungen im Lieferantenmanagement führt. Die Arbeit legt dar, warum ein professionelles Lieferantenbewertungssystem unerlässlich ist, um Risiken zu minimieren und Wettbewerbsvorteile zu sichern. Die klassische, subjektive Lieferantenauswahl wird als unzureichend dargestellt und die Notwendigkeit einer systematischen, analytischen Vorgehensweise betont.
Erläuterung wichtiger Begrifflichkeiten für die Lieferantenbewertung: Dieses Kapitel beleuchtet zentrale Begriffe des Lieferantenmanagements. Es werden die Konzepte des Lieferantenmanagements und der Beschaffung, die Lieferantenanalyse und -beobachtung, sowie die Ziele der Lieferantenbewertung detailliert erläutert. Der Fokus liegt auf dem Zusammenhang zwischen effizienter Logistik, strategischem Lieferantenmanagement und der Notwendigkeit einer systematischen Lieferantenbewertung. Es werden die Herausforderungen und die Notwendigkeit einer umfassenden Bewertungsmethode beleuchtet.
Vorstellung der Methodik für die Lieferantenbewertung: Dieses Kapitel präsentiert die gewählte Methodik zur Lieferantenbewertung, die Scoring-Methode. Es werden die allgemeinen und verfahrensspezifischen Anforderungen an ein solches System erläutert. Die Klassifizierung allgemeiner Kriterien und die Einordnung der Scoring-Methode werden detailliert beschrieben. Abschließend werden die Vor- und Nachteile der Scoring-Methode gegenübergestellt, um deren Eignung für den Kontext zu belegen.
Anwendung der Scoring-Methode auf den Verkehrs- und Logistikbereich: Dieses Kapitel beschreibt die praktische Anwendung des entwickelten Scoring-Modells im Verkehrs- und Logistikbereich. Es wird eine beispielhafte Ausgangssituation präsentiert und die Umsetzung der Methode Schritt für Schritt erläutert. Die Auswahl geeigneter Kriterien, deren Gewichtung und die Bewertung werden detailliert beschrieben. Das Kapitel zeigt die praktische Anwendung der zuvor erläuterten Theorie.
Schlüsselwörter
Lieferantenbewertung, Scoring-Methode, Lieferantenmanagement, Logistik, Verkehrsbetriebslehre, Beschaffung, Wettbewerbsvorteil, Kriteriengewichtung, Risikomanagement, Effizienz.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Lieferantenbewertung im Verkehrs- und Logistikbereich
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit dem Aufbau eines Scoring-Modells zur Bewertung von Lieferanten im Verkehrs- und Logistikbereich. Ziel ist die Entwicklung eines praktikablen Systems zur systematischen und objektiven Lieferantenauswahl, das den gestiegenen Anforderungen effizienter Logistikketten gerecht wird.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Themen wie Lieferantenmanagement, Beschaffung, Lieferantenanalyse, Lieferantenbeobachtung, Ziele der Lieferantenbewertung, die Scoring-Methode (inkl. Vor- und Nachteile), Kriterienauswahl und -gewichtung, sowie die praktische Anwendung des Modells im Verkehrs- und Logistiksektor. Die Bedeutung effizienter Logistikketten im globalisierten Wettbewerb und die Minimierung von Risiken durch ein professionelles Bewertungssystem werden ebenfalls beleuchtet.
Welche Methodik wird verwendet?
Die Arbeit verwendet die Scoring-Methode zur Lieferantenbewertung. Es werden die allgemeinen und verfahrensspezifischen Anforderungen an ein solches System erläutert, die Klassifizierung allgemeiner Kriterien beschrieben und die Vor- und Nachteile der Scoring-Methode gegenübergestellt.
Wie wird die Scoring-Methode angewendet?
Die praktische Anwendung der Scoring-Methode wird anhand einer beispielhaften Ausgangssituation im Verkehrs- und Logistikbereich Schritt für Schritt erläutert. Dies beinhaltet die Auswahl geeigneter Kriterien, deren Gewichtung und die Bewertung der Kriterien.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Lieferantenbewertung, Scoring-Methode, Lieferantenmanagement, Logistik, Verkehrsbetriebslehre, Beschaffung, Wettbewerbsvorteil, Kriteriengewichtung, Risikomanagement und Effizienz.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Erläuterung wichtiger Begrifflichkeiten für die Lieferantenbewertung, ein Kapitel zur Vorstellung der Methodik (Scoring-Methode), ein Kapitel zur Anwendung der Methode im Verkehrs- und Logistikbereich und eine Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Zusammenfassung der behandelten Inhalte.
Was ist das Ziel der Lieferantenbewertung?
Das Ziel der Lieferantenbewertung ist die Entwicklung eines praktikablen Systems zur systematischen und objektiven Lieferantenauswahl, um den gestiegenen Anforderungen effizienter Logistikketten gerecht zu werden, Risiken zu minimieren und Wettbewerbsvorteile zu sichern.
Warum ist eine systematische Lieferantenbewertung wichtig?
Eine systematische Lieferantenbewertung ist wichtig, um die klassische, subjektive Lieferantenauswahl zu überwinden und eine objektive, analytische Vorgehensweise zu gewährleisten. Dies trägt zur Minimierung von Risiken und zur Sicherung von Wettbewerbsvorteilen bei.
- Quote paper
- Christian Krogmann (Author), 2011, Aufbau eines Scoring-Modells für die Bewertung von Lieferanten von Verkehrs- und Logistik-Dienstleistungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/195079