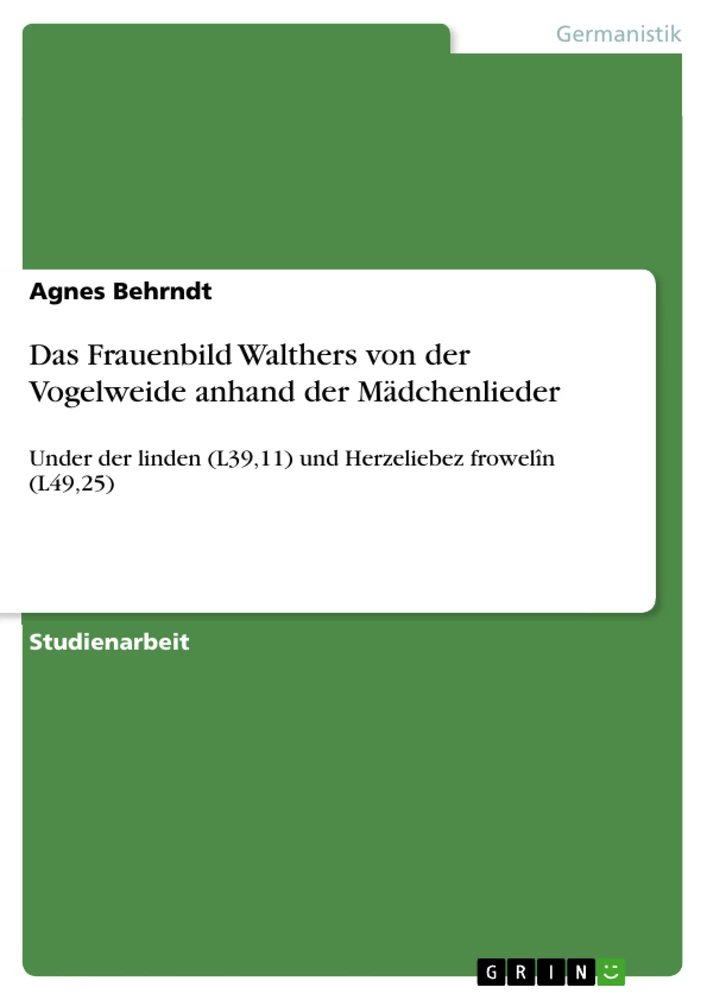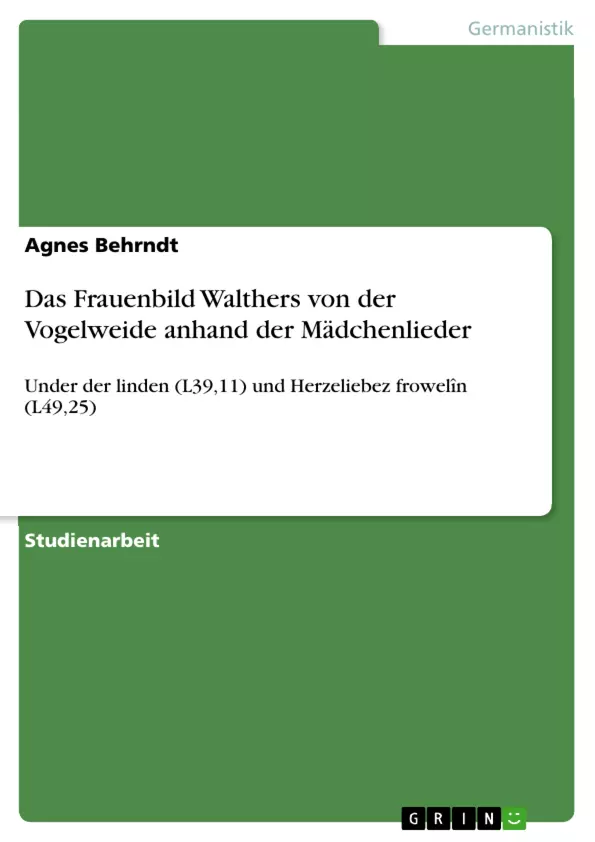Inhalt
1.Einführung
1.1.Minnesang
1.2.Mädchenlieder 2.Walther von der Vogelweide
2.1.Walthers Werk und Minneverständnis
2.2.Walthers Frauenbild
3.Walthers Mädchenlieder
3.1.Under der linden (L39,11)
3.2.Herzeliebez frowelîn (L49,25)
4.Schlussbetrachtung
1. Einführung
Diese Arbeit entsteht im Rahmen eines von Herrn Prof. Dr. Friedrich gehaltenen Hauptseminars zum Thema Minnesang an der EMAU Greifswald im Wintersemester 2005/2006. Im Verlauf des Seminars referierten zwei Mitstudentinnen und ich zu den Mädchenliedern Walthers von der Vogelweide. In den folgenden Ausführungen möchte ich mich auf die eindeutigen seiner Mädchenlieder beschränken. Näher erläutert wird das Frauenbild Walthers anhand der Lieder Under der linden (L39,11) und Herzeliebez frowelîn (L49,25). Aufgrund der umfangreichen Textarbeit an L39,11 und L49,25 verzichte ich auf die Bearbeitung des Tanzliedes Nemt, frowe, disen kranz (L74,20). In der Forschung gelten die Text-Editionen Lachmann-Kraus’ zu Walthers Werk als richtungweisend. Im Laufe der Jahre wurden viele der Fakten widerlegt. Ich stütze mich in dieser Arbeit auf gängige Literatur dreier Mediävisten: mit Günther Schweikle allgemein zum Minnesang, Gerhard Hahn und Hugo Kuhn speziell zu Walther von der Vogelweide. Zur näheren Betrachtung der einzelnen Mädchenlieder ziehe ich verschiedenste wissenschaftliche Aufsätze von unterschiedlicher Aktualität hinzu. Ich orientiere mich dabei stark an einer wissenschaftlichen Arbeit von Martina Böseneilers zu den Mädchenliedern in der Minnekonzeption Walthers von der Vogelweide aus dem Jahre 1988. Als kritisches Gegenstück gängiger Forschungen steht Achim Massers Aufsatz von 1989 „Zu den sogenannten ‚Mädchenliedern’ Walthers von der Vogelweide“.
Inhalt
1. Einführung
1.1. Minnesang
1.2. Mädchenlieder
2. Walther von der Vogelweide
2.1. Walthers Werk und Minneverständnis
2.2. Walthers Frauenbild
3. Walthers Mädchenlieder
3.1. Under der linden (L39,11)
3.2. Herzeliebez frowelîn (L49,25)
4. Schlussbetrachtung
- Citation du texte
- Agnes Behrndt (Auteur), 2006, Das Frauenbild Walthers von der Vogelweide anhand der Mädchenlieder , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/195098