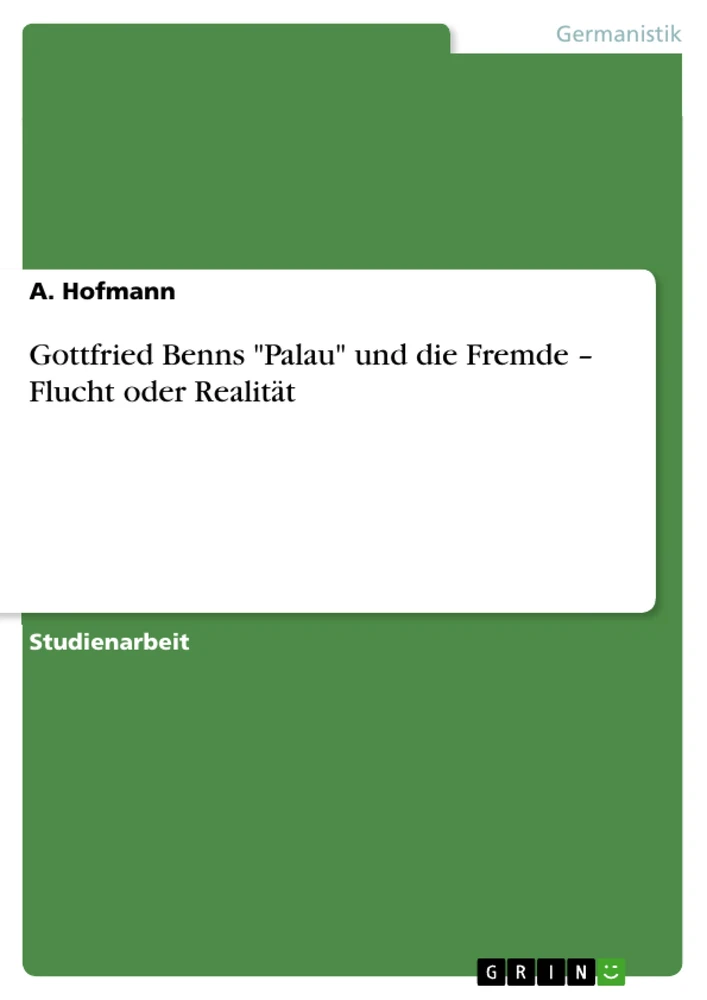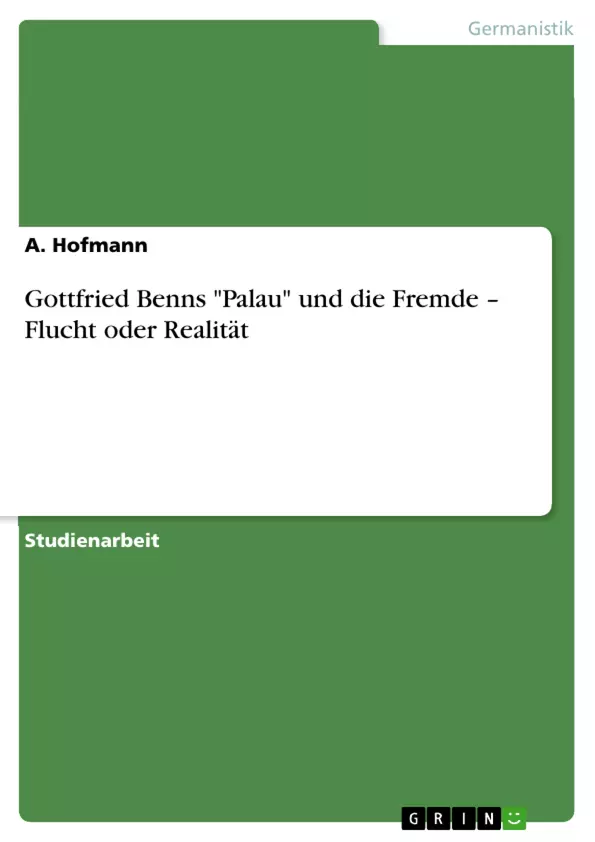Diese Arbeit entsteht im Rahmen eines von Herrn Prof. Dr. Erhart gehaltenen Seminars zur Lyrik des 20.Jahrhunderts mit Schwerpunkt auf Gottfried Benn, Bert Brecht und Paul Celan an der EMAU Greifswald im Wintersemester 2005/6. Zur Betrachtung kommt hier ein Gedicht namens Palau von Gottfried Benn. Palau zählt zu den frühen Gedichten Benns, der ja bis zu seinem Tode im Jahr 1956 tätig war. Benns lyrisches Werk steht stets im Vordergrund der Betrachtungen. Unter den verschiedenen Gesichtspunkten soll Benns Selbstdeutung ein wenig vernachlässigt werden. Benn gilt als bedeutender Dichter der literarischen Moderne. Nicht zuletzt seine theoretischen Abhandlungen über Expressionismus und Nihilismus vermitteln das Bild eines Universalgenies, jedoch immer mit dem Untertitel ‚Reisender zwischen zwei Welten’. Mit Hilfe verschiedener Texte unterschiedlicher Aktualität möchte ich nicht versuchen, das Wesen des Gedichtes Palau offen zu legen, sondern mich lediglich einer versuchten Deutung annähern.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Entstehung / Namensfindung / Leben
- Fragestellungen / Betrachtungen
- Betrachtung zur Fremde
- Das Gedicht
- Inhalt / Begriffsklärung
- Deutungen aus der Fachliteratur
- Schlussbetrachtung / Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Gedicht „Palau“ von Gottfried Benn, einem frühen Werk des Dichters, und analysiert dessen Entstehung, Inhalt und Bedeutung. Ziel ist es, das Gedicht im Kontext von Benns Werk und seiner Zeit zu betrachten und seine Bedeutung im Hinblick auf seine Thematik der Fremde zu verstehen.
- Benns Schaffen im Kontext der literarischen Moderne
- Die Bedeutung des Gedichts „Palau“ für Benns Werk
- Die Thematik der Fremde in „Palau“
- Benns Selbstverständnis als Dichter und Arzt
- Die Rolle von Exotik und Reise in Benns Lyrik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Leben und Werk von Gottfried Benn sowie der Entstehungsgeschichte des Gedichts „Palau“. In Kapitel 1.1 wird der Entstehungskontext des Gedichts beleuchtet, wobei die Bedeutung von Benns Reisen, seinen literarischen Einflüssen und seiner Doppelleben als Arzt und Künstler hervorgehoben werden. In Kapitel 1.2 werden die zentralen Fragestellungen der Arbeit vorgestellt, die sich mit der Deutung des Gedichts und der Bedeutung der Fremde in Benns Werk auseinandersetzen. Der Fokus liegt auf Benns Suche nach Identität, seiner Weltsicht und seiner künstlerischen Ausdrucksweise.
Kapitel 2 befasst sich mit dem Gedicht „Palau“ selbst. Kapitel 2.1 analysiert den Inhalt des Gedichts, indem es auf die zentralen Motive, Bilder und sprachlichen Mittel eingeht. Kapitel 2.2 widmet sich der Interpretation des Gedichts und bezieht dabei verschiedene Deutungen aus der Fachliteratur ein. Die Analyse zeigt, dass Benn in „Palau“ ein komplexes Bild der Fremde zeichnet, das sich sowohl auf die geografische Distanz als auch auf die innere Distanz zu sich selbst bezieht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse des Gedichts „Palau“ von Gottfried Benn und untersucht dessen Bedeutung im Kontext von Benns Werk und seiner Zeit. Zentrale Schlüsselbegriffe sind: Gottfried Benn, Palau, Lyrik, Moderne, Expressionismus, Fremde, Exotik, Reise, Identität, Selbstverständnis, Kunst, Arzt, Nihilismus.
- Quote paper
- A. Hofmann (Author), 2006, Gottfried Benns "Palau" und die Fremde – Flucht oder Realität, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/195101