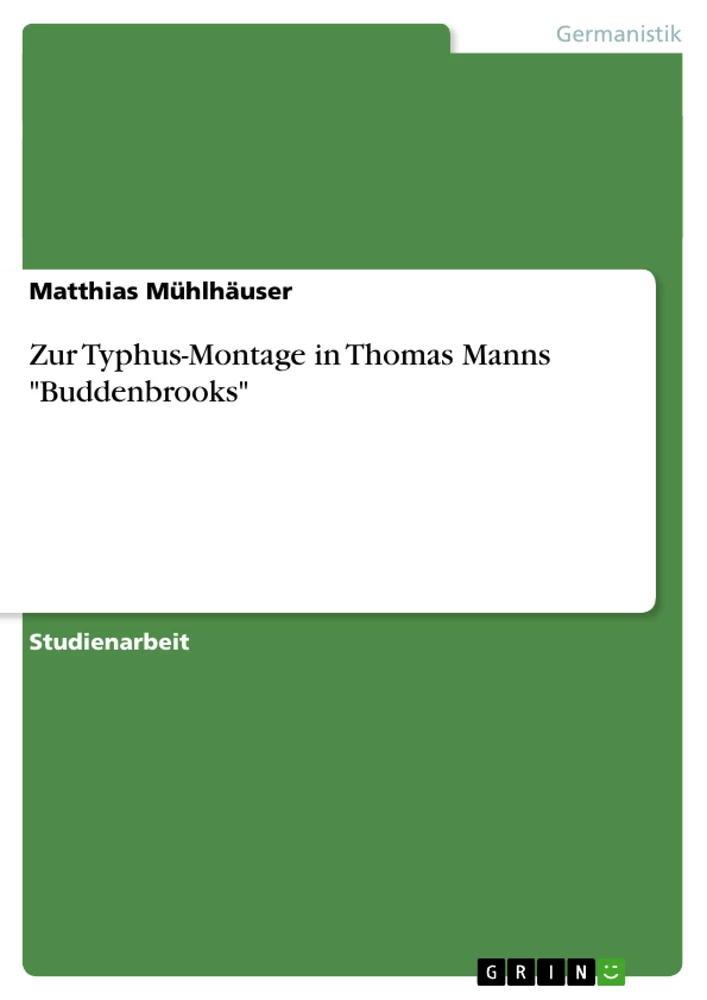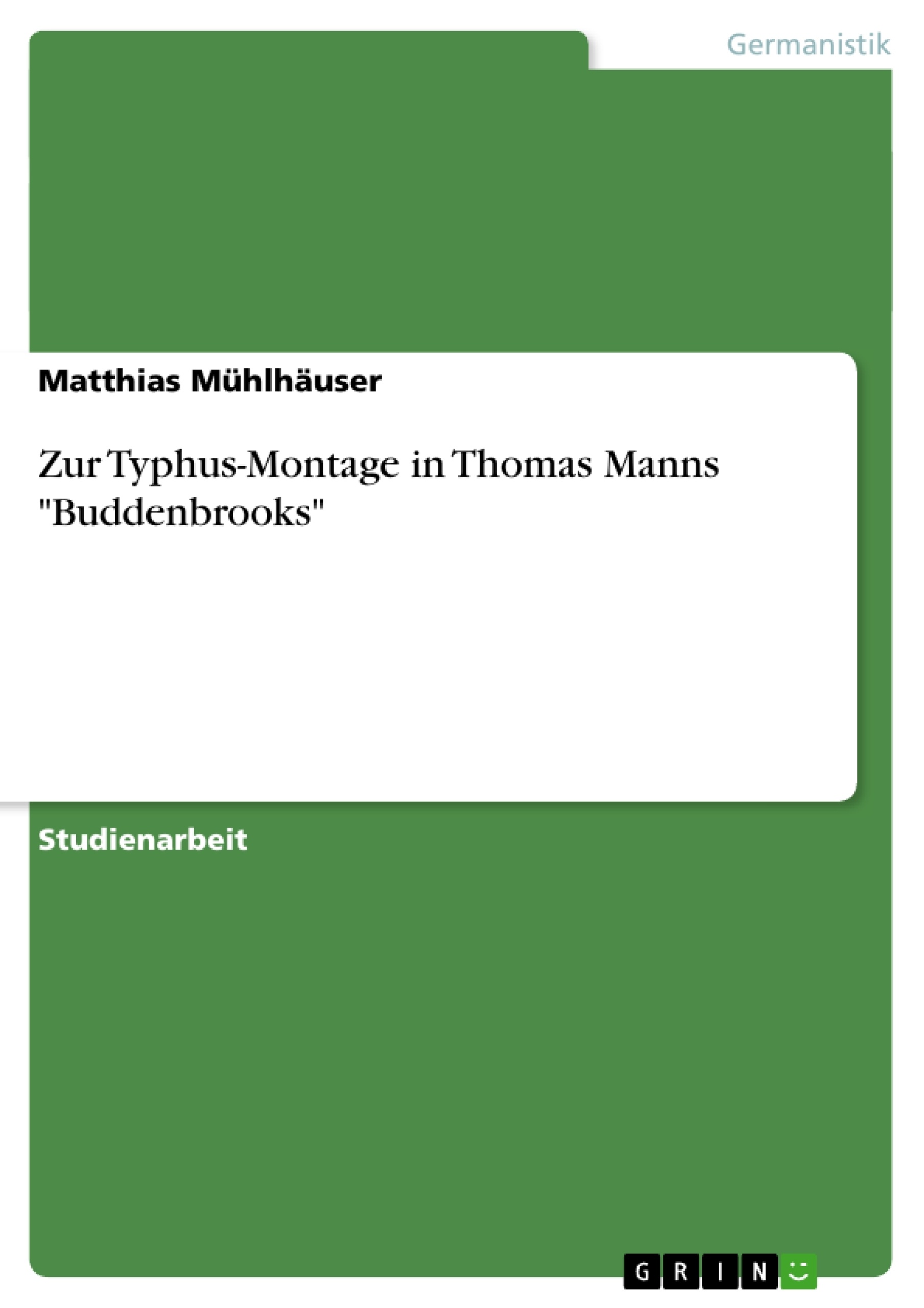Seit ihren Ursprüngen besteht die Literatur aus Abschreiben. Während bereits die antiken Dramen als eine fixierte Konfiguration ihrer Mythen gelten müssen, stellen schon die ältesten überlieferten mittelalterlichen Texte nichts anderes als eine Verschriftlichung von zuvor unfixierten und mündlich überlieferten Erzählungen dar. Als Sonderform intertextueller Verfahren erscheint die Montage
als ein allgemeines Merkmal von Textualität, da sie von einem Textbegriff ausgeht, der nicht nur literarische, sondern auch alle anderen Textsorten bis hin zur gesprochenen Alltagssprache umfasst. Jeder Text ist somit nur noch als Bestandteil eines Universums von Texten denkbar, in dem das gesamte soziokulturelle und semiotische Wissen zirkuliert. Bestandteil dieses soziokulturellen Wissens sind auch Kenntnisse und Diskurse benachbarter und anderer wissenschaftlichen Disziplinen wie im Falle der Typhus-Montage der zeitgenössische medizinische Wissensstand, der sich auf den normierten Krankheitsverlauf eines an Typhus erkrankten Patienten bezieht. Das Neue an jener Form literarischer Montage nennt Thomas Mann Amplifikation und meint das Finden im Gegensatz zum Auffinden. Die Geschlossenheit, doch auch die Originalität des literarischen Kunstwerks wird nun partiell aufgehoben. Dem montierten Teil wird eine neue Bedeutung zugewiesen, die Verweisfunktionen der Zeichen einem neuen Objekt zugeordnet, indessen aber die ursprüngliche Bedeutung erhalten bleibt. Durch die Montage „erscheint Wirklichkeit in ihren unvereinbaren Widersprüchen; der idealistische Begriff einer Repräsentierbarkeit essentieller Wirklichkeit ist aufgekündigt“ .
INHALTSVERZEICHNIS
1. Intertextualität und Montage
2. Krankheit als Verfallsprinzip
3. Die „Typhus-Montage“ in Buddenbrooks
Literaturverzeichnis
„Im Grunde aber sind wir alle collective Wesen wir mögen uns stellen wie wir wollen. Denn wie Weniges haben und sind wir das wir im reinsten Sinne unser Eigentum nennen! Wir müssen alle empfangen und lernen, sowohl von denen die vor uns waren als von denen die mit uns sind. Selbst das größte Genie würde nicht weit kommen, wenn es alles seinem eigenen Innern verdanken wollte. " [1]
Johann Wolfgang Goethe
1. Intertextualität und Montage
Seit ihren Ursprüngen besteht die Literatur aus Abschreiben. Während bereits die antiken Dramen als eine fixierte Konfiguration ihrer Mythen gelten müssen, stellen auch die ältesten überlieferten mittelalterlichen Texte nichts anderes als eine Verschriftlichung von zuvor unfixierten und mündlich überlieferten Erzählungen dar. Nachdem der Mensch längst sesshaft geworden ist, reisen fahrende Sänger mit Mythen und Geschichten im Gepäck noch lange von Ort zu Ort. Erst als die Autoren des Mittelalters das Gehörte erstmals aufschreiben, findet die Literatur ihre Heimat im Buch, doch bleibt sie im Gegensatz zum Menschen nicht sesshaft, da schon die ersten Zeugnisse der Schriftlichkeit alsbald abgeschrieben werden. Die Geschichte des Gralsritters Parzival erscheint um 1180 im Perceval des Chrétien de Troyes und findet ihren berühmtesten Niederschlag in Wolframs von Eschenbach Parzival (um 1210). Das Abschreiben setzt sich über Jahrhunderte hinweg fort, immer wieder modernisierenden Modifikationen unterworfen, so in Richard Wagners Oper Parsifal (1882) oder in Adolf Muschgs Bearbeitung des Stoffes unter dem Titel Der rote Ritter (1993). Der Autor des Parzival als „eine moderne Figur, die unsere Gesellschaft hervorbrachte, als sie am Ende des Mittelalters [...] den Wert des Individuums entdeckte“ [2] lässt sich als menschliche Person schwerlich entziffern oder fassen; es „verliert die Stimme ihren Ursprung, stirbt der Autor, beginnt die Schrift“ [3].
Als Sonderform intertextueller Verfahren erscheint die Montage als ein allgemeines Merkmal von Textualität, da sie von einem Textbegriff ausgeht, der nicht nur literarische, sondern auch alle anderen Textsorten bis hin zur gesprochenen Alltagssprache umfasst. Jeder Text ist somit nur noch als Bestandteil eines Universums von Texten denkbar, in dem das gesamte soziokulturelle und semiotische Wissen zirkuliert. [4]
Bestandteil dieses soziokulturellen Wissens sind auch Kenntnisse und Diskurse benachbarter und anderer wissenschaftlichen Disziplinen wie im Falle der Typhus-Montage der zeitgenössische medizinische Wissensstand, der sich auf den normierten Krankheitsverlauf eines an Typhus erkrankten Patienten bezieht. In der arbeitsteiligen Industriekultur, welcher er entnommen ist, bezieht sich der Begriff Montage auf hoch definierte Teile, die an einer bestimmten Stelle passen müssen. Das Neue an jener Form literarischer Montage nennt Thomas Mann Amplifikation und meint das Finden im Gegensatz zum Auffinden. Die Geschlossenheit, doch auch die Originalität des literarischen Kunstwerks wird nun partiell aufgehoben. Dem montierten Teil wird eine neue Bedeutung zugewiesen, die Verweisfunktionen der Zeichen einem neuen Objekt zugeordnet, indessen aber die ursprüngliche Bedeutung erhalten bleibt. Durch die Montage „erscheint Wirklichkeit in ihren unvereinbaren Widersprüchen; der idealistische Begriff einer Repräsentierbarkeit essentieller Wirklichkeit ist aufgekündigt“ [5] .
2. Krankheit als Verfallsprinzip
Thomas Manns Roman Buddenbrooks mit dem bezeichnenden Untertitel Verfall einer Familie zeichnet den sukzessiven Untergang einer Kaufmannsdynastie insbesondere anhand verschiedener Krankheitserscheinungen und deren Verlaufsformen nach. Der Roman beginnt mit dem Untergang der Familie Ratenkamp, der es auf der Höhe ihres Erfolgs und Ansehens nicht minder gut geht wie den Buddenbrooks auf der ihren und am Ausgang der Handlung der Familie Hagenström. So setzt sich ein Modell von Aufgang und Untergang gleichsam Ring für Ring und Kreis für Kreis unaufhaltsam fort. Solcherart familiäre Dekadenz erweist sich schon bald eingebettet in eine von unmittelbarem Niedergang gezeichnete und dadurch um so fragwürdigere bürgerlich-kapitalistische Gesellschaftsform wilhelminischer Prägung, die allem Anschein nach ihre verbreiteten Krankheitssymptome bis in ihre Substanz und Keimzelle, die Familie, hinein trägt. Krankheit ist damit Symbol und Metapher mit mehr oder minder virulenten Ausprägungen in den Elementen der Handlung und ihrer Menschen, deren Umgangsformen nicht nur bei Tisch, deren Erscheinungsbildern, Floskeln der Rede, Verzerrung der Sprache vom disharmonischen Vokaltausch über die Silbenverschleifung bis hin zum Zusammenbruch der syntaktischen Struktur. Ihre pathologischen Ausläufer finden ihren Niederschlag im wiederkehrenden Zahnmotiv („Zeichen ungebrochener Lebenskraft ist in den >Buddenbrooks< ein intaktes, starkes Gebiß“ [6] ), im Typhus-Motiv des kleinen Hanno, endlich im Prozess des Sterbens der Protagonisten und in deren Tod.
Ausgenommen von diesem Prozess bleiben am Ende nur jene, die ihre Individualität bereits mehr oder minder eingebüßt hatten. Alleine acht Frauen verbleiben dem dynastischen Torso: die weltentrückte, von frigider Morbidität gezeichnete Gerda, deren „aparte Erscheinung nicht viel biologische Tüchtigkeit versprach“ [7] , das alleine durch seine bizarre Aussprache und haushälterischen Eigenschaften in Erscheinung tretende Fräulein Weichbrodt, Frau Permaneder, die „mit kindlichem Ernst, kindlicher Wichtigkeit und - vor Allem - kindlicher Widerstandsfähigkeit“ (Sechster Teil, Achtes Kapitel, 406) selbst dem Ende noch widersteht sowie deren Tochter Erika, ferner Klothilde, um die bereits bei dessen erstem Besuch „Herr Grünlich sich nicht im Geringsten bekümmert“ (Dritter Teil, Erstes Kapitel, 108) und deren hervorstechendes Merkmal in ihrer Sanftheit besteht, schließlich „den drei Damen Buddenbrook aus der Breitenstraße“ (Elfter Teil, 4. Kapitel, 832), im Vollzug ihrer Anonymität nur noch zur Erwähnung bestimmt. Er scheint, als habe die Indifferenz der acht Frauen diese letztlich selbst vor der Individualität eines Krankheitsverlaufs bewahrt.
Wenn somit Thomas Mann das Ver-enden seiner Protagonisten mit einer zuvor erfolgten Konturisierung ihrer Persönlichkeiten verklammert, werden diese physischen Verfallsprozesse mit Hilfe der Montagetechnik wieder entpersonalisiert. Mit der Vollendung seiner Geburt beginnt der Mensch nun nicht mehr seine Bemühungen zu sterben. „Das faktische Dasein existiert gebürtig, und gebürtig stirbt es auch schon im Sinne des Seins zum Tode“ [8] als Heideggers große Formel der 1920er Jahre ist als Diktum nun außer Kraft gesetzt, wenn der Tod es ist, der den Menschen ereilt. Wenn hier der Eindruck entsteht, der Mensch sei nur zum Leiden da, so liegt dies an Thomas Manns radikaler Elimination der Autonomie des Individuums.
[...]
[1] Johann Peter Eckermann: Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens. Nach dem ersten Druck, dem Originalmanuskript des dritten Teils und Eckermanns handschriftlichem Nachlaß neu herausgegeben von Professor Dr. H. H. Houben. Vierundzwanzigste Originalauflage, Wiesbaden 1949, S. 610.
[2] Roland Barthes: Der Tod des Autors. In: Texte zur Theorie der Autorschaft, hgg. von Fotis Jannidis, Gerhard Lauer u.a., Stuttgart 2007, S. 186.
[3] Ebd., S. 185.
[4] Kerstin Schmitt: Intertextualitätsmodelle. In: dies.: Poetik der Montage. Figurenkonzeption und Intertextualität in der „Kudrun“, Berlin 2002, S. 54 f.
[5] Hans-Ulrich Simon: Zitat. In: Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte. Begründet von Paul Merker und Wolfgang Stammler. 5 Bände. Bd. 3: SL-Z, Berlin-New York 2001, S. 1053 f.
[6] Ernst Keller: Symptome des Verfalls. In: Buddenbrooks-Handbuch, hgg. von Ken Moulden und Gero von Wilpert, Stuttgart 1988, S. 164.
[7] Hellmuth Petriconi: Das Reich des Untergangs. Bemerkungen über ein mythologisches Thema, Heidelberg 1958, S. 159.
[8] Martin Heidegger: Sein und Zeit. Fünfzehnte, an Hand der Gesamtausgabe durchgesehene Auflage mit den Randbemerkungen aus dem Handexemplar des Autors im Anhang, Tübingen 1979, S. 374.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „Montage“ in der Literatur von Thomas Mann?
Montage bezeichnet das Einfügen von Sachtexten oder fremden Diskursen (z. B. medizinischen Fakten) in das literarische Werk, um Realität abzubilden.
Was ist die „Typhus-Montage“ in den „Buddenbrooks“?
Thomas Mann montierte den medizinisch exakten Krankheitsverlauf von Typhus in die Beschreibung des Sterbens des kleinen Hanno Buddenbrook.
Welche Rolle spielt Krankheit im Roman?
Krankheit fungiert als Symbol für den physischen und moralischen Verfall der Kaufmannsfamilie über vier Generationen hinweg.
Was versteht Thomas Mann unter „Amplifikation“?
Er meint damit das „Finden“ von bereits existierendem Material und dessen künstlerische Erweiterung und Neuzuordnung im Text.
Warum wird das Zahnmotiv im Roman oft erwähnt?
Ein gesundes Gebiss gilt im Roman als Zeichen ungebrochener Lebenskraft; der Verfall der Zähne spiegelt somit den biologischen Niedergang der Familie wider.
- Arbeit zitieren
- M.A. Matthias Mühlhäuser (Autor:in), 2009, Zur Typhus-Montage in Thomas Manns "Buddenbrooks", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/195110