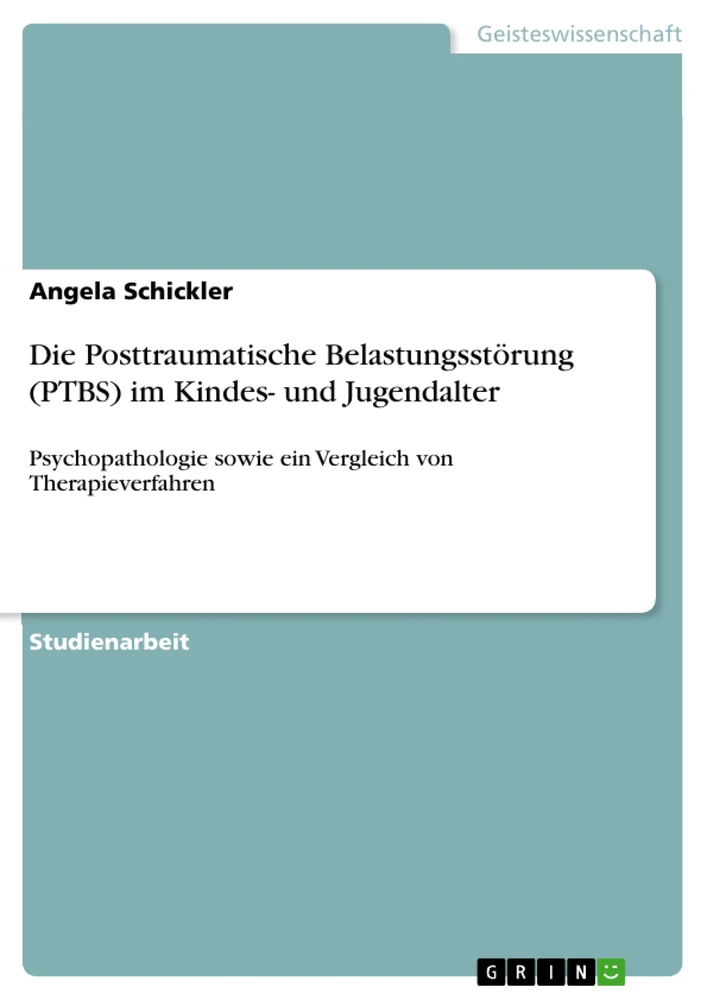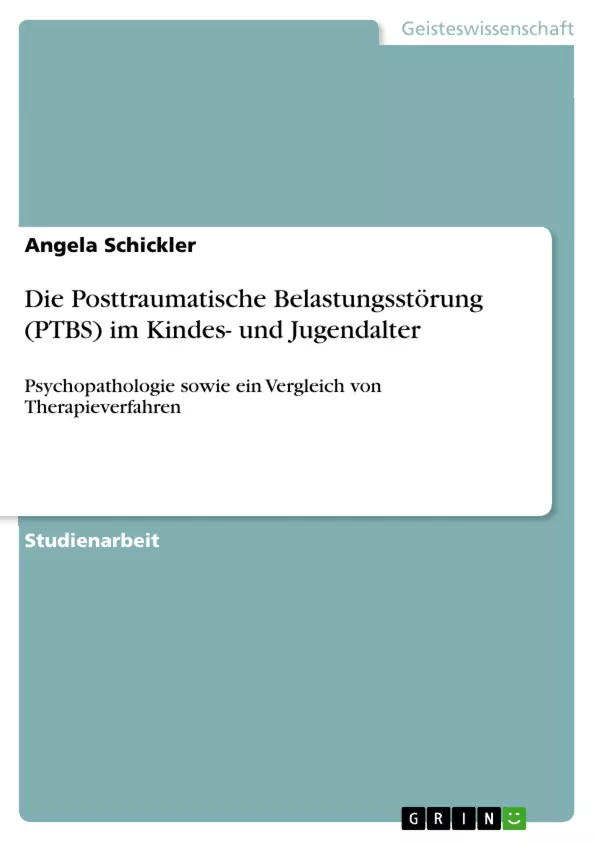Das Ausmaß von Trauma-Ereignissen, ob bei Kindern, Jugendlichen, oder Erwachsenen, ist weit gefasst. Es reicht von körperlicher und sexualler Gewalt über Unfälle und lebensbedrohliche Erkrankungen bis hin zu Naturkathastrophen. Viele Menschen, die ein solches Ereignis erleben, oder Zeugen davon werden, erleben im Anschluss Symptome wie zum Beispiel ungewollte Erinnerungen an das Ereignis, Schreckhaftigkeit oder die Vermeidung von Trauma assoziierten Stimuli. Oftmals sind solche Symptome nur vorübergehend vorhanden, bei einigen Betroffenen können sie jedoch dauerhaft auftreten. Unter Umständen kann es dabei zur Entwicklung einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) kommen (Weinberg, 2011, S. 24).
Folgende Hausarbeit führt zunächst in das Thema Traumata und Traumafolgestörungen, insbesondere der PTBS im Kindes- und Jugendalter ein. Dazu werden Definition, Symptomatik und Klassifikation, Komorbiditäten, Diagnostik und Differenzialdiagnostik, Epidemiologie, Verlauf, und Ätiologie als theoretische Grundlagen der PTBS im Kindes- und Jugendalter dargestellt. Ziel dieser Arbeit ist, die Besonderheiten der Patientengruppe von Kindern und Jugendlichen bezüglich dieser Thematik herauszuarbeiten.
Es folgt eine Darstellung sowie eine anschließende Bewertung von psychotherapeutischen Verfahren zur Behandlung der PTBS im Kindes- und Jugendalter. Dabei werden die theoretische Fundierung, die Rahmenbedingungen, sowie die Studienlage zur Wirksamkeit thematisiert.
Die beiden evidenzbasierten Traumatherapieverfahren – die Trauma-fokussierte kognitiv-behaviorale Therapie (TF-KBT) und das Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) für Kinder und Jugendliche – werden genauer beleuchtet. Ferner wird die traumazentrierte Spieltherapie (tSt) als ein Verfahren, welches sich insbesondere in der Praxis mit Kindern bewährt hat, vorgestellt. Darüber hinaus wird auf die Narrative Expositionstherapie für Erwachsene (NET) und Kinder (KIDNET), die Psychodynamische Imaginative Traumatherapie für Erwachsene (PITT) und Kinder (PITT-KID) sowie auf die Mehrdimensionale Psychodynamische Traumatherapie für Erwachsene (MPTT) und für Kinder und Jugendliche (MPTT-KJ) eingegangen. In der Diskussion wird die Frage nach einer vergleichenden Analyse im Fokus stehen. Dabei werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Therapieverfahren erörtert. Abschließend erfolgt eine Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse dieser Arbeit und es wird ein Ausblick gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Psychopathologie
- Definition
- Symptomatik und Klassifikation
- Komorbiditäten
- Diagnostik und Differenzialdiagnostik
- Epidemiologie, Verlauf und Prognosen
- Ätiologie
- Traumatherapieverfahren
- Trauma-fokussierte kognitiv-behaviorale Therapie (TF-KBT)
- Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
- Traumazentrierte Spieltherapie (tSt)
- Narrative Expositionstherapie (NET) – für Kinder (KIDNET)
- Psychodynamisch Imaginative Traumatherapie (PITT) – für Kinder (PITT-KID)
- Mehrdimensionale psychodynamische Traumatherapie (MPTT)
- Vergleich der Therapieverfahren
- Gemeinsamkeiten
- Unterschiede
- Ergebnisse, Diskussion, Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) im Kindes- und Jugendalter. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis der psychopathologischen Grundlagen, der Diagnostik und der verschiedenen Therapieverfahren zu vermitteln. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf die spezifischen Herausforderungen bei der Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit PTBS gelegt.
- Definition und Symptomatik der PTBS im Kindes- und Jugendalter
- Komorbiditäten und Differenzialdiagnostik
- Trauma-fokussierte Therapieverfahren für Kinder und Jugendliche
- Vergleich und Bewertung verschiedener Therapieansätze
- Aktuelle Forschungsbefunde und zukünftige Herausforderungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz der PTBS im Kindes- und Jugendalter sowie den Aufbau der Arbeit erläutert. Das zweite Kapitel befasst sich ausführlich mit der Psychopathologie der PTBS. Hier werden die Definition, Symptomatik, Klassifikation, Komorbiditäten, Diagnostik, Epidemiologie, Verlauf, Prognosen und Ätiologie der PTBS detailliert dargestellt. Das dritte Kapitel widmet sich verschiedenen Trauma-Therapieverfahren, die im klinischen Alltag Anwendung finden. Die einzelnen Verfahren wie die trauma-fokussierte kognitiv-behaviorale Therapie (TF-KBT), Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), traumazentrierte Spieltherapie (tSt), Narrative Expositionstherapie (NET) – für Kinder (KIDNET), Psychodynamisch Imaginative Traumatherapie (PITT) – für Kinder (PITT-KID) und Mehrdimensionale psychodynamische Traumatherapie (MPTT) werden hinsichtlich ihrer theoretischen Grundlagen, ihrer methodischen Vorgehensweise und ihrer Wirksamkeit erläutert.
Im vierten Kapitel werden die verschiedenen Therapieverfahren miteinander verglichen. Dabei werden sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede der einzelnen Therapieansätze aufgezeigt. Dieses Kapitel dient dazu, einen Überblick über die verschiedenen Therapieoptionen zu geben und den klinischen Alltag zu unterstützen.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themenfeldern der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) im Kindes- und Jugendalter. Zu den wichtigsten Schlüsselbegriffen zählen Trauma, Psychopathologie, Diagnostik, Trauma-Therapie, kognitive Verhaltenstherapie, EMDR, Spieltherapie, Narrative Expositionstherapie, psychodynamische Traumatherapie, Vergleich der Therapieverfahren, Evidenzbasierte Therapie.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die typischen Symptome einer PTBS bei Kindern?
Typisch sind ungewollte Erinnerungen (Flashbacks), Schreckhaftigkeit, Vermeidung von Reizen und emotionale Taubheit.
Welche evidenzbasierten Therapieverfahren werden vorgestellt?
Die Arbeit beleuchtet insbesondere die Trauma-fokussierte kognitiv-behaviorale Therapie (TF-KBT) und EMDR für Kinder und Jugendliche.
Was ist das Besondere an der traumazentrierten Spieltherapie (tSt)?
Sie hat sich in der Praxis bewährt, um jüngeren Kindern einen spielerischen Zugang zur Verarbeitung belastender Erlebnisse zu ermöglichen.
Welche Rolle spielen Komorbiditäten bei der Diagnose?
PTBS tritt oft zusammen mit anderen Störungen wie Depressionen oder Angststörungen auf, was die Diagnostik und Differenzialdiagnostik komplex macht.
Was sind KIDNET und PITT-KID?
Es handelt sich um speziell für Kinder adaptierte Versionen der Narrativen Expositionstherapie (KIDNET) und der Psychodynamisch Imaginativen Traumatherapie (PITT-KID).
- Quote paper
- Bachelor of Arts Angela Schickler (Author), 2012, Die Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) im Kindes- und Jugendalter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/195127