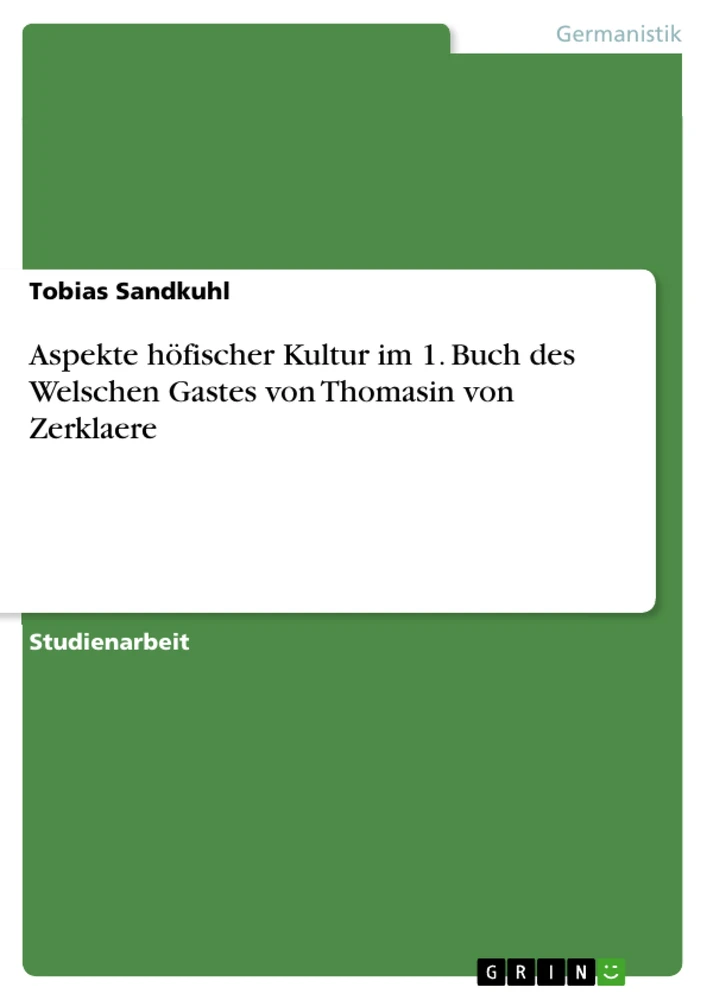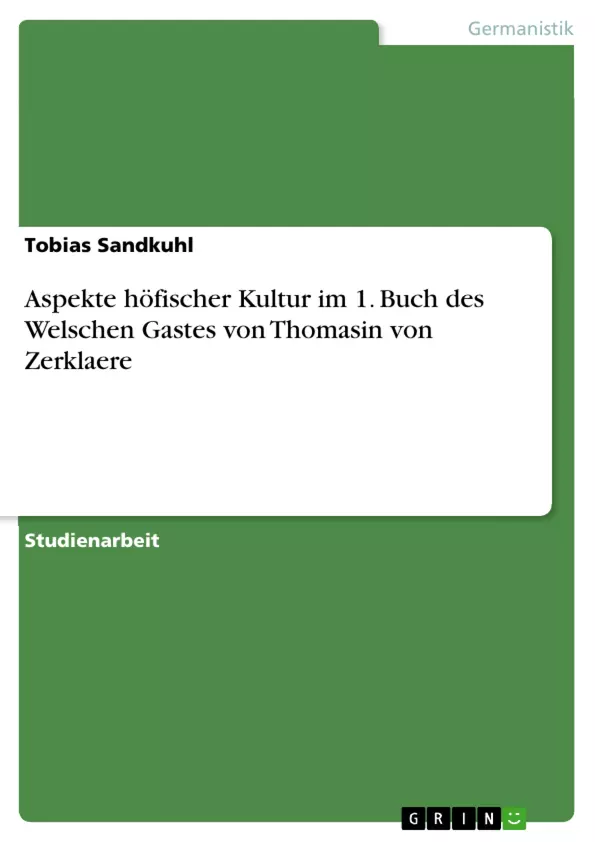„der zühte lêre gewant sol gar / von sîme gebote sîn einvar.“ (V.37-38) Diese Zeilen schreibt Thomasin von Zerklaere in der Einleitung seines Buches: „Der welsche Gast“. Mit diesen Worten gibt er den Inhalt, die Richtung und den Zweck seines Werkes vor. Der Leser erfährt hier, dass es sich um ein didaktisches Werk handelt, bei dem allein die Lehre und nicht Worte zählen. Klarheit ist wichtiger als Form und Kunst. Geschickt nimmt er so potentiellen Kritikern den Wind aus den Segeln. Was die germanistische Forschung nicht davon abgehalten hat, das Werk aufgrund seiner mangelnden Kunstfertigkeit weitgehend mit Missachtung zu strafen. Deutlich wird das in der Problematik der Edition(en). Bis 2004 Eva Willms zumindest Teile des Textes neu editiert und übersetzt hat, war die einzig anerkannte Textgrundlage die von Heinrich Rückert, erschienen 1852. In den 70er und 80er Jahren erschien eine Edition von F.W. von Kries, die allerdings von der Forschung wenig positiv aufgenommen wurde. Die Problematik der Textgrundlage werde ich deshalb im ersten Kapitel dieser Arbeit noch etwas näher erläutern.
Im Gegensatz zu zahlreichen anderen mittelhochdeutschen Texten lässt sich der „Welsche Gast“ recht gut datieren, da Thomasin selbst in seinem Werk entsprechende Angaben macht. Der Text entstand 1215/16 (vgl. V. 11717, 12228) und der Autor ist zu dieser Zeit noch keine 30 Jahre alt (s. V. 2445). Der welsche Gast ist in 10 Bücher eingeteilt, wobei dem ersten Buch ein Prolog vorangestellt ist. Insgesamt enthält der welsche Gast fast 14800 Verse.
Für das Erkenntnisziel dieser Arbeit ist besonders das erste Buch interessant, da Thomasin hier wichtige Aspekte der Hof-Kultur seiner Zeit nennt bzw. Anleitung zum richtigen höfischen Verhalten gibt. Der zentrale Begriff dieses ersten Buches ist ‚höfisch’. Diesen so wichtigen Begriff erst einmal zu klären, da er im Folgenden immer wieder benutzt werden muss, wird das Thema des 2. Kapitels dieser Arbeit sein. Im 3. Kapitel werde ich dann exemplarisch auf einzelne Aspekte der höfischen Kultur, soweit Thomasin sie anführt, eingehen. Die Arbeit schließt mit einem Fazit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Textvorlagen
- Zum Schlüsselbegriff „höfisch“
- Was bedeutet „höfisch“?
- Wie wird man zum höfischen Menschen?
- Aspekte höfischer Kultur
- Lehre über höfisches Verhalten
- Hofetikette und Tischmanieren
- Der Umgang mit dem anderen Geschlecht - Thomasins Minnelehre
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert Aspekte der höfischen Kultur, die im ersten Buch des „Welschen Gastes“ von Thomasin von Zerklaere dargestellt werden. Ziel ist es, Thomasins Vorstellung von höfischem Verhalten zu erforschen und dessen Bedeutung im Kontext der mittelalterlichen Gesellschaft zu beleuchten.
- Die Definition des Begriffs „höfisch“ im Kontext des 13. Jahrhunderts
- Die Herausarbeitung von zentralen Elementen höfischen Verhaltens, wie z.B. Tischmanieren und dem Umgang mit dem anderen Geschlecht
- Die Analyse der didaktischen Intentionen Thomasins und die Relevanz seiner Lehren für die damalige Gesellschaft
- Die Einordnung der „Welschen Gastes“ in den literarischen Kontext des Mittelalters
- Die Rolle von Thomasin als Vertreter der höfischen Kultur
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung bietet einen Überblick über den Inhalt und die Ziele des „Welschen Gastes“, wobei auf die Entstehungszeit und die Relevanz des ersten Buches für diese Arbeit hingewiesen wird.
Kapitel 1 widmet sich der Analyse der Textvorlagen des „Welschen Gastes“, wobei auf die Editionsproblematik und die verschiedenen verfügbaren Textausgaben eingegangen wird.
Kapitel 2 befasst sich mit dem Schlüsselbegriff „höfisch“ und analysiert dessen Bedeutung im Kontext der höfischen Kultur des 13. Jahrhunderts. Es werden verschiedene Facetten des Begriffs erläutert und die Entstehung des „höfischen Menschen“ erörtert.
Kapitel 3 untersucht exemplarisch einzelne Aspekte der höfischen Kultur, die von Thomasin im ersten Buch des „Welschen Gastes“ behandelt werden. Dazu gehören Lehren über höfisches Verhalten, Hofetikette und Tischmanieren sowie der Umgang mit dem anderen Geschlecht.
Schlüsselwörter
Höfische Kultur, Thomasin von Zerklaere, „Der Welsche Gast“, höfisches Verhalten, Minnelehre, Hofetikette, Tischmanieren, Didaktik, Mittelalter, Gesellschaft, Literatur.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Werk „Der Welsche Gast“?
Es ist ein didaktisches Werk von Thomasin von Zerklaere aus dem Jahr 1215/16, das Verhaltensregeln für die höfische Gesellschaft des Mittelalters vermittelt.
Was bedeutet der Begriff „höfisch“ im 13. Jahrhundert?
Der Begriff beschreibt ein Ideal kultivierten Verhaltens, das Tugenden, Etikette und Bildung umfasst, die für das Leben am Hofe notwendig waren.
Welche Rolle spielen Tischmanieren in Thomasins Werk?
Tischmanieren sind ein zentraler Aspekt der Hofetikette und dienen als äußeres Zeichen für die innere Zucht und den Stand eines Menschen.
Was ist Thomasins „Minnelehre“?
Sie gibt Anleitungen zum richtigen Umgang mit dem anderen Geschlecht und definiert die moralischen Standards der höfischen Liebe.
Warum war die Edition des Textes problematisch?
Lange Zeit galt die Edition von 1852 als einzige Grundlage, da das Werk von der Forschung wegen vermeintlich mangelnder Kunstfertigkeit vernachlässigt wurde.
- Citar trabajo
- Tobias Sandkuhl (Autor), 2008, Aspekte höfischer Kultur im 1. Buch des Welschen Gastes von Thomasin von Zerklaere, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/195251