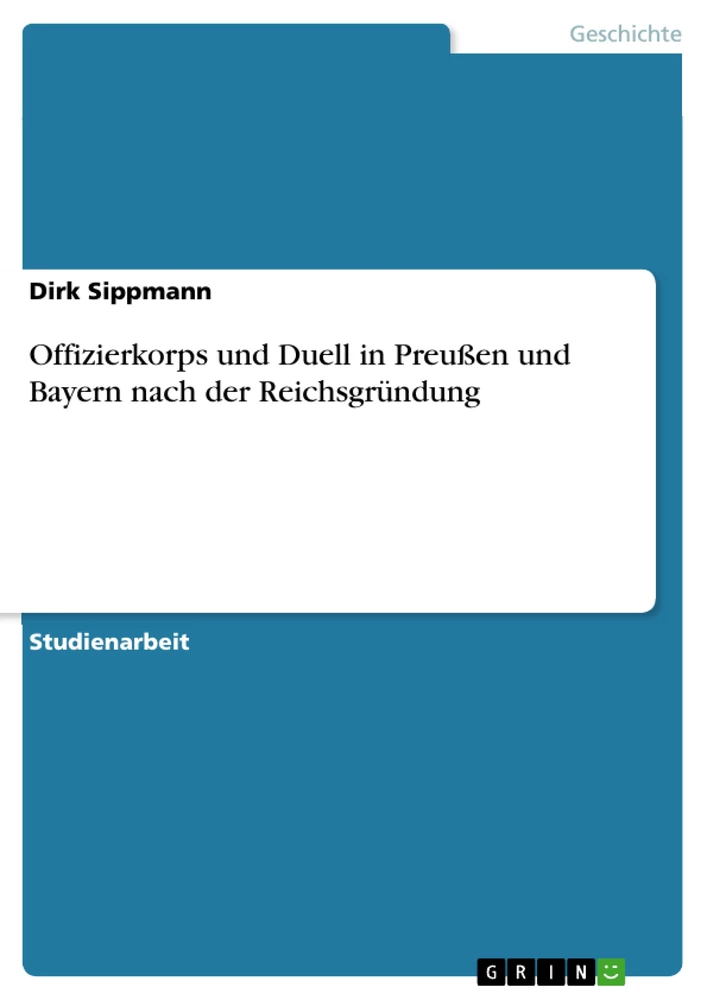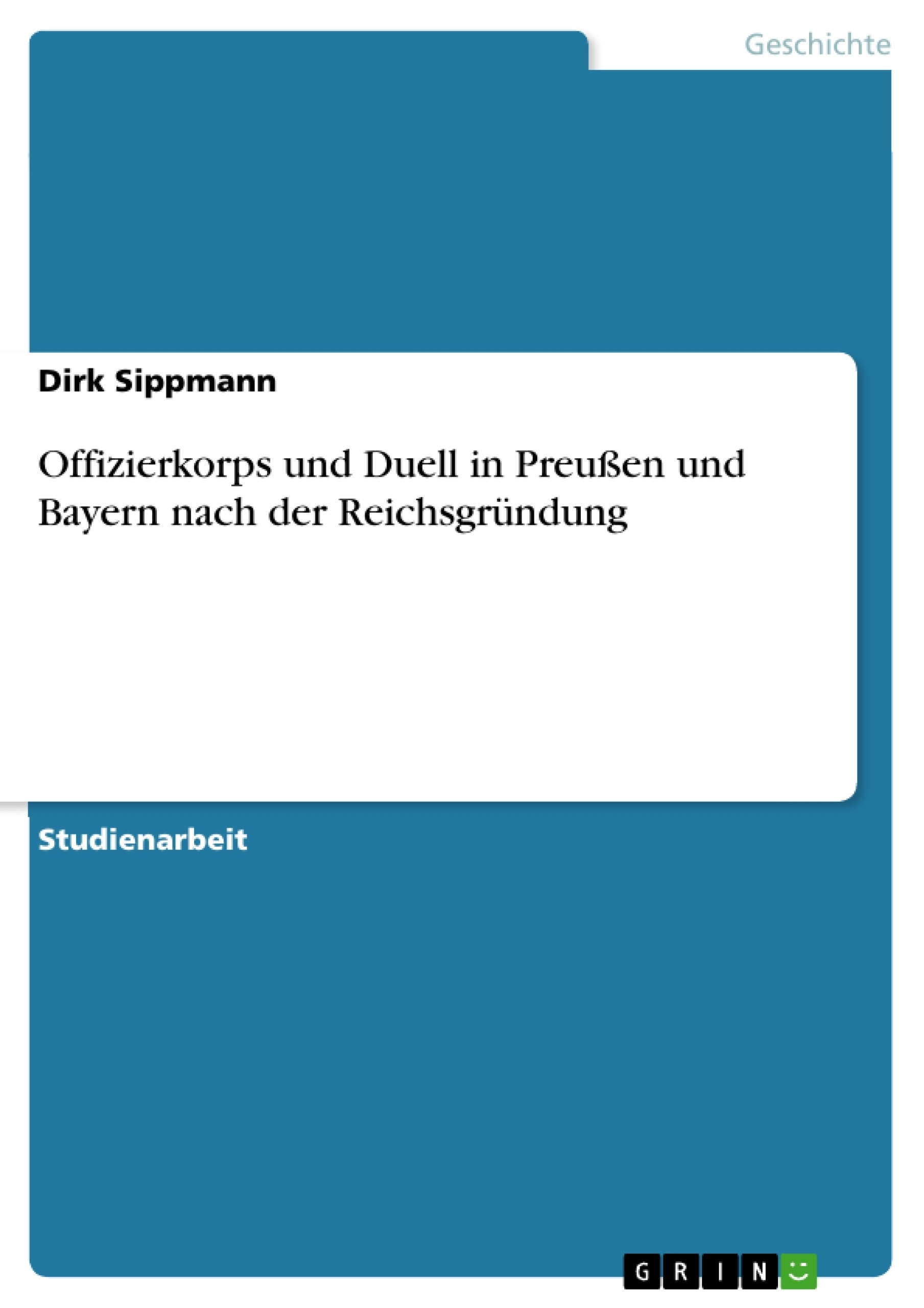Im Folgenden sollen die Ursachen des Duells dargestellt und der Frage nachgegangen werden, wieso es trotz eines gesetzlichen Duellverbots nicht gelang den Zweikampf mit Waffen unter Offizieren zu unterbinden. Dabei sind vor allem die gesellschaftlichen Hintergründe und das Selbstverständnis des Offizierkorps in der Zeit zwischen der Gründung des Deutschen Reichs 1871 und dem Beginn des Ersten Weltkriegs von besonderem Interesse. Genauere Betrachtung verlangt zudem die unterschiedliche Handhabe des Duellwesens in Preußen und Bayern. Die Geschichte und die Entwicklung des Duells in Deutschland seit dem ausgehenden Mittelalter kann auf Grund des Umfangs nicht Gegenstand dieser Arbeit sein.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung und Überblick
- 2. Das Ehrverständnis von Offizier und Offizierkorps im Kaiserreich
- 2.1 Das Duell als Ausdruck der Standesehre
- 2.2 Der Duellzwang
- 3. Gesetzliche Regelung und Ehrengerichte
- 4. Duell in Preußen und Bayern
- 4.1 Das Duell in Bayern
- 4.2 Die Ehrengerichtsverordnung von 1874
- 5. Das Duell im Wandel der Zeit
- 6. Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Praxis des Duells unter Offizieren im Deutschen Kaiserreich, insbesondere zwischen 1871 und dem Ersten Weltkrieg. Sie beleuchtet die gesellschaftlichen und kulturellen Hintergründe dieser Praxis, die trotz gesetzlicher Verbote fortbestand. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Verständnis von Ehre und Standesehre innerhalb des Offizierkorps und dessen Einfluss auf das Duellverhalten. Die unterschiedliche Handhabung des Duellwesens in Preußen und Bayern wird ebenfalls analysiert.
- Das Ehrverständnis des Offizierkorps im Kaiserreich
- Das Duell als Ausdruck von Standesehre und die damit verbundenen Zwänge
- Gesetzliche Regelungen und die Rolle der Ehrengerichte
- Der Vergleich der Duellpraktiken in Preußen und Bayern
- Der Wandel des Duells im Laufe der Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung und Überblick: Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar, indem sie den Unterschied zwischen dem heutigen und dem damaligen Verständnis des Offiziersberufes hervorhebt. Sie führt das Duell als eine für die heutige Gesellschaft unverständliche, aber im Kaiserreich verbreitete Praxis ein und benennt die Forschungsfrage: Warum konnte das Duell trotz gesetzlicher Verbote nicht unterbunden werden? Die Arbeit konzentriert sich auf die Zeit nach der Reichsgründung und den Vergleich zwischen Preußen und Bayern.
2. Das Ehrverständnis von Offizier und Offizierkorps im Kaiserreich: Dieses Kapitel analysiert das Ehrverständnis des Offizierkorps im Kaiserreich. Es beschreibt das Korps als direktes Herrschaftsinstrument des Monarchen, dessen Ehre eng mit der persönlichen Ehre jedes einzelnen Offiziers verbunden war. Eine Verletzung der Ehre eines Offiziers betraf das gesamte Korps und führte zu einem starken Gruppenzwang. Das Kapitel betont die Bedeutung des "Offizierstandes" als "Stand der Ehre" und dessen Abgrenzung zu anderen gesellschaftlichen Gruppen.
2.1 Das Duell als Ausdruck der Standesehre: Dieser Abschnitt erläutert das Duell als Ausdruck der Bereitschaft, das Leben für die Ehre zu opfern. Eine Beleidigung wurde nicht als persönliche Angelegenheit betrachtet, sondern als Angriff auf die Ehre des gesamten Korps. Die Aufforderung zum Duell war somit eine moralische Pflicht zur Wiederherstellung der Ehre. Ein gerichtliches Verfahren war keine akzeptable Alternative.
2.2 Der „Duellzwang“: Hier wird der Druck auf Offiziere beschrieben, die Bereitschaft zum Duell zu zeigen. Die Weigerung, einen Beleidiger zum Duell herauszufordern, führte zu gesellschaftlicher Ächtung, Verlust der Ehre und sogar zu Sanktionen durch höchste politische Stellen. Der Abschnitt zitiert Kaiser Wilhelm I., der die Unverträglichkeit von Ehrenverletzung und mangelnder Ehrenverteidigung betonte.
Schlüsselwörter
Duell, Offizierkorps, Kaiserreich, Standesehre, Ehrengericht, Preußen, Bayern, Ehrgefühl, Duellzwang, gesetzliche Regelung, gesellschaftliche Hintergründe, Wilhelminisches Kaiserreich.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: Das Duell im Deutschen Kaiserreich
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Praxis des Duells unter Offizieren im Deutschen Kaiserreich zwischen 1871 und dem Ersten Weltkrieg. Sie beleuchtet die gesellschaftlichen und kulturellen Hintergründe dieser Praxis und analysiert das Verständnis von Ehre und Standesehre innerhalb des Offizierkorps und dessen Einfluss auf das Duellverhalten. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Vergleich der Duellpraktiken in Preußen und Bayern.
Welche Fragestellung steht im Mittelpunkt der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Warum konnte das Duell trotz gesetzlicher Verbote im Deutschen Kaiserreich nicht unterbunden werden?
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: das Ehrverständnis des Offizierkorps im Kaiserreich, das Duell als Ausdruck von Standesehre und die damit verbundenen Zwänge, gesetzliche Regelungen und die Rolle der Ehrengerichte, der Vergleich der Duellpraktiken in Preußen und Bayern sowie der Wandel des Duells im Laufe der Zeit.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung und Überblick, Das Ehrverständnis von Offizier und Offizierkorps im Kaiserreich (inkl. Das Duell als Ausdruck der Standesehre und Der „Duellzwang“), Gesetzliche Regelung und Ehrengerichte, Duell in Preußen und Bayern (inkl. Das Duell in Bayern und Die Ehrengerichtsverordnung von 1874), Das Duell im Wandel der Zeit und Zusammenfassung und Fazit.
Welche Rolle spielte die Standesehre im Kontext des Duells?
Die Standesehre spielte eine zentrale Rolle. Eine Beleidigung wurde nicht als persönliche Angelegenheit, sondern als Angriff auf die Ehre des gesamten Korps betrachtet. Das Duell war somit eine moralische Pflicht zur Wiederherstellung der Ehre, und ein gerichtliches Verfahren war keine akzeptable Alternative.
Wie wurde der „Duellzwang“ ausgeübt?
Die Weigerung, einen Beleidiger zum Duell herauszufordern, führte zu gesellschaftlicher Ächtung, Verlust der Ehre und sogar zu Sanktionen durch höchste politische Stellen. Der Druck, ein Duell zu führen, war enorm.
Gab es Unterschiede in der Handhabung des Duells zwischen Preußen und Bayern?
Ja, die Arbeit analysiert die unterschiedliche Handhabung des Duellwesens in Preußen und Bayern, wobei auch die Ehrengerichtsverordnung von 1874 eine Rolle spielt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Duell, Offizierkorps, Kaiserreich, Standesehre, Ehrengericht, Preußen, Bayern, Ehrgefühl, Duellzwang, gesetzliche Regelung, gesellschaftliche Hintergründe, Wilhelminisches Kaiserreich.
Welche Kapitelzusammenfassungen werden angeboten?
Die Arbeit bietet Kapitelzusammenfassungen für die Einleitung, das Kapitel zum Ehrverständnis des Offizierkorps im Kaiserreich und dessen Unterkapitel, die sich mit dem Duell als Ausdruck der Standesehre und dem Duellzwang befassen.
- Arbeit zitieren
- Dirk Sippmann (Autor:in), 2009, Offizierkorps und Duell in Preußen und Bayern nach der Reichsgründung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/195310