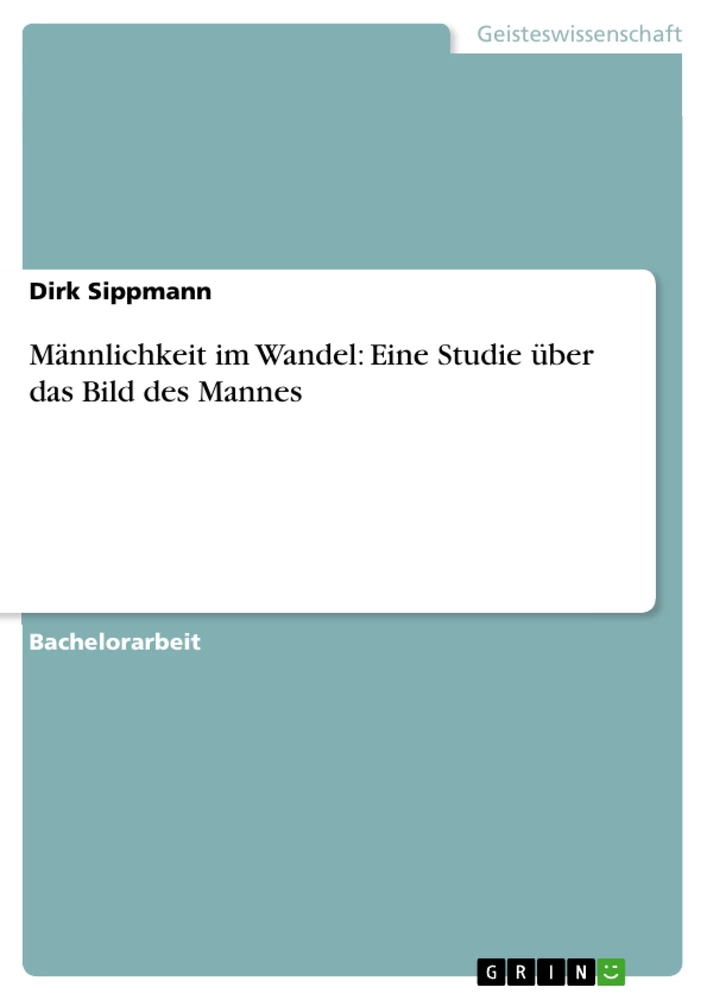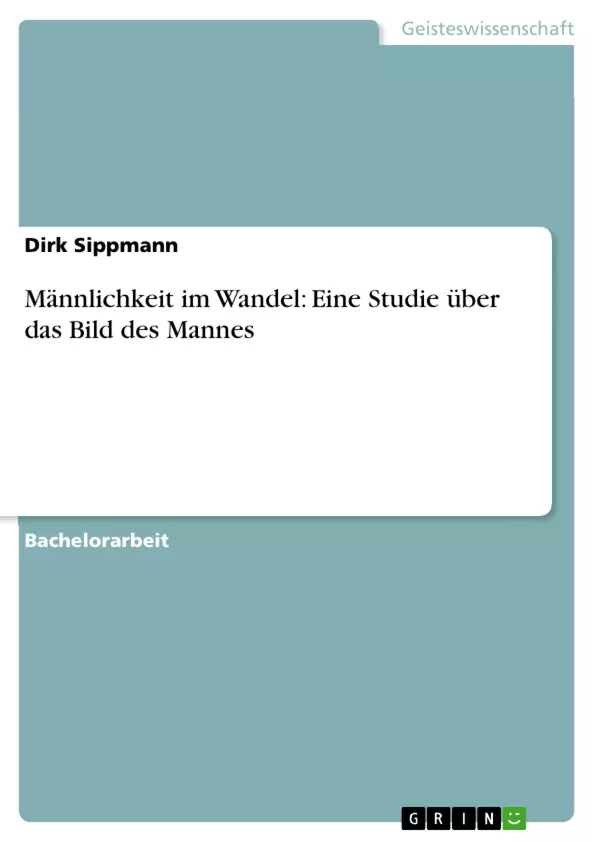Im wissenschaftlichen Diskurs zu familiensoziologischen Entwicklungen ist dabei seit geraumer Zeit ein neuer Trend festzustellen. Lange Zeit beschränkte sich die Forschung fast ausschließlich auf die Untersuchung des weiblichen Rollenbildes und ihres emanzipatorischen Fortschritts in der Gesellschaft. Erst in jüngerer Vergangenheit begann man, hauptsächlich auf den Gebieten der Soziologie und Psychologie, das andere Geschlecht – den Mann – in den Blickpunkt der wissenschaftlichen Betrachtung familiärer Lebensweisen zu rücken. Die individuelle Sozialisation beruht nach Annahme der sozialwissenschaftlichen Rollentheorie auf der Verinnerlichung geschlechtsspezifischer Rollenzuweisungen. In diesem Zusammenhang ist auch die Position des Vaters bei der elterlichen Erziehung der Kinder von Interesse. Nun soll der Mann nicht einzig auf das „Vatersein“ reduziert werden, „die Vaterrolle lebt schließlich auch aus anderen Rollen heraus“ , jedoch lässt sich an diesem Punkt, dem „Wandel der Vaterrolle“, auch die „Transformation der Geschlechterrollen“ im Kontext des gesellschaftlichen Wandels exemplarisch darstellen.
Inhalt
1. Einleitung in das Thema
2. Vaterschaft im Wandel der ZeitDer Terminus „Vater“ in der historischen Betrachtung
2.1 Der „patriarchal - bürgerliche“ Vater des 19. Jahrhunderts
2.2 Das Vaterbild im 20. Jahrhundert
2.3 Das „Neue Väter“ - Modell
3. Die neue Unbestimmtheit der Vaterrolle
3.1 Versuch einer Systematisierung
3.2 Vaterschaft im Zeichen des „modernisierten Ernährermodells“
3.3 Die Einführung des Elterngelds und damit verbundene Auswirkungen auf väterliche Erziehungsteilhabe
4. Grenzen „neuer Väterlichkeit“
5. Gebt den Vätern eine Chance!
5.1 Mehr „Partnermonate“ beim Elterngeld
5.2 Bessere Betreuungsangebote für Kinder erwerbstätiger Eltern
6. Fazit
7. Literatur und Quellenverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was ist das zentrale Thema dieser Untersuchung?
Die Arbeit befasst sich mit dem Wandel der Männlichkeit, insbesondere am Beispiel der Transformation der Vaterrolle im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen.
Wie hat sich das Bild des Vaters historisch entwickelt?
Die Studie beleuchtet die Entwicklung vom „patriarchal-bürgerlichen“ Vater des 19. Jahrhunderts über das Vaterbild des 20. Jahrhunderts bis hin zum modernen Modell der „Neuen Väter“.
Welchen Einfluss hat das Elterngeld auf die väterliche Erziehung?
Es wird untersucht, wie die Einführung des Elterngelds die Teilhabe von Vätern an der Erziehung beeinflusst und welche Auswirkungen dies auf die traditionellen Rollenmodelle hat.
Was ist unter der „neuen Unbestimmtheit“ der Vaterrolle zu verstehen?
Dieser Begriff beschreibt die Herausforderungen und die mangelnde Eindeutigkeit moderner Väterlichkeit, die sich zwischen dem traditionellen Ernährermodell und neuen Erziehungsansprüchen bewegt.
Welche Maßnahmen werden zur Förderung der neuen Väterlichkeit vorgeschlagen?
Der Autor plädiert für mehr „Partnermonate“ beim Elterngeld sowie bessere Betreuungsangebote für Kinder erwerbstätiger Eltern, um Vätern eine aktive Rolle zu ermöglichen.
- Citar trabajo
- Dirk Sippmann (Autor), 2009, Männlichkeit im Wandel: Eine Studie über das Bild des Mannes, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/195318