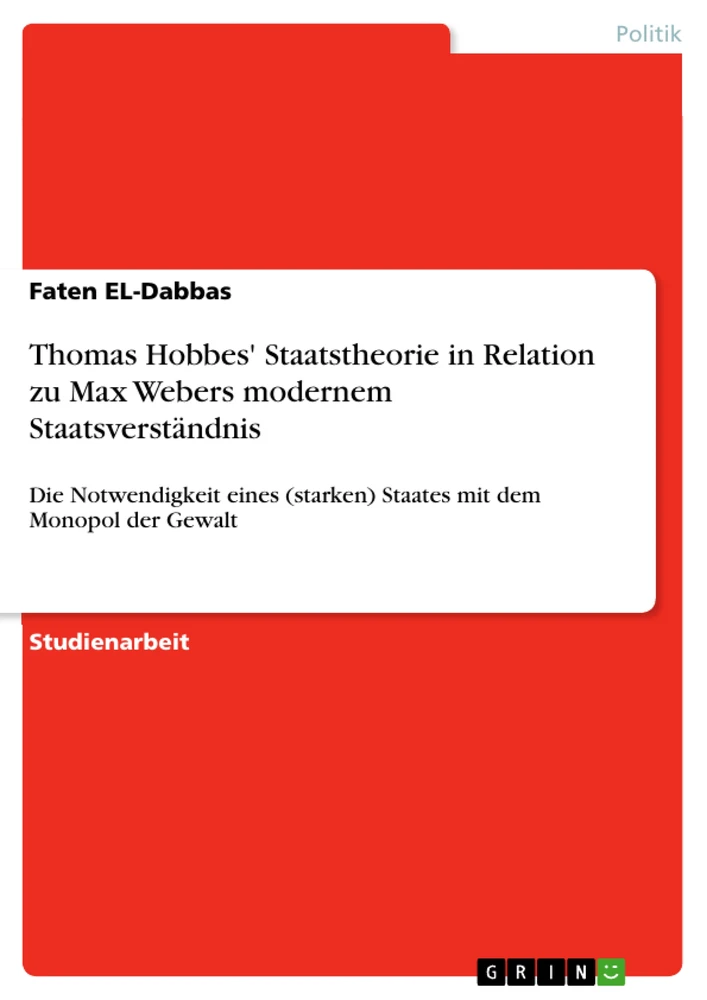„Der Leviathan, der furchtlos-furchterregende, ist alt geworden. Er wird sich mit der Rolle als nützliches Haustier abfinden müssen“. Mit diesem Zitat erklärt Erhard Denninger den von Thomas Hobbes geschaffenen Leviathan für tot, indem er ihm jegliche Bedeutung für unser heutiges Staatsverständnis abschlägt. Thomas Hobbes gilt nicht nur als Begründer der Vertragstheorie, sondern er markiert mit seinem 1651 veröffentlichtem Werk „Leviathan“ den Beginn des typisch neuzeitlichen Verständnisses von Staat und Souveränität. Der zweite Theoretiker, von dem in dieser Arbeit die Rede sein wird, ist Max Weber, der zwar keine systematische Staatslehre entwickelte, sich jedoch vor allem in seinen späten Jahren verstärkt mit staatstheoretischen Themen befasste und diese Ausführungen über sein ganzes Werk verstreut sind. Seine Definitionen politischer Begriffe sind für unser heutiges Staatsverständnis undenkbar. So kommt der Staatsdefinition „eine axiomatische Bedeutung zu, da dort bereits zentrale Aspekte seines Staatsdenkens verankert sind“. Obwohl zwischen Thomas Hobbes und Max Weber knapp drei Jahrhunderte (276 Jahre), liegen, bietet die gemeinsame Vorstellung einer Zwangsgewalt, eines starken Staates, der alle Gewalt in sich vereinigt, Anlass für einen Vergleich. Die Frage nach dem Verhältnis von Staat und Gewalt ist eine der zentralen Fragen des neuzeitlichen politischen Denkens, mit der sich schon Hobbes im 17. Jahrhundert in seinem berühmten Werk „Leviathan“ beschäftigt. Der Leviathan, aus Furcht vor Gewalt geboren, soll die Gewalt der Menschen untereinander beenden und inneren Frieden garantieren, indem sich die Menschen einer Zwangsgewalt unterwerfen, die alle Macht in sich vereinigt. Auch Weber denkt den Staat im Angesicht von Gewalt und spricht ihm das „Monopol legitimer physischer Gewaltanwendung“ zu.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Thomas Hobbes
- 1.1 Leben
- 1.2 Der Mensch im Naturzustand
- 1.3 Der Weg aus dem Naturzustand: Der Gesellschaftsvertrag
- 1.4 Die Konstruktion des Staates: Der Leviathan
- 1.5 Rechte und Pflichten des Souveräns
- 2. Max Weber
- 2.1 Leben
- 2.2 Der moderne Staat und das Gewaltmonopol
- 2.3 Legitimität im modernen Staat
- 2.4 Der Zweck des Staates
- 3. Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Staatstheorie von Thomas Hobbes und ihrem Verhältnis zum modernen Staatsverständnis Max Webers. Sie analysiert Hobbes' Konstruktion des Leviathan als Lösung des Problems des Naturzustands und setzt dieses Konzept in Bezug zu Webers Vorstellung von einem Staat mit dem Gewaltmonopol. Ziel ist es, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Denker im Hinblick auf Staat und Gewalt aufzuzeigen.
- Der Naturzustand und die Problematik der Herrschaft in Abwesenheit eines souveränen Staates
- Das Gewaltmonopol des Staates und seine Bedeutung für Ordnung und Sicherheit
- Die Legitimität der Herrschaft und die verschiedenen Formen der Legitimation
- Die Funktion des Staates und seine Aufgabe im Schutz der Bürger und der Aufrechterhaltung der Rechtsordnung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Thomas Hobbes
Das erste Kapitel widmet sich der Lebensgeschichte und den staatstheoretischen Ideen von Thomas Hobbes. Es beschreibt Hobbes' Naturzustand als einen anarchischen Zustand, in dem der Mensch aufgrund seiner Selbsterhaltungstriebes in ständiger Furcht vor anderen lebt. Durch den Gesellschaftsvertrag verzichten die Menschen auf ihre Freiheit zugunsten eines absoluten Souveräns, der für Sicherheit und Ordnung sorgt. Der Leviathan als Personifikation des Staates verkörpert dieses Konzept, er ist ein starkes, allmächtiges Wesen, das über alle Individuen herrscht.
2. Max Weber
Im zweiten Kapitel wird Max Webers Verständnis des modernen Staates beleuchtet. Weber definiert den Staat als ein Gebilde, das über das Monopol legitimer physischer Gewaltanwendung verfügt. Er analysiert die verschiedenen Legitimitätsgrundlagen der Herrschaft, nämlich die traditionelle, die charismatische und die legale Legitimation. Außerdem werden Webers Ausführungen zum Zweck des Staates erläutert, der sowohl im Schutz der Bürger als auch in der Aufrechterhaltung der Rechtsordnung besteht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Begriffen der Staatstheorie wie Naturzustand, Gesellschaftsvertrag, Leviathan, Gewaltmonopol, Legitimität, Staat und Herrschaft. Die Analyse von Hobbes' und Webers Konzepten zeigt die Entwicklung des neuzeitlichen Staatsverständnisses auf und befasst sich mit den Herausforderungen, die die Beziehung zwischen Staat und Gewalt mit sich bringt.
Häufig gestellte Fragen
Was symbolisiert der „Leviathan“ bei Thomas Hobbes?
Der Leviathan steht für den absoluten Staat bzw. Souverän, der durch einen Gesellschaftsvertrag geschaffen wird, um den gewaltsamen Naturzustand zu beenden.
Wie definiert Max Weber den modernen Staat?
Weber definiert den Staat als ein Gebilde, das innerhalb eines Gebiets das Monopol legitimer physischer Gewaltsamkeit für sich beansprucht.
Was ist der „Naturzustand“ nach Hobbes?
Ein hypothetischer Zustand ohne staatliche Ordnung, geprägt von ständiger Furcht und dem „Krieg aller gegen alle“ aufgrund des menschlichen Selbsterhaltungstriebs.
Welche drei Formen der Legitimität unterscheidet Max Weber?
Weber unterscheidet die traditionelle Herrschaft (Glaube an Heiligkeit von Traditionen), die charismatische Herrschaft (Hingabe an eine Person) und die legale Herrschaft (Glaube an die Satzung).
Was verbindet die Staatstheorien von Hobbes und Weber?
Beide Denker sehen die Zwangsgewalt und das Gewaltmonopol als zentrale Elemente eines funktionierenden Staates zur Sicherung von Ordnung und Frieden.
- Quote paper
- Faten EL-Dabbas (Author), 2011, Thomas Hobbes' Staatstheorie in Relation zu Max Webers modernem Staatsverständnis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/195361