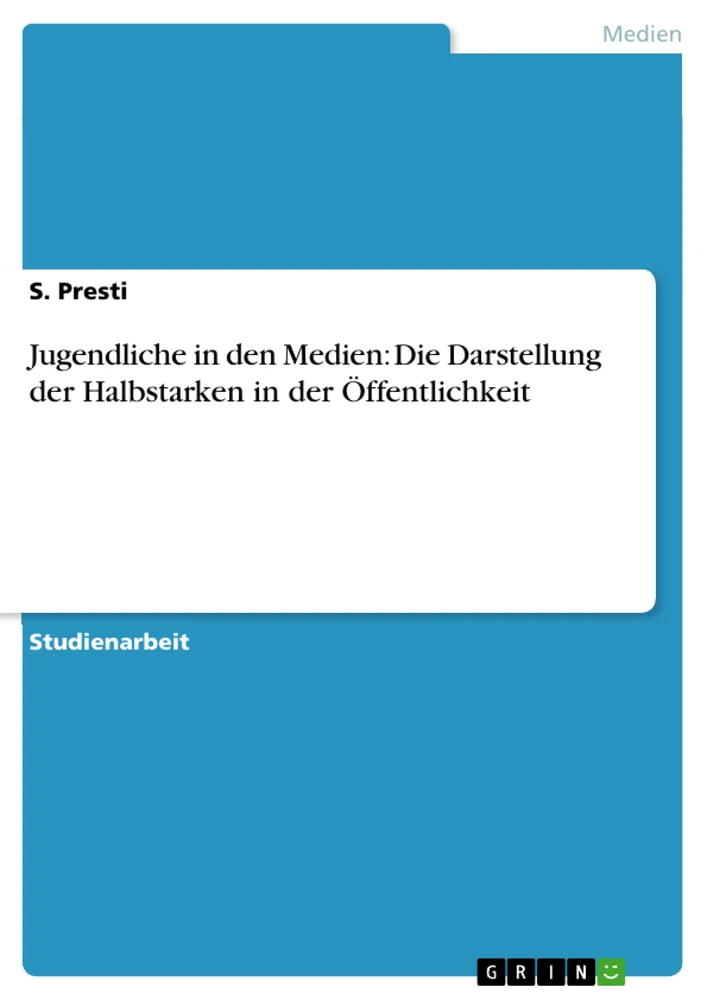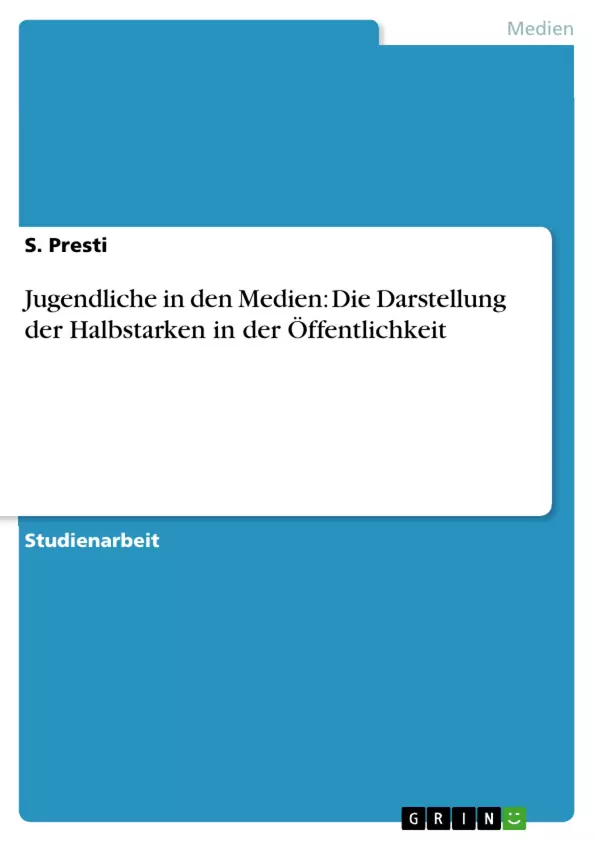1. Einleitung
„…herumlungernde, in Scharen auftretende, radaulustige und nicht ganz ungefährliche Jugendliche aus sozialen Randschichten.“
(Zahn, Susanne, „Außer Rand und Band“. Die Halbstarken, in: Foitzik, Doris (Hrsg.), Vom Trümmerkind zum Teenager. Kindheit und Jugend in der Nachkriegszeit, Bremen 1992, S.111)
Mit dieser Beschreibung charakterisierte man erstmals um 1900 die sogenannten „Halbstarken“, eine Gruppe von Heranwachsenden, die in der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre mit ihrem Verhalten die Öffentlichkeit erschreckten. Schon damals beschrieb man so die „verdorbenen" Jugendlichen aus den unteren sozialen Schichten. Das Phänomen der „Halbstarken“ setzte eine schwierige Ausgangslage voraus. Mehr als die Hälfte der deutschen Männer war im Zweiten Weltkrieg gefallen oder noch in Kriegsgefangenschaft. Dadurch, dass die Mütter nun als Ernährer der Familie häufig abwesend waren, beherrschte eine große Autonomie den Lebensalltag der Kinder und Jugendlichen. Als in den 50er Jahren nun vermehrt Väter in die Familien zurückkehrten, wurde den jungen Erwachsenen mit einem Mal die Entscheidungsgewalt entrissen. Die Jugendlichen waren nicht bereit sich in das wiedererlangte Konstrukt einer funktionierenden Familie einzufügen, was in zahlreichen Familien zwangsläufig zu Konfrontationen führen musste. Im Zeitraum zwischen 1956 und 1958 zählten ca. 5% der männlichen Jugendlichen zwischen 15 und 20 Jahren zu den Halbstarken, wobei die Kerngruppen vorwiegend aus 16-17 Jährigen bestanden. So handelte es sich quantitativ um eine Minderheit in der Jugendgeneration, die mit ihrem Habitus, Mode und Stil so gar nicht zur Wirtschaftswundermentalität der 50er Jahre passten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vorbild Amerika: Darstellung in Film, Fernsehen und der BRAVO
- Halbstarkenkrawalle: Darstellung in Presse und Zeitungen
- Ergebnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert die Darstellung jugendlicher Randgruppen, insbesondere der sogenannten "Halbstarken", in den Medien der 1950er Jahre. Er untersucht, wie diese Gruppe in der öffentlichen Wahrnehmung konstruiert wurde und welche Rolle die Medien dabei spielten.
- Die Entstehung des "Halbstarken"-Phänomens in der Nachkriegszeit
- Die Rolle amerikanischer Einflüsse auf jugendliche Kultur und Lebensweise
- Die Darstellung von "Halbstarken" in Presse, Film und Zeitschriften
- Die Medien als Einflussfaktor auf die öffentliche Meinung und das Bild der Jugend
- Die Bedeutung von Mode, Musik und Verhalten für die Identitätsbildung der "Halbstarken"
Zusammenfassung der Kapitel
- Das Kapitel "Einleitung" beleuchtet den historischen Kontext der "Halbstarken", ihren Ursprung in den sozialen Verhältnissen der Nachkriegszeit und ihre Bedeutung für die Jugendkultur der 1950er Jahre.1
- Das Kapitel "Vorbild Amerika" analysiert den Einfluss amerikanischer Kultur auf die deutsche Jugend und die Darstellung von "Halbstarken" in Filmen, Fernsehsendungen und Jugendzeitschriften wie der "Bravo". Es wird die Rolle von amerikanischen Konsumgütern und Freizeitaktivitäten bei der Entstehung einer neuen jugendlichen Subkultur und die Bedeutung von Medien für deren Verbreitung untersucht.14-18
Schlüsselwörter
Halbstarken, Jugendkultur, Medien, Nachkriegszeit, amerikanischer Einfluss, "American way of life", Presse, Film, Fernsehen, "Bravo", Subkultur, Jugendprotest, Mode, Musik, Verhalten, Identitätsbildung, Soziologie, Pädagogik.
Häufig gestellte Fragen
Wer waren die "Halbstarken" der 1950er Jahre?
Eine Gruppe männlicher Jugendlicher (ca. 5% der Generation), die durch auffälliges Verhalten, Mode und Rebellion gegen die Elterngeneration die Öffentlichkeit provozierten.
Welchen Einfluss hatte Amerika auf diese Jugendgruppe?
Der "American Way of Life", US-Filme, Rock 'n' Roll und Zeitschriften wie die BRAVO dienten als Vorbilder für Kleidung, Musikgeschmack und Lebensgefühl.
Warum kam es in den Familien der 50er Jahre zu Konflikten?
Nach der Abwesenheit der Väter im Krieg hatten Jugendliche eine große Autonomie entwickelt. Die Rückkehr der Väter und deren Anspruch auf Entscheidungsgewalt führte zu Konfrontationen.
Wie stellte die Presse die "Halbstarken" dar?
Oft als "verdorben", radaulustig und gefährlich, wobei die Medien das Bild einer bedrohlichen Minderheit aus sozialen Randschichten prägten.
Was waren die "Halbstarkenkrawalle"?
Öffentliche Ausschreitungen zwischen 1956 und 1958, die das Phänomen in den Fokus der medialen Berichterstattung und polizeilichen Beobachtung rückten.
- Citation du texte
- S. Presti (Auteur), 2011, Jugendliche in den Medien: Die Darstellung der Halbstarken in der Öffentlichkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/195501