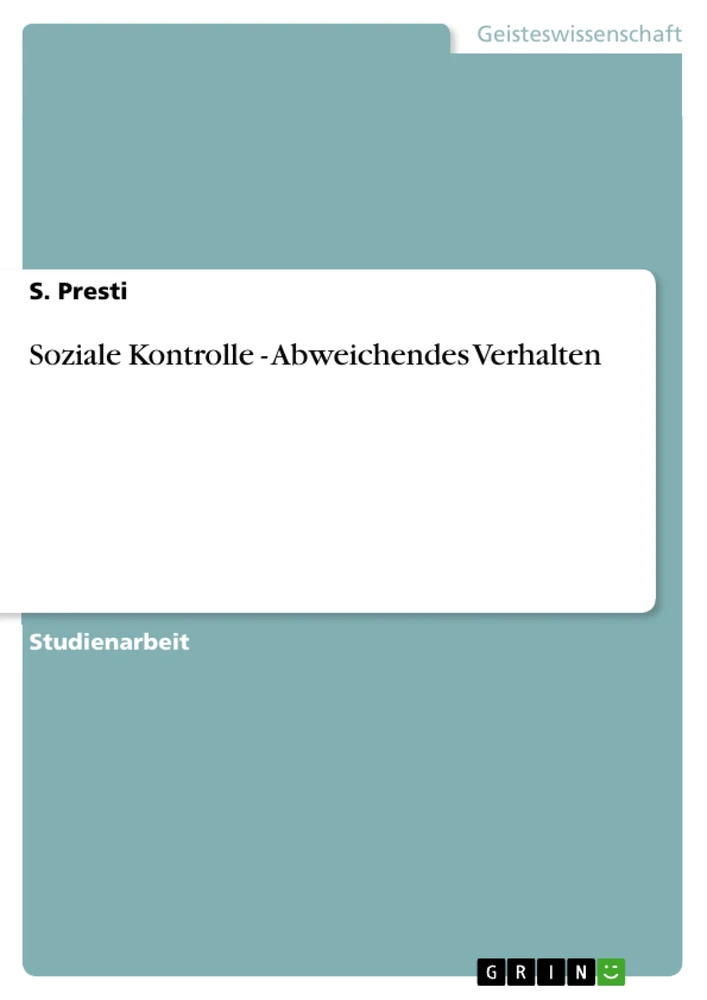1. Einleitung
„Unter Handeln (action) kann man ein in bestimmten Situationen stattfindendes, motivationsgemäßig zustande gekommenes, zielgerichtetes und sozial geregeltes Verhalten begreifen.“
(Bellebaum, Alfred, Soziales Handeln und soziale Normen, Vallendar 1983, S.20)
Bei genauerer Betrachtung stellt man fest, dass es in jeder Form von Gesellschaft ein etwas „anderes“ Verhalten gibt, das die dort anerkannten Vorschriften und unter Umständen sogar Normen durchbricht. In dieser Arbeit liegt der Fokus auf diesem „abweichenden“ Verhalten. Dazu werden verschiedene Theorieansätze, die ein „anderes Verhalten“ zu ergründen versuchen, angeführt und in ihren Kernaussagen dargestellt. Die Soziologie hält hierfür eine reichliche Menge an untersuchender und erklärender Literatur bereit.
Welchen „Wert“ unsere erlernten Verhaltensweisen besitzen, richtet sich danach, wofür man sie einsetzt. Dass können nicht nur gute, sondern auch schlechte, ja sogar unsittliche Ziele sein. In einem ersten Schritt werden auf die Begrifflichkeiten Werte, Normen und Sanktionen eingegangen, da diese Zusammenhänge eine Grundlage für das „abweichende Verhalten“ und der „sozialen Kontrolle“ darstellen, um „schlechte“ Ziele/Werte überhaupt zu definieren. Werte sind nämlich mit Normen und Verhalten aufs engste Verknüpft.
Darauf aufbauend werden die Verhaltenstheorien von Émile Durkheim, Robert King Merton und Howard Saul Beckergenauer näher beleuchtet und kritisch betrachtet. Zuletzt wird auf die „Soziale Kontrolle“ eingegangen, die alle vorherigen Themen in sich vereint, um abschließend ein Fazit daraus zu formulieren. Wie im obigen Zitat schon angedeutet, ist unser Handeln nicht willkürlich. Liegen sozial manifestierte Regeln zu Grunde, aus denen wir zielgerichtet ausbrechen wollen? Oder liegt das „Andersartige“ doch in unserer Natur? Wenn ja, ist dann eine Kontrolle unseres sozialen Verhaltens dann überhaupt möglich? Diese Sachverhalte werde ich nun im Folgenden analysieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlage: Werte, Normen und Sanktionen
- „Abweichendes Verhalten“
- Theorie von Émile Durkheim
- Theorie von Robert King Merton
- Die „labeling-approach\" Theorie (Howard Saul Becker)
- Soziale Kontrolle
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen des „abweichenden Verhaltens“ im soziologischen Kontext. Sie beleuchtet verschiedene Theorien, die dieses Verhalten zu erklären versuchen, und untersucht die Rolle der sozialen Kontrolle in diesem Zusammenhang.
- Bedeutung von Werten, Normen und Sanktionen für das Verständnis von „abweichendem Verhalten“
- Analyse verschiedener Theorien über „abweichendes Verhalten“ von Émile Durkheim, Robert King Merton und Howard Saul Becker
- Das Konzept der sozialen Kontrolle und seine Rolle in der Regulierung von „abweichendem Verhalten“
- Die Frage nach der Willkürlichkeit des menschlichen Handelns und der Möglichkeit der sozialen Kontrolle
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema „abweichendes Verhalten“ ein und definiert den Begriff des Handelns. Sie legt den Fokus auf das Auftreten von „abweichendem Verhalten“ in Gesellschaften und kündigt die Untersuchung verschiedener Theorien und die Rolle der sozialen Kontrolle an.
- Grundlage: Werte, Normen und Sanktionen: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung von Werten, Normen und Sanktionen als Grundlage für das Verständnis von „abweichendem Verhalten“. Es wird erläutert, wie Werte in der Gesellschaft verinnerlicht werden, welche Arten von Werten es gibt und wie Normen aus Werten abgeleitet werden.
- „Abweichendes Verhalten“: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Theorien über „abweichendes Verhalten“, darunter die Theorien von Émile Durkheim, Robert King Merton und Howard Saul Becker. Die Theorien werden in ihren Kernaussagen dargestellt und kritisch betrachtet.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe der Arbeit sind „abweichendes Verhalten“, „soziale Kontrolle“, „Werte“, „Normen“, „Sanktionen“ und die Theorien von Émile Durkheim, Robert King Merton und Howard Saul Becker.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht die Soziologie unter "abweichendem Verhalten"?
Es handelt sich um Verhalten, das anerkannte Vorschriften und soziale Normen einer Gesellschaft durchbricht.
Was besagt die Theorie von Émile Durkheim zur Abweichung?
Durkheim sieht Abweichung als funktional für die Gesellschaft an, da sie zur Definition und Festigung gemeinsamer Werte beiträgt.
Was ist der "Labeling Approach" nach Howard Saul Becker?
Diese Theorie besagt, dass Abweichung erst durch die Etikettierung (Zuschreibung) durch die Gesellschaft entsteht ("Etikettierungsansatz").
Wie hängen Werte, Normen und Sanktionen zusammen?
Werte bilden die Grundlage für Normen (Verhaltensregeln). Werden diese Normen verletzt, folgen Sanktionen als Mittel der sozialen Kontrolle.
Was ist die Aufgabe der sozialen Kontrolle?
Sie dient dazu, das Verhalten der Individuen an die gesellschaftlichen Erwartungen anzupassen und abweichendes Verhalten zu regulieren.
- Quote paper
- S. Presti (Author), 2011, Soziale Kontrolle - Abweichendes Verhalten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/195505