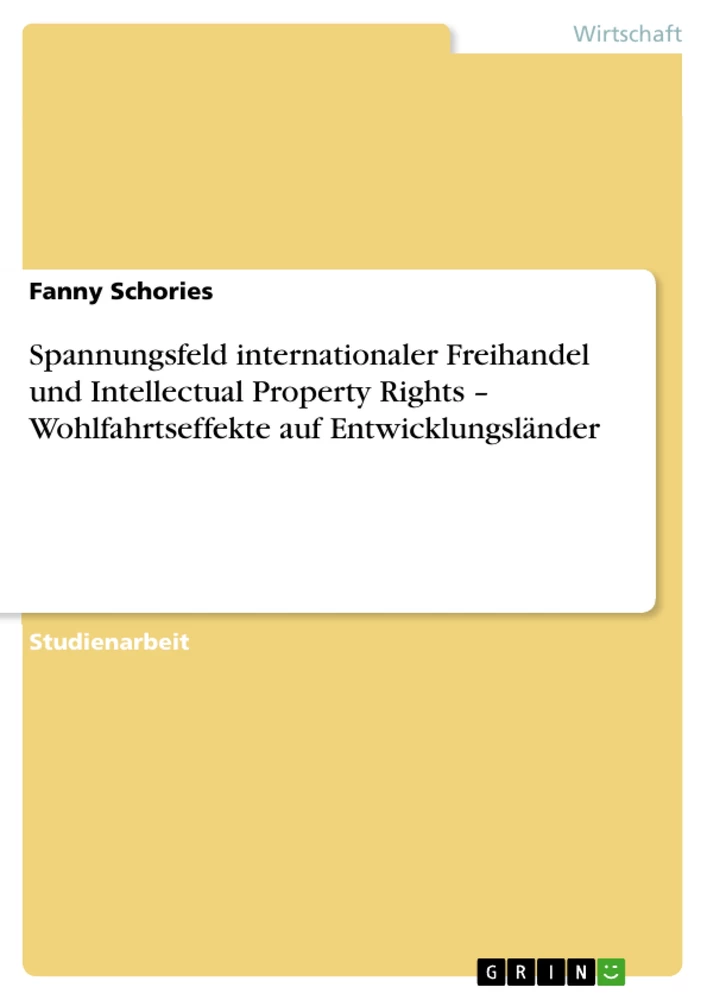Seit fast 18 Jahren bemüht sich die World Trade Organization (im Folgenden: WTO) um den Ab-bau von Handelshemmnissen und die Verbesserung internationaler Wirtschaftsbeziehungen. Zur gleichen Zeit nahm im Zuge der Globalisierung die industrielle Bedeutung von Intellectual Property Rights (im Folgenden: IPR) stark zu (vgl. Commision on Intellectual Property Rights, 2002). Eine wichtige internationale Kodifikation haben diese 1994 im Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte am geistigen Eigentum erfahren. Das Abkommen hat als primäres Ziel die weltweite Harmonisierung von Richtlinien zu IPR in Form einer positiven Integration, d.h. dem Einführen von Mindeststandards. Dies steht in Gegensatz zu dem eigentlichen Ziel der WTO: der Verbesserung des Freihandels und dem Abbau von Handelshemmnissen, wodurch nicht zuletzt die Situation von Entwicklungs- und Schwellenländer verbessert werden soll. Inwieweit das TRIPS – insbesondere im Hinblick auf Patentrechte – im Zusammen-spiel mit dem globalen Handel der Wohlfahrt von Entwicklungs- und Schwellenländern tatsächlich zuträglich ist, möchte ich in meiner Arbeit betrachten. Diese Frage wird vermutlich nicht eindeutig zu beantworten sein, denn einerseits wirken sich IPR stimulierend auf das Wirtschaftswachstum aus, indem sie Erfindungen fördern und so die Produktion steigern, Investitionen erhöhen und Technologietransfers ermöglichen könnten. Andererseits mangelt es armen Ländern oft an Human-kapital und technischen Kapazitäten zur Produktion eigener Erfindungen. Die Verbraucher in diesen Ländern profitieren voraussichtlich wenig von neuer Forschung, da sie sich die meisten Güter – u.a. auch Medizin und landwirtschaftliche Inputs – nicht leisten können. Durch die strikte Durchsetzung von IPR könnten auch die Möglichkeiten des technologischen Lernens verringert und die heimische Wirtschaft durch Importe ausländischer Konkurrenz bedroht werden. Positive wie negative Folgen einer Harmonisierung des Patentrechts sind auf den ersten Blick nicht leicht voneinander zu tren-nen, da die Entwicklungsländer nicht als homogener Block, sondern mit großen Differenzen untereinander in den Verhandlungen der Uruguay Runde auftraten. (vgl. Commission on Intellectual Property Rights, 2002).
Die genannten Aspekte dieses Spannungsfeldes möchte ich im Folgenden beleuchten. Als Maßstab für die Situation eines Landes werde ich hierfür die jeweilige Entwicklung der Wohlfahrt (also der Konsumenten- und Produzentenrente) betrachten.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Handel: seine Vorteile und Beschränkungen
2.1 Wieso sich Freihandel lohnt
2.2 Schranken des freien Handels: Patentrechte und TRIPS
2.2.1 Geistiges Eigentum
2.2.2 Patente und ihre ökonomischen Auswirkungen
2.2.3 TRIPS
3 Wohlfahrtseffekte internationalen Patentschutzes
3.1 Mehr ist nicht besser? Wieso TRIPS die globale Wohlfahrt senkt
3.2 Technologietransfer durch Patente - stärkerer Schutz kann sich lohnen
3.4 Negative Folgen des Fortschritts - Samuelsons Globalisierungskritik
4 Schlussbetrachtung
5 Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was ist das TRIPS-Abkommen?
Das TRIPS-Abkommen der WTO legt internationale Mindeststandards für den Schutz des geistigen Eigentums (Intellectual Property Rights) fest.
Warum ist Patentschutz für Entwicklungsländer problematisch?
Strikte Patente können Preise für lebensnotwendige Güter wie Medikamente erhöhen und den technologischen Lernprozess in ärmeren Ländern behindern.
Können Patente den Technologietransfer fördern?
Ja, ein gewisser Schutz kann ausländische Investitionen anlocken und Unternehmen dazu motivieren, Technologien in Länder mit gesicherten Rechtsstandards zu transferieren.
Welche Wohlfahrtseffekte hat der Freihandel?
Freihandel steigert theoretisch die globale Wohlfahrt durch Spezialisierung, kann aber durch ungleiche Verteilung von Wissen und Kapital zu Nachteilen für Entwicklungsländer führen.
Was besagt Samuelsons Globalisierungskritik?
Samuelson zeigt auf, dass technologischer Fortschritt in Entwicklungsländern unter bestimmten Bedingungen die Wohlfahrt von Industrienationen senken kann, was das Spannungsfeld des globalen Handels verdeutlicht.
- Quote paper
- Fanny Schories (Author), 2012, Spannungsfeld internationaler Freihandel und Intellectual Property Rights – Wohlfahrtseffekte auf Entwicklungsländer, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/195540