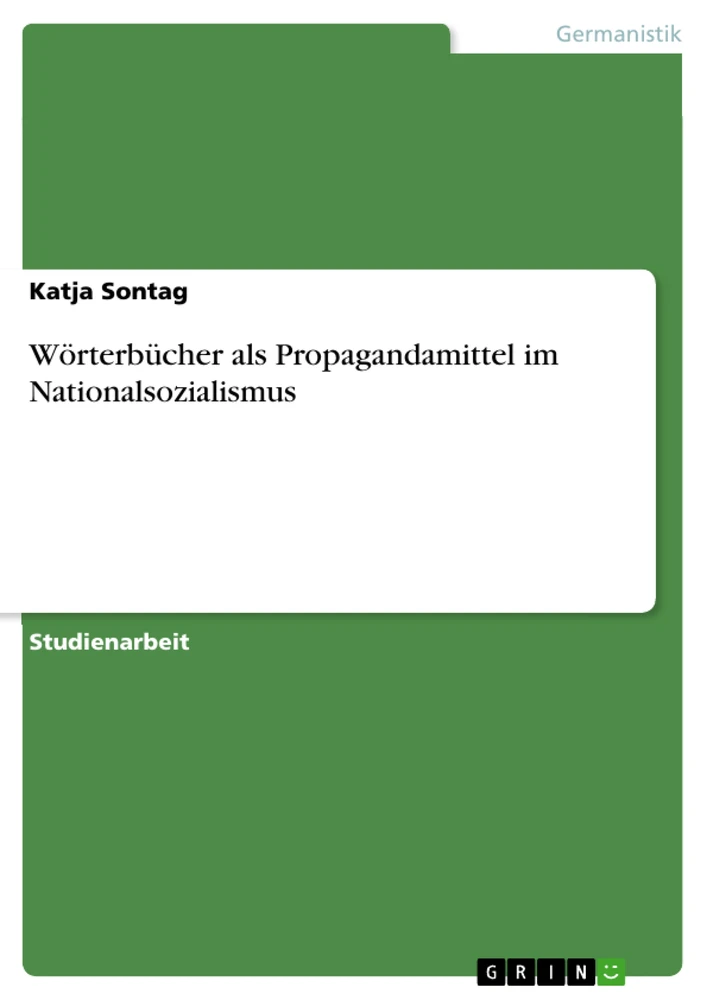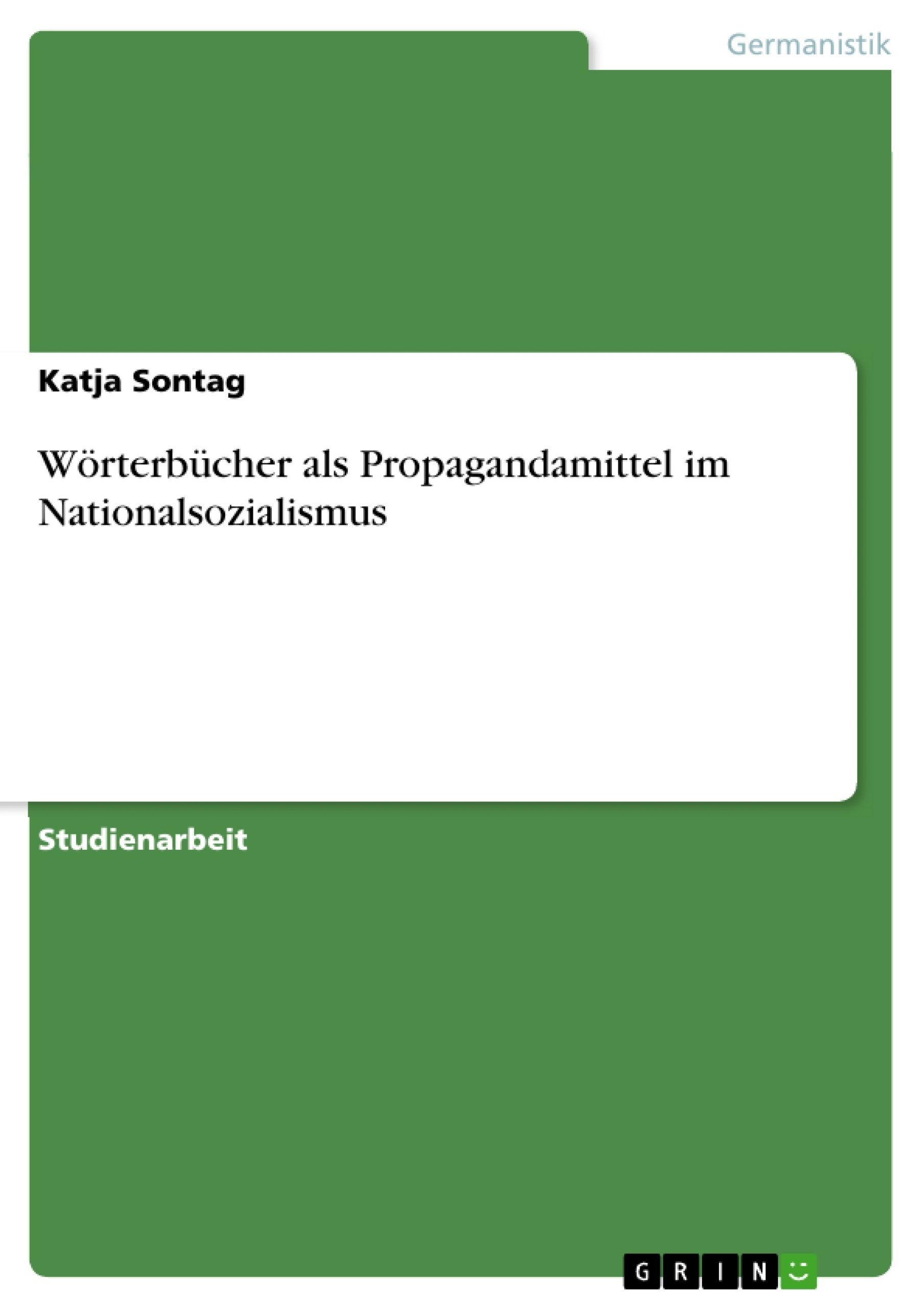Die Veränderungen im Sprachgebrauch zur Zeit des Nationalsozialismus
sind Gegenstand vieler verschiedener Untersuchungen. Allerdings befassen
sich eher wenige davon mit den Wörterbüchern der nationalsozialistischen
Zeit, um zu klären ob und wie die Darstellung des allgemeinsprachlichen
Wortschatzes in den Nachschlagewerken dieser Zeit den Bedingungen der
totalitären Ideologie angepasst wurde. Dies soll in der vorliegenden Arbeit
zusammenfassend geschehen.
Dafür wird zuerst ein Überblick darüber gegeben, wie sich der
nationalsozialistische Sprachgebrauch im allgemeinen auszeichnete.
Einführend wird ein kurzer Abriss des sprachgeschichtlichen Hintergrundes
gegeben und die Terminologie dahingehend geklärt, ob man überhaupt von
der Sprache des Nationalsozialismus reden kann. Auch ein kleiner Exkurs in
die moralisierende Sprachkritik wird gegeben.
Im Hauptteil der Arbeit wird auf die Verwendung von Wörterbüchern als
Propagandamittel der Nationalsozialisten im genaueren eingegangen. Es
werden die verschiedenen methodischen Möglichkeiten genannt, mit Hilfe
derer es den Nationalsozialisten möglich war, durch gezielte Eingriffe und
Veränderungen den Adressaten zu manipulieren. Dabei wird sowohl auf die
Wörterverzeichnisse an sich, als auch auf die Einleitungen bzw. Vorwörter
eingegangen werden.
Nach einer Aufstellung aller methodischen Möglichkeiten wird sich der Frage
gewidmet, wie diese Änderungen wieder rückgängig gemacht wurden, vor
allem wie schnell und wie gründlich dies geschah. Dazu wird exemplarisch
der Duden – das als das populärste deutsche Wörterbuch bezeichnete
Nachschlagewerk – zurate gezogen und zwei aufeinanderfolgende Auflagen
miteinander verglichen: die 12. Auflage von 1942 und die 13. Auflage von
1948.
Aufgrund des beschränkten Umfanges dieser Arbeit ist es nur möglich, einen
groben Überblick über das Thema zu bieten. Zur weiterführenden Lektüre
möge auf die Literaturliste verwiesen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sprache im Nationalsozialismus
- Abriss des sprachgeschichtlichen Hintergrunds
- Zum Begriff „Sprache des Nationalsozialismus“
- Bibliographischer Überblick
- Gibt es eine „Sprache des Nationalsozialismus“?
- Moralisierende Sprachkritik
- Wirkung der Sprache im Nationalsozialismus
- Wörterbücher in der NS-Zeit
- Methodische Konsequenzen
- Frühe Entnazifizierung von Wörterbüchern
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Verwendung von Wörterbüchern als Propagandamittel im Nationalsozialismus. Sie untersucht, ob und wie die Darstellung des allgemeinsprachlichen Wortschatzes in den Nachschlagewerken der NS-Zeit an die totalitäre Ideologie angepasst wurde.
- Der sprachliche Hintergrund des Nationalsozialismus
- Die Nutzung von Wörterbüchern als Propagandamittel
- Methoden der Manipulation durch gezielte Eingriffe und Veränderungen
- Die Entnazifizierung von Wörterbüchern nach dem Zweiten Weltkrieg
- Der Einfluss der NS-Ideologie auf den Wortschatz
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit legt die Forschungsfrage fest, ob und wie Wörterbücher in der NS-Zeit als Propagandamittel eingesetzt wurden. Sie stellt den Zusammenhang zwischen Sprache und Ideologie im Nationalsozialismus dar.
- Sprache im Nationalsozialismus: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über den sprachlichen Hintergrund des Nationalsozialismus, inklusive eines kurzen Abrisses der sprachgeschichtlichen Entwicklung. Es wird die Frage diskutiert, ob man von einer spezifischen „Sprache des Nationalsozialismus“ sprechen kann und die Bedeutung der moralisierenden Sprachkritik untersucht.
- Wörterbücher in der NS-Zeit: Dieses Kapitel fokussiert sich auf die konkrete Nutzung von Wörterbüchern als Propagandamittel. Es werden die methodischen Möglichkeiten aufgezeigt, wie die Nationalsozialisten den Adressaten durch gezielte Eingriffe und Veränderungen in den Wörterbüchern manipulierten. Es werden sowohl die Wörterverzeichnisse als auch die Einleitungen und Vorwörter analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert sich auf die Themenbereiche Sprache und Ideologie im Nationalsozialismus, Wörterbücher als Propagandamittel, Manipulation durch gezielte Eingriffe in den Wortschatz, Entnazifizierung von Wörterbüchern, Duden, und die Entwicklung des deutschen Wortschatzes im Kontext der NS-Zeit.
Häufig gestellte Fragen
Wie wurden Wörterbücher im Nationalsozialismus als Propagandamittel genutzt?
Wörterbücher wurden durch gezielte Eingriffe in Wörterverzeichnisse sowie durch ideologisch geprägte Vorwörter und Einleitungen manipuliert, um den allgemeinsprachlichen Wortschatz der totalitären Ideologie anzupassen.
Gibt es eine spezifische „Sprache des Nationalsozialismus“?
Die Arbeit untersucht diese terminologische Frage und beleuchtet den sprachgeschichtlichen Hintergrund sowie die moralisierende Sprachkritik an der NS-Terminologie.
Welche Rolle spielt der Duden in dieser Untersuchung?
Der Duden dient als exemplarisches Beispiel. Die Arbeit vergleicht die 12. Auflage von 1942 mit der 13. Auflage von 1948, um die Veränderungen und die anschließende Entnazifizierung aufzuzeigen.
Wie verlief die Entnazifizierung von Wörterbüchern nach 1945?
Die Arbeit analysiert, wie schnell und gründlich die ideologischen Anpassungen in den Nachschlagewerken nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wieder rückgängig gemacht wurden.
Welche methodischen Möglichkeiten zur Manipulation gab es?
Zu den Methoden gehörten die Umdeutung von Begriffen, die Aufnahme von NS-Kampfbegriffen und die Tilgung von Wörtern, die nicht in das Weltbild der Nationalsozialisten passten.
- Arbeit zitieren
- Katja Sontag (Autor:in), 2012, Wörterbücher als Propagandamittel im Nationalsozialismus, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/195579