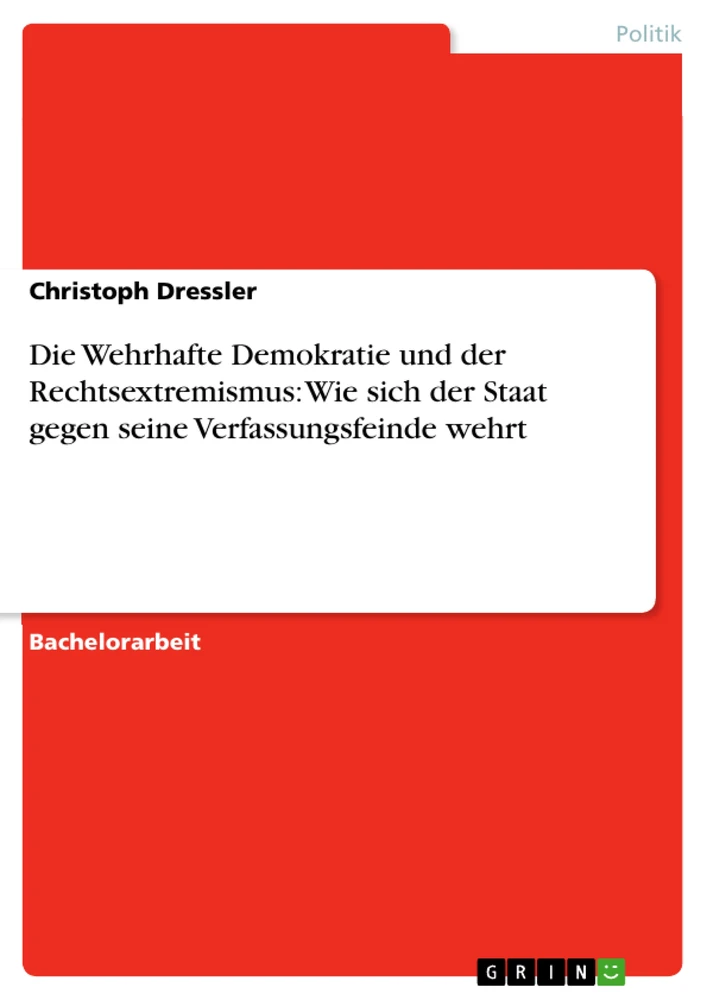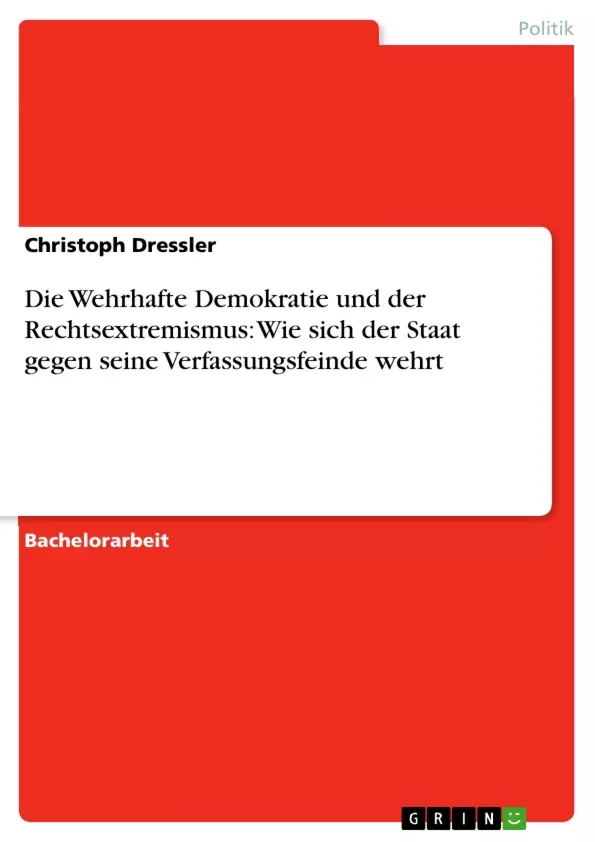Besonders das Phänomen des Rechtsextremismus stellt die Bundesrepublik seit ihrer Gründung immer wieder vor eine besondere Herausforderung und ist auch gegenwärtig ein Problem, mit dem sich die Demokratie auseinandersetzen muss.
In diesem Zusammenhang wird immer wieder auf das Konzept der streitbaren
Demokratie verwiesen, welches als Lösung für das Problem des Rechtsextremismus
dargestellt wird.
Doch welche Gefahr geht vom Rechtsextremismus für die Demokratie tatsächlich aus? Inwiefern stellt die streitbare Demokratie eine Antwort auf den Rechtsextremismus dar? Was beinhaltet das Konzept der streitbaren Demokratie und inwieweit dient es zur Bekämpfung des Rechtsextremismus? Diese Fragen sollen in dieser Arbeit geklärt werden.
Somit gliedert sich die Arbeit in zwei große Teilbereiche. Im ersten Teil wird das Phänomen des Rechtsextremismus ausführlich analysiert. Ziel ist es herauszuarbeiten, warum der Rechtsextremismus eine Herausforderung für dieDemokratie darstellt und warum es deshalb eines streitbaren Demokratieschutzes bedarf. Dazu wird nach Klärung des Rechtsextremismusbegriffs auf die verschiedenen Erscheinungsformen des Rechtsextremismus eingegangen. Aufgrund ihrer hervorgehobenen Bedeutung im Bereich des parteilich organisierten Rechtsextremismus steht dabei die NPD im Fokus der Betrachtung. Daneben folgt eine Analyse des nicht-parteilich geprägten
Rechtsextremismus, welcher die Demokratie ebenfalls, aber auf anderem Wege, bedroht.
Darauf aufbauend wird das Konzept der streitbaren Demokratie, so wie es in der
Bundesrepublik existiert, als Antwort auf die Herausforderung von Rechts präsentiert.
Nach einer kurzen Einführung in den historischen Ursprung des streitbaren
Demokratieschutzes werden die Wesensmerkmale des Konzeptes der streitbaren
Demokratie und deren interdependentes Zusammenspiel analysiert sowie deren
Instrumente untersucht. Gefragt wird dabei auch nach der Wirkungsweise der
Instrumente des verfassungsrechtlichen Demokratieschutzes im Hinblick auf die
Bedrohung durch den Rechtsextremismus. Die Frage nach der Effektivität der
streitbaren Demokratie als Konzept zur Bekämpfung des Rechtsextremismus soll
abschließend im Resümee beantwortet werden. Hier werden auch kurz die Grenzen des verfassungsrechtlichen, streitbaren Demokratieschutzes dargestellt und Auswege aufgezeigt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Rechtsextremismus als Herausforderung für die Demokratie
- 2.1 Kennzeichen des Rechtsextremismus
- 2.2 Aktuelle Situation und Entwicklung rechtsextremistisch motivierter Kriminalität
- 2.3 Erscheinungsformen des Rechtsextremismus
- 2.3.1 Parteilich organisierter Rechtsextremismus in der NPD
- 2.3.2 Erscheinungsformen des subkulturell geprägten Rechtsextremismus
- 2.3.3 Neonazistische Erscheinungsformen
- 3. Die Streitbare Demokratie als Antwort auf die Herausforderung des Rechtsextremismus
- 3.1 Merkmale der streitbaren Demokratie
- 3.1.1 Die Wertgebundenheit des demokratischen Verfassungsstaates
- 3.1.2 Abwehrbereitschaft und Vorverlagerung des Demokratieschutzes
- 3.2 Instrumente der streitbaren Demokratie
- 3.2.1 Das Parteiverbot nach Art. 21, Abs. 2 GG
- 3.2.2 Das Vereinsverbot nach Art. 9 Abs. 2 GG
- 3.2.3 Die Verwirkung der Grundrechte nach Art. 18 GG
- 3.2.4 Das ,,Berufsverbot“
- 3.2.5 Das Widerstandsrecht des Art. 20 Abs. 4 GG
- 4. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der Herausforderung, die Rechtsextremismus für die deutsche Demokratie darstellt. Sie untersucht, inwiefern das Konzept der „streitbaren Demokratie“ als Antwort auf diese Bedrohung dienen kann. Die Arbeit analysiert das Phänomen Rechtsextremismus in seinen verschiedenen Erscheinungsformen und betrachtet dabei insbesondere die NPD. Im zweiten Teil wird das Konzept der streitbaren Demokratie beleuchtet, wobei die Merkmale, Instrumente und die Wirkungsweise im Hinblick auf den Rechtsextremismus im Vordergrund stehen.
- Definition und Kennzeichen des Rechtsextremismus
- Aktuelle Entwicklungen des Rechtsextremismus in Deutschland
- Die „streitbare Demokratie“ als Konzept zur Abwehr von Rechtsextremismus
- Die Instrumente des streitbaren Demokratieschutzes
- Die Effektivität der streitbaren Demokratie im Kampf gegen Rechtsextremismus
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Rechtsextremismus und die streitbare Demokratie ein und stellt die zentralen Fragestellungen der Arbeit dar. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit dem Rechtsextremismus als Bedrohung für die Demokratie. Es beleuchtet verschiedene Definitionen und Kennzeichen des Rechtsextremismus sowie die aktuelle Situation und Entwicklung rechtsextremistischer Kriminalität. Weiterhin werden verschiedene Erscheinungsformen des Rechtsextremismus, einschließlich der NPD und des subkulturell geprägten Rechtsextremismus, vorgestellt. Das dritte Kapitel analysiert das Konzept der „streitbaren Demokratie“ als Antwort auf die Herausforderung des Rechtsextremismus. Es werden die Merkmale und Instrumente des streitbaren Demokratieschutzes untersucht sowie deren Wirksamkeit im Kampf gegen Rechtsextremismus diskutiert.
Schlüsselwörter
Rechtsextremismus, Demokratie, streitbare Demokratie, NPD, Parteiverbot, Vereinsverbot, Verwirkung der Grundrechte, Berufsverbot, Widerstandsrecht, Bundesverfassungsschutz.
- Quote paper
- Christoph Dressler (Author), 2010, Die Wehrhafte Demokratie und der Rechtsextremismus: Wie sich der Staat gegen seine Verfassungsfeinde wehrt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/195629