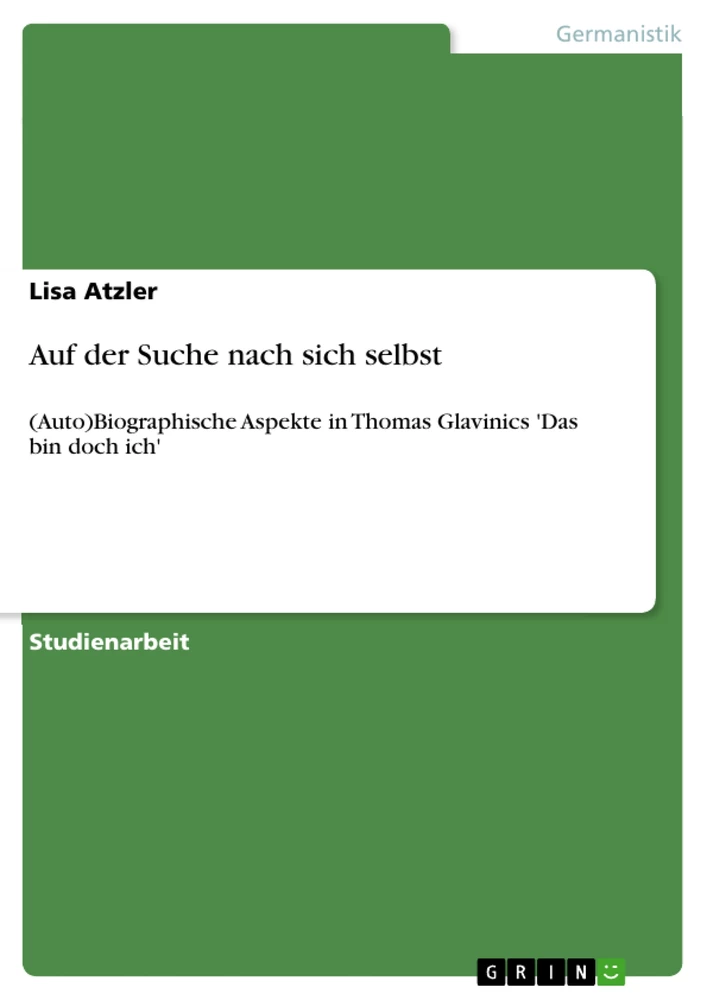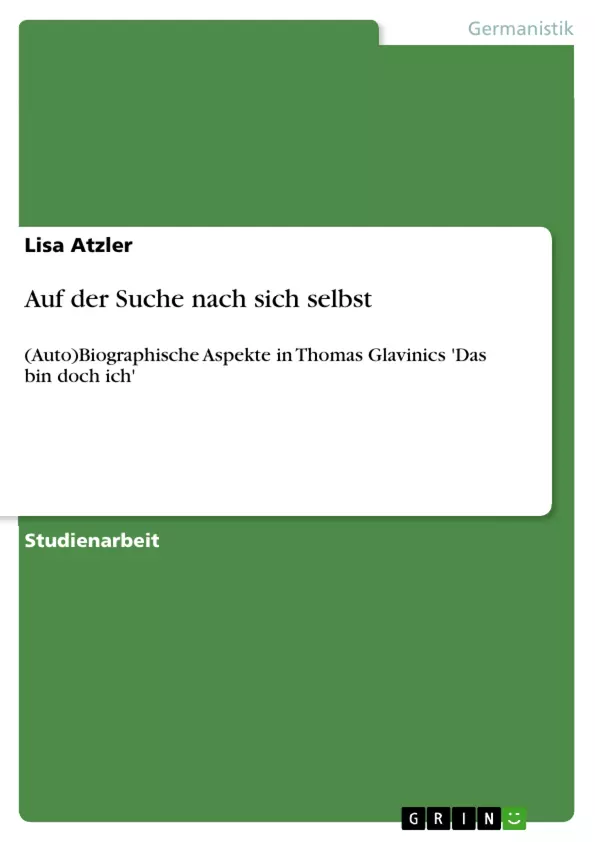Diese Arbeit beschäftigt sich mit den literarischen und psychologischen Aspekten der Biographie und Autobiographie. Erarbeitet werden die Ergebnisse anhand von Thomas Glavinics Roman 'Das bin doch ich'.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Gegenstandbestimmung
- 2.1 Biographie
- 2.2 Autobiographie
- 2.3 Schnittmengen und Versuche der Abgrenzung
- 3. Vergleich und Niederschreiben - identitätsstiftende Momente
- 4. Realität und Kritik
- 5. Fazit
- 6. Anhang: Die Debatte um den Autor
- 7. Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht autobiographische Aspekte in Thomas Glavinics Roman „Das bin doch ich“. Ziel ist es, die Wechselwirkung zwischen autobiographischem Schreiben und der Konstruktion von Identität zu analysieren und die Rolle der fiktionalen Elemente im Kontext der österreichischen Literaturszene zu beleuchten. Der Vergleich zwischen dem Protagonisten und Daniel Kehlmann dient als zentrale Methode der Analyse.
- Autobiographisches Schreiben und Identitätsfindung
- Der Roman als Mischung aus Autobiographie und Biographie
- Die Darstellung der österreichischen Literaturszene
- Realität und Fiktion im Roman
- Der Vergleich als literarisches Stilmittel
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Einführung stellt den Roman „Das bin doch ich“ von Thomas Glavinic vor und skizziert die zentrale These der Arbeit: Glavinic nutzt autobiographisches Schreiben zur Identitätsfindung und inszeniert gleichzeitig Daniel Kehlmann als Kontrastfigur, um die österreichische Literaturszene zu kritisieren. Der Essay kündigt die begriffliche Klärung von Biographie und Autobiographie an und deutet die Auseinandersetzung mit der Medienkritik und der Doppelbödigkeit der Realität im Roman an. Die Unterscheidung zwischen dem Autor und dem autodiegetischen Erzähler wird präzisiert.
2. Gegenstandbestimmung: Dieses Kapitel befasst sich mit den Begriffen Biographie und Autobiographie. Es beginnt mit einer Definition von Biographie und beleuchtet die historische Entwicklung des Genres, beginnend mit Vorformen in der Bibel bis hin zur modernen Biographik. Die Kapitel unterteilen die historische Entwicklung nach der Frage ob Biographien Lob oder Tadel ausdrücken, wer biographiert wird (von Helden zu Bürgerlichen) und ob Historie oder Poetik im Fokus steht. Das Kapitel diskutiert die Herausforderungen der Abgrenzung und die Entwicklung des Genres über verschiedene Epochen hinweg, um ein differenziertes Verständnis für die Anwendung dieser Begriffe auf Glavinics Werk zu schaffen. Der Abschluss kündigt eine weiterführende Diskussion der Debatte um den Autor im Anhang an.
Schlüsselwörter
Autobiographie, Biographie, Thomas Glavinic, Daniel Kehlmann, österreichische Literaturszene, Identitätsfindung, Realität und Fiktion, Medienkritik, Vergleich, Identitätsstiftendes Schreiben.
Häufig gestellte Fragen zu "Das bin doch ich" von Thomas Glavinic
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert autobiographische Aspekte in Thomas Glavinics Roman „Das bin doch ich“. Im Mittelpunkt steht die Wechselwirkung zwischen autobiographischem Schreiben und der Konstruktion von Identität, sowie die Rolle fiktionaler Elemente im Kontext der österreichischen Literaturszene. Ein Vergleich zwischen dem Protagonisten und Daniel Kehlmann bildet die zentrale Analysemethode.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Autobiographisches Schreiben und Identitätsfindung, den Roman als Mischung aus Autobiographie und Biographie, die Darstellung der österreichischen Literaturszene, Realität und Fiktion im Roman, und den Vergleich als literarisches Stilmittel.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einführung, Gegenstandbestimmung (mit Unterkapiteln zu Biographie, Autobiographie und deren Abgrenzung), Vergleich und Niederschreiben - identitätsstiftende Momente, Realität und Kritik, Fazit, Anhang: Die Debatte um den Autor, und Literaturverzeichnis.
Wie wird die Gegenstandbestimmung vorgenommen?
Das Kapitel „Gegenstandbestimmung“ definiert die Begriffe Biographie und Autobiographie, beleuchtet ihre historische Entwicklung (von der Bibel bis zur modernen Biographik) und diskutiert die Herausforderungen ihrer Abgrenzung. Es wird auf verschiedene Epochen und deren Fokus (Lob/Tadel, Biographierte, Historie/Poetik) eingegangen, um ein differenziertes Verständnis für die Anwendung dieser Begriffe auf Glavinics Werk zu schaffen. Der Anhang erweitert die Diskussion um die Debatte um den Autor.
Was ist die zentrale These der Arbeit?
Die zentrale These besagt, dass Glavinic autobiographisches Schreiben zur Identitätsfindung nutzt und gleichzeitig Daniel Kehlmann als Kontrastfigur inszeniert, um die österreichische Literaturszene zu kritisieren.
Welche Rolle spielt der Vergleich zwischen dem Protagonisten und Daniel Kehlmann?
Der Vergleich zwischen dem Protagonisten und Daniel Kehlmann dient als zentrale Methode der Analyse, um die autobiographischen Aspekte und die Kritik an der österreichischen Literaturszene herauszuarbeiten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Autobiographie, Biographie, Thomas Glavinic, Daniel Kehlmann, österreichische Literaturszene, Identitätsfindung, Realität und Fiktion, Medienkritik, Vergleich, Identitätsstiftendes Schreiben.
Was wird im Fazit zusammengefasst?
Das Fazit fasst die Ergebnisse der Analyse der autobiographischen Aspekte in "Das bin doch ich" zusammen und bewertet die Bedeutung des Romans im Kontext der österreichischen Literatur.
Was beinhaltet der Anhang?
Der Anhang befasst sich mit der Debatte um den Autor und erweitert die im Hauptteil angesprochenen theoretischen Überlegungen.
- Arbeit zitieren
- Lisa Atzler (Autor:in), 2012, Auf der Suche nach sich selbst, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/195636