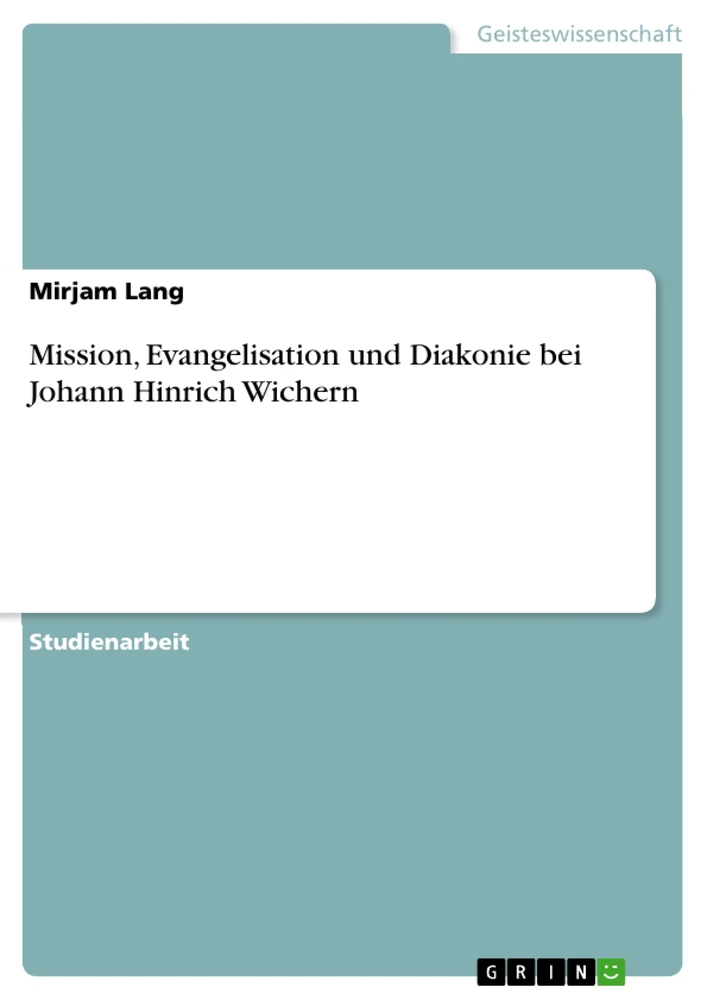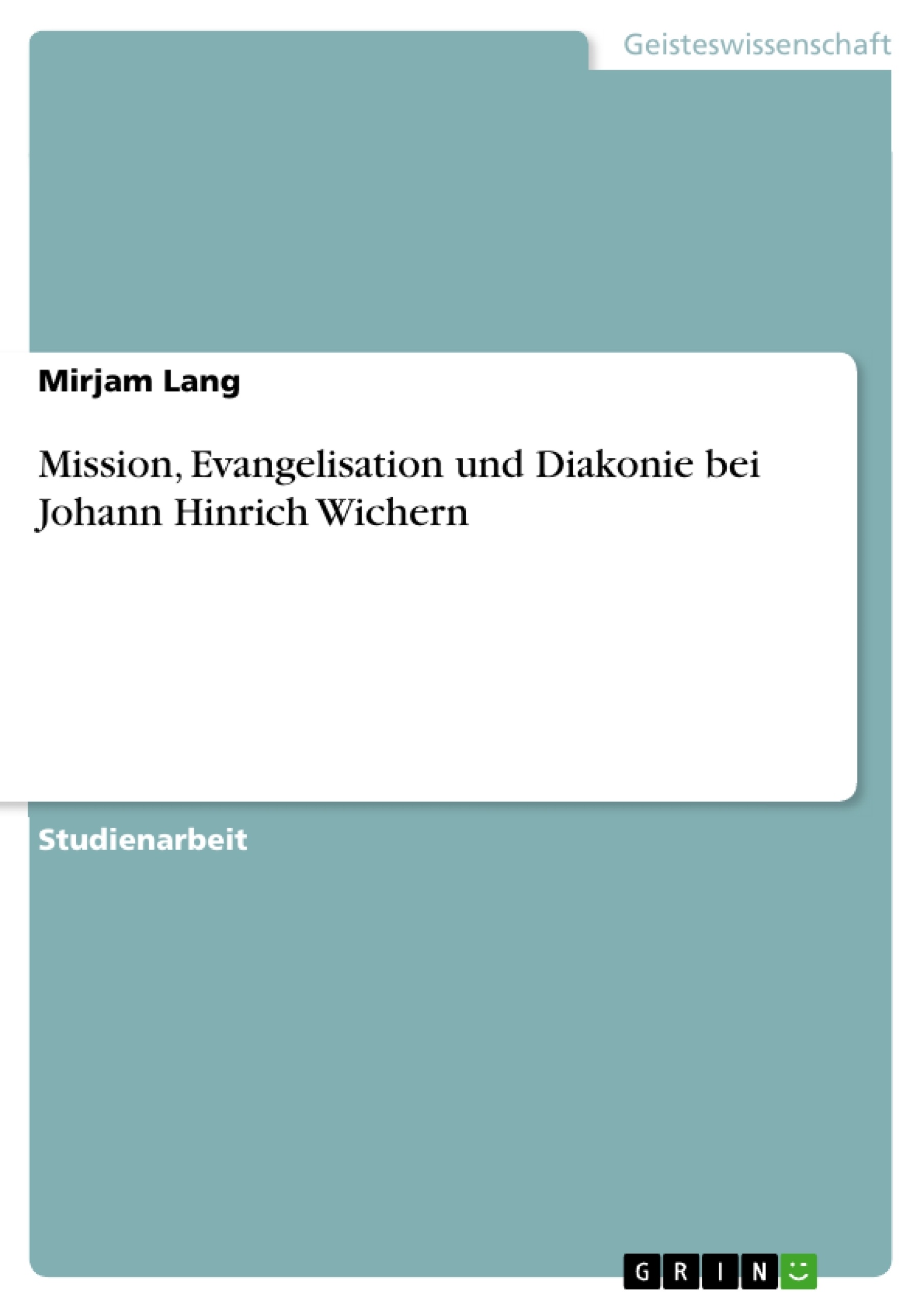Die Geschichte der Christenheit ist voll beeindruckender Persönlichkeiten, die nicht nur Zeugen des Glaubens waren, sondern ganze Epochen mitgestaltet haben. Zu ihnen gehört auch Johann Hinrich Wichern. Besonders hinsichtlich der Frage nach dem Platz der Diakonie und der Mission innerhalb der Kirche leistete Wichern einen großen Beitrag. Mit Blick auf Wicherns Gesamtwerk kann man festhalten, dass er als (Volks-) Missionar sozialpolitisch tätig war: Die Rettung des dieser außerordentlichen Hilfe bedürftigen Volks durch Predigt des Evangeliums und durch die Handreichung der Liebe war für Wichern die Grundlage. Für ihn war es die in Liebe verbundene Gemeinde, die grundlegend Trägerin von Evangelisation und Diakonie ist. Über Wicherns Verständnis von Mission und Diakonie soll es in der vorliegenden Arbeit gehen. Im ersten Teil „Hintergründe zu Johann Hinrich Wichern“ wird sein Leben, seine Wirkung, sowie seine Vorstellung von der Kirche mit einem Schwerpunkt auf der Zeit vor 1843 dargestellt. Davon ausgehend wird im zweiten Teil das Mit- und Zueinander von Diakonie und Mission thematisiert und die daraus resultierende neue Verhältnisbestimmung aufgezeigt. Im dritten Teil „Evangelisation und Diakonie bei Wichern“ wird spezifisch auf Wicherns vielschichtiges Verständnis von Innerer Mission und Diakonie eingegangen. Im Schlussgedanke werden die Erkenntnisse in einem allgemeinen Ausblick und einer kritischen Hinterfragung über das Verhältnis von Evangelisation und Diakonie zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1. Hintergründe zu Johann Hinrich Wichern
- 1.1 Zeitliche Einordnung
- 1.2 Leben und Wirkung
- 1.3 Wicherns Kirchenverständnis vor 1843
- 2. Mit- und Zueinander von Mission und Diakonie
- 2.1 Historische Entwicklung und Problemanzeige
- 2.2 Neue Verhältnisbestimmungen
- 3. Innere Mission, Evangelisation und Diakonie bei Wichern
- 3.1 Wichern als Vordenker der Inneren Mission
- 3.2 Wicherns Verständnis der Diakonie und Evangelisation
- 3.3 Der Ort der Diakonie in der Kirche
- Schlussgedanke
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Johann Hinrich Wicherns Verständnis von Mission und Diakonie im Kontext des 19. Jahrhunderts. Sie beleuchtet seine Lebensleistung, sein Wirken und seine theologischen Vorstellungen, insbesondere seine Auffassung von der Kirche vor 1843. Die Arbeit analysiert das Verhältnis zwischen Mission und Diakonie in Wicherns Werk und die daraus resultierenden neuen Verhältnisbestimmungen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Wicherns vielschichtigem Verständnis der Inneren Mission und der Diakonie.
- Wicherns Leben und Wirken im Kontext der Industrialisierung
- Das Verhältnis von Mission und Diakonie im Denken Wicherns
- Wicherns Verständnis der Inneren Mission
- Wicherns Konzept der Diakonie und seine Umsetzung im "Rauhen Haus"
- Der Ort der Diakonie innerhalb der Kirche nach Wichern
Zusammenfassung der Kapitel
1. Hintergründe zu Johann Hinrich Wichern: Dieses Kapitel beleuchtet das Leben und Wirken Johann Hinrich Wicherns im Kontext der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umbrüche des 19. Jahrhunderts, insbesondere der Industrialisierung. Es analysiert die sozialen Probleme dieser Zeit, wie die zunehmende Armut und die unmenschlichen Arbeitsbedingungen in den Städten, und setzt dies in Beziehung zu Wicherns Wirken. Das Kapitel skizziert Wicherns Kirchenverständnis vor 1843, wobei insbesondere seine Auseinandersetzung mit dem Ideal der johanneischen Kirche hervorgehoben wird und der Beginn seiner Arbeit mit der Inneren Mission im Kontext der gesellschaftlichen Entwicklungen seiner Zeit dargestellt wird. Wicherns Reaktion auf die aufkommende kommunistische Ideologie und sein Fokus auf die rettende Liebe werden ebenfalls thematisiert.
2. Mit- und Zueinander von Mission und Diakonie: Dieses Kapitel untersucht die historische Entwicklung des Verhältnisses zwischen Mission und Diakonie und zeigt die Herausforderungen auf, die sich aus diesem Verhältnis ergeben. Es analysiert die neue Verhältnisbestimmung zwischen Mission und Diakonie, die sich aus Wicherns Werk ergibt und die Bedeutung der "inländischen Mission" im Kontext seines Denkens. Das Kapitel vertieft die Verbindungen zwischen Wicherns sozialem Engagement und seinem theologischen Verständnis der Mission und Diakonie, und wie er diese ineinandergreifend verstand.
3. Innere Mission, Evangelisation und Diakonie bei Wichern: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit Wicherns vielschichtigem Verständnis der Inneren Mission, der Evangelisation und der Diakonie. Es analysiert seine Rolle als Vordenker der Inneren Mission und untersucht detailliert seine Konzepte der Diakonie und Evangelisation. Der Fokus liegt auf der Rolle und dem Platz der Diakonie innerhalb der Kirche, wie Wichern sie verstand. Das Kapitel untersucht Wicherns praktische Umsetzung seiner Ideen, insbesondere im "Rauhen Haus" und deren Bedeutung für die Entwicklung der sozialen Arbeit.
Schlüsselwörter
Johann Hinrich Wichern, Innere Mission, Diakonie, Evangelisation, Rauhes Haus, Sozialpolitik, Industrielle Revolution, Kirchenverständnis, 19. Jahrhundert, Missionarische Diakonie, Diakonische Mission.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Johann Hinrich Wichern: Mission und Diakonie im 19. Jahrhundert"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Verständnis von Mission und Diakonie bei Johann Hinrich Wichern im 19. Jahrhundert. Sie beleuchtet sein Leben, Wirken und seine theologischen Vorstellungen, insbesondere sein Kirchenverständnis vor 1843. Die Arbeit analysiert das Verhältnis zwischen Mission und Diakonie in Wicherns Werk und die daraus resultierenden neuen Verhältnisbestimmungen. Ein Schwerpunkt liegt auf Wicherns Verständnis der Inneren Mission und der Diakonie.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Wicherns Leben und Wirken im Kontext der Industrialisierung; das Verhältnis von Mission und Diakonie im Denken Wicherns; Wicherns Verständnis der Inneren Mission; Wicherns Konzept der Diakonie und seine Umsetzung im "Rauhen Haus"; und der Ort der Diakonie innerhalb der Kirche nach Wichern.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in drei Kapitel gegliedert: Kapitel 1 beleuchtet die Hintergründe zu Johann Hinrich Wichern, einschließlich seines Lebens, Wirkens und Kirchenverständnisses vor 1843. Kapitel 2 untersucht das Verhältnis zwischen Mission und Diakonie, ihre historische Entwicklung und die neuen Verhältnisbestimmungen, die sich aus Wicherns Werk ergeben. Kapitel 3 befasst sich mit Wicherns Verständnis der Inneren Mission, Evangelisation und Diakonie, seiner Rolle als Vordenker und der Umsetzung seiner Ideen im "Rauhen Haus". Die Arbeit enthält außerdem ein Vorwort, ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Was ist das zentrale Argument der Arbeit?
Die Arbeit argumentiert, dass Wicherns Verständnis von Mission und Diakonie untrennbar miteinander verbunden war und eine neue Verhältnisbestimmung zwischen beiden Bereichen schuf. Sein soziales Engagement im "Rauhen Haus" ist untrennbar mit seinem theologischen Verständnis verknüpft und zeigt seine innovative Interpretation der Inneren Mission und der Diakonie im Kontext der gesellschaftlichen Herausforderungen des 19. Jahrhunderts.
Welche Quellen werden verwendet?
Die genaue Quellenangabe ist im Text selbst nicht aufgeführt. Die Arbeit bezieht sich jedoch implizit auf Wicherns Schriften, biographische Quellen und historische Dokumente zur Sozialgeschichte des 19. Jahrhunderts.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an Personen, die sich für Johann Hinrich Wichern, die Geschichte der Inneren Mission und Diakonie, die Sozialgeschichte des 19. Jahrhunderts und die theologischen Fragen der Mission und Diakonie interessieren. Sie eignet sich insbesondere für Studierende der Theologie, Sozialwissenschaften und Geschichte.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Johann Hinrich Wichern, Innere Mission, Diakonie, Evangelisation, Rauhes Haus, Sozialpolitik, Industrielle Revolution, Kirchenverständnis, 19. Jahrhundert, missionarische Diakonie, diakonische Mission.
- Quote paper
- Mirjam Lang (Author), 2011, Mission, Evangelisation und Diakonie bei Johann Hinrich Wichern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/195669