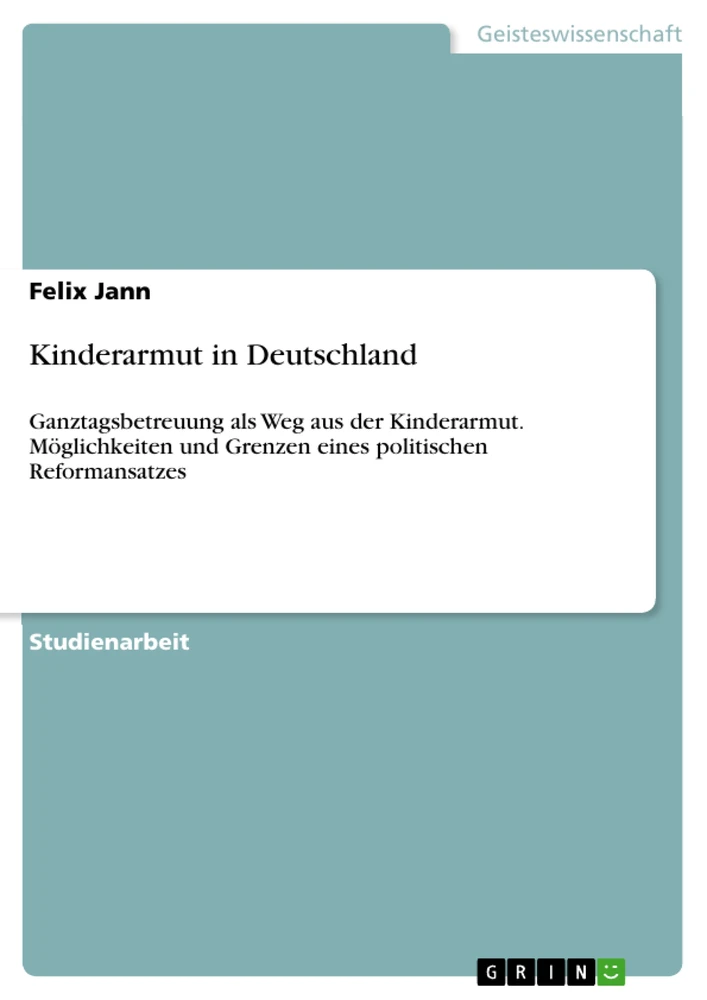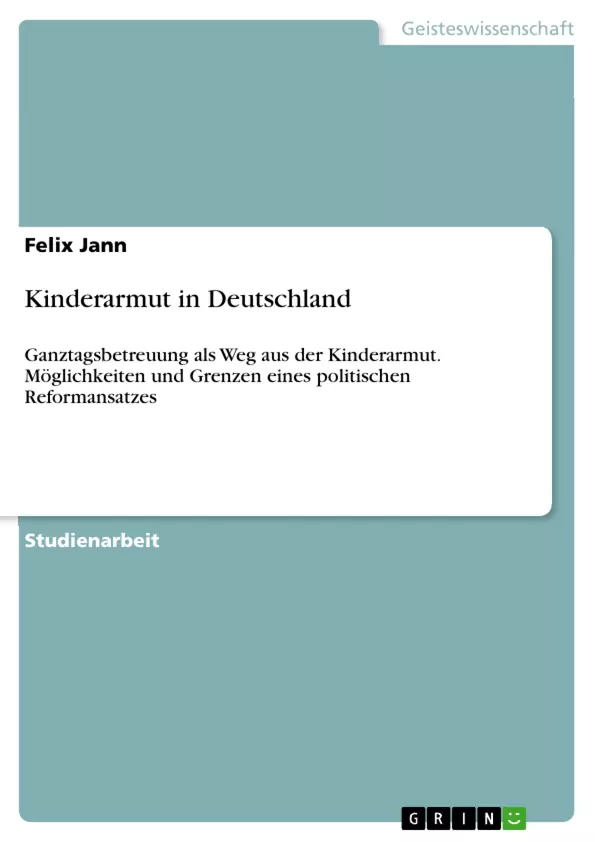Eine Schülerin der 8. Klasse aus dem Bundesland Brandenburg wurde gefragt, wie sie sich Verhalten würde, wenn sie von Armut betroffen wäre. Sie sagte, dass sie es lange nicht glauben würde und darüber sehr traurig wäre. Sie würde es zunächst für sich behalten, bevor sie es ihrer besten Freundin anvertrauen würde. Armut macht betroffen und stumm. (Vgl. Butterwegge 2000, S. 270)
Diese Aussage verdeutlicht, dass Armut ein Tabuthema in unsere Gesellschaft ist und dass man versucht, es so lange wie möglich, für sich zu behalten. Aufgrund dieser Tatsache muss über Armut gesprochen werden, um Veränderungen herbeizuführen.
Nach wie vor leugnet bzw. verdrängt die Gesellschaft das Problem der Kinderarmut (vgl. Butterwegge, Klundt, Zeng 2005, S. 10).
Mehr als 2,5 Millionen Mädchen und Jungen, also etwa jedes sechste Kind, leben in Deutschland von Sozialhilfe und damit in Armut. Das geht aus einem Bericht des “Kinderreports 2007“ des Kinderhilfswerks hervor. (vgl. SPIEGEL-ONLINE 2010).
In diesem Zusammenhang stellt sich zwangsläufig die Frage, was gegen die zunehmende Verarmung von Kindern und deren Familien getan werden kann.
Gerade Kinder bedürfen der Zuwendung und Hilfe, denn sie sind es, die ohne ihr Zutun in Armut geraten und leiden stärker als Erwachsene unter deren Folgen (vgl. Butterwegge 2000, S. 271).
Ein Lösungsansatz ist in der zunehmenden Einführung sowie dem Ausbau öffentlicher Ganztagsbetreuung in Deutschland zu finden. Daher befasst sich die vorliegende Arbeit mit der folgenden Frage: „Ist die öffentliche Ganztagsbetreuung von Kindern ein adäquates Mittel, um die Kinderarmut in Deutschland einzudämmen?“
Hauptanliegen dieser Arbeit ist es, die Benachteiligungen in den unterschiedlichen Lebenslagen der von Armut betroffenen Kinder zu beleuchten und zu hinterfragen, inwieweit die öffentliche Ganztagsbetreuung in der Lage ist, diese Benachteiligungen
auszugleichen bzw. abzumildern. Die vorliegende Arbeit nähert sich diesem Thema, indem sie zunächst Definitionen anführt, die Ursachen und Folgen der Kinderarmut sowie die Aufgaben der Kindertagesstätte und der Ganztagsschule benennt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition von Armut
- Absolute und relative Armut
- Lebenslagenansatz
- Ursachen von Kinderarmut
- Auflösung der klassischen Familie
- Auflösung des Normalarbeitsverhältnisses
- Folgen der Armut für Kinder
- Gesundheitliche Auswirkungen der Armut auf die
- Benachteiligung der Kinder im Bildungsverlauf.
- Öffentliche Ganztagsbetreuung
- Aufgaben der Kindertagesstätte
- Aufgaben der Ganztagsschule
- Ganztagsbetreuung als Weg aus der Kinderarmut
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht, ob die öffentliche Ganztagsbetreuung von Kindern ein adäquates Mittel ist, um die Kinderarmut in Deutschland einzudämmen. Sie beleuchtet die Benachteiligungen von armutsbetroffenen Kindern in verschiedenen Lebenslagen und hinterfragt, inwieweit die öffentliche Ganztagsbetreuung diese Benachteiligungen ausgleichen oder abmildern kann. Hierzu werden Definitionen von Armut, Ursachen und Folgen der Kinderarmut sowie die Aufgaben von Kindertagesstätten und Ganztagsschulen beleuchtet.
- Definition von Armut und deren unterschiedliche Ausprägungen
- Ursachen von Kinderarmut, insbesondere die Auflösung traditioneller Familienstrukturen und des Normalarbeitsverhältnisses
- Folgen der Armut für Kinder, insbesondere im Hinblick auf Gesundheit und Bildung
- Die Rolle der öffentlichen Ganztagsbetreuung als potenzielles Instrument zur Bekämpfung der Kinderarmut
- Die Aufgaben von Kindertagesstätten und Ganztagsschulen im Kontext der Kinderarmut
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Problem der Kinderarmut in Deutschland dar und erläutert die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit. Im Anschluss werden verschiedene Ansätze zur Definition von Armut vorgestellt, wobei sowohl statistische Definitionen (absolute und relative Armut) als auch der Lebenslagenansatz betrachtet werden. Die Ursachen für Kinderarmut werden im dritten Kapitel analysiert, wobei insbesondere die Auflösung der klassischen Familie und des Normalarbeitsverhältnisses im Fokus stehen. Das vierte Kapitel befasst sich mit den Folgen der Armut für Kinder, insbesondere in Bezug auf Gesundheit und Bildung. Das fünfte Kapitel widmet sich der öffentlichen Ganztagsbetreuung und deren möglichen Rolle im Kampf gegen Kinderarmut, indem es die Aufgaben von Kindertagesstätten und Ganztagsschulen beleuchtet.
Schlüsselwörter
Kinderarmut, Armut, relative Armut, absolute Armut, Lebenslagenansatz, Ganztagsbetreuung, Kindertagesstätte, Ganztagsschule, Bildung, Gesundheit, soziale Benachteiligung, Auflösung der Familie, Normalarbeitsverhältnis, Individualisierung, Pluralisierung der Lebensstile.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird Kinderarmut in Deutschland definiert?
Es wird zwischen absoluter Armut (Unterschreiten des Existenzminimums) und relativer Armut (Einkommen deutlich unter dem Durchschnitt) unterschieden, wobei oft der Lebenslagenansatz genutzt wird.
Was sind die Hauptursachen für zunehmende Kinderarmut?
Zentrale Ursachen sind die Auflösung klassischer Familienstrukturen (Zunahme von Alleinerziehenden) sowie die Erosion von Normalarbeitsverhältnissen durch prekäre Beschäftigung.
Welche Folgen hat Armut für die Gesundheit von Kindern?
Armut führt oft zu schlechterer Ernährung, mangelnder gesundheitlicher Vorsorge und einer höheren Anfälligkeit für chronische Erkrankungen im Vergleich zu Kindern aus wohlhabenderen Familien.
Kann Ganztagsbetreuung Kinderarmut eindämmen?
Die Arbeit untersucht, ob öffentliche Ganztagsbetreuung Benachteiligungen im Bildungsverlauf ausgleichen und Eltern die Rückkehr in den Beruf erleichtern kann, um die finanzielle Lage der Familie zu verbessern.
Warum ist Armut ein Tabuthema bei Kindern?
Betroffene Kinder empfinden oft Scham und versuchen, ihre Situation vor Freunden zu verbergen, um nicht stigmatisiert zu werden, was zu sozialer Isolation führen kann.
- Quote paper
- Felix Jann (Author), 2010, Kinderarmut in Deutschland , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/195753