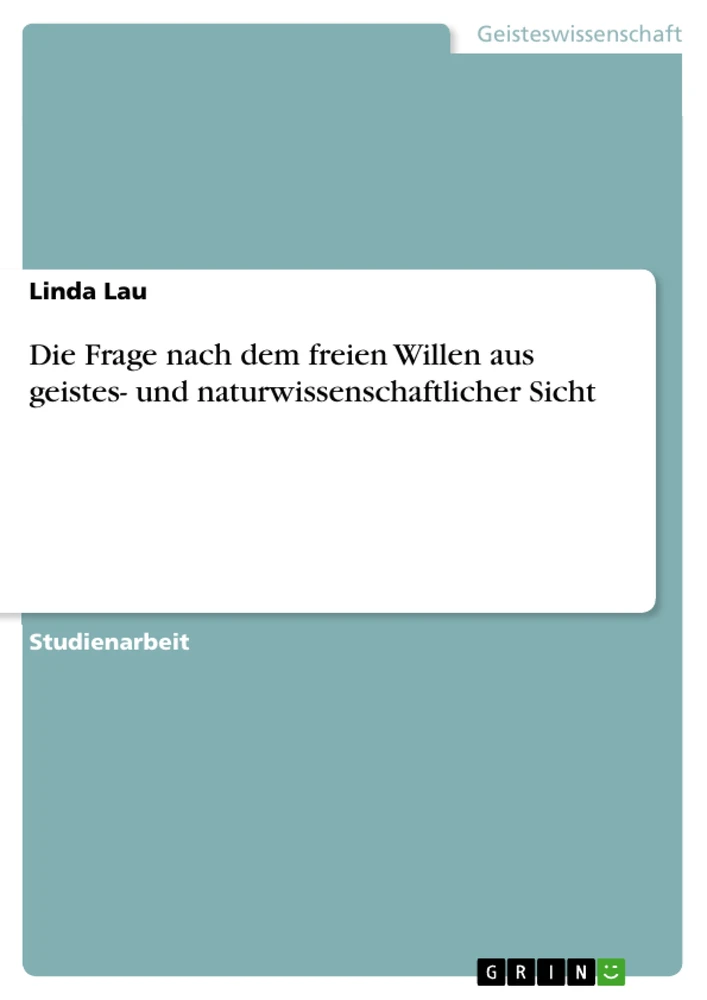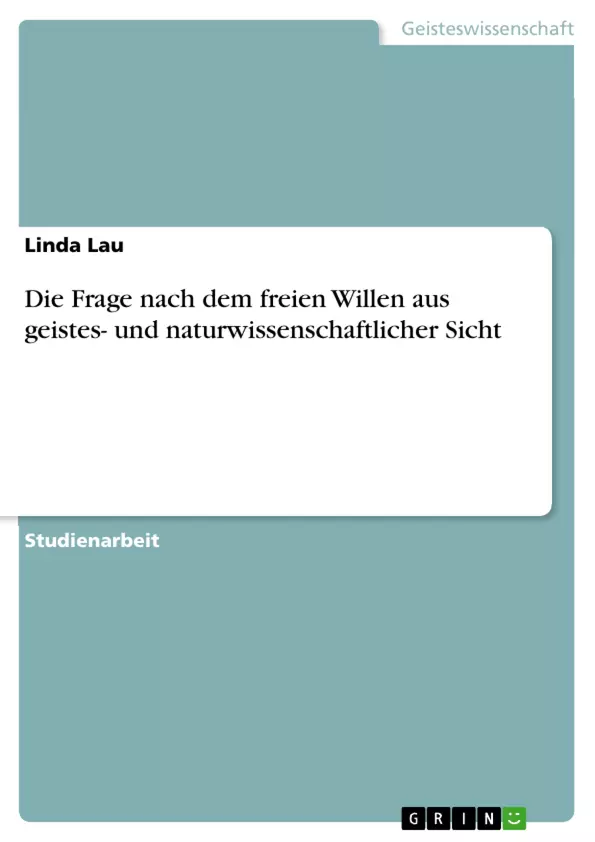Die Frage nach dem freien Willen ist eine Frage, die Menschen seit je her beschäftigt und zu weitreichenden Diskussionen geführt hat. Heutzutage sorgt besonders der Widerspruch zwischen der Alltagsdefinition von Freiheit und neueren Ergebnissen aus der Neurobiologie für Aufruhr.
Neurowissenschaftler behaupten, den freien Willen als eine Illusion entlarvt zu haben. Zwar würden Menschen ihr Denken, Wollen und Handeln innerhalb gegebener Einschränkungen als frei empfinden, in Wirklichkeit sei jedoch „der subjektiv empfundene Willensakt […] nicht die Ursache, sondern [lediglich] ein Bewusstseinskorrelat von Willkürhandlungen, die vom Gehirn vorbereitet und gesteuert werden.“1 Auch Martin Luther ist der Überzeugung, dass der menschliche Wille nicht frei sein könne, da „Gott alles mit unwandelbarem, ewigem und unfehlbarem Willen sowohl vorhersieht, sich vornimmt und ausführt.“2 Neben diesen Positionen, die dem Menschen seinen freien Willen absprechen, gibt es eine Reihe von Geisteswissenschaftlern, die den gegensätzlichen Standpunkt vertreten, dass neuro-wissenschaftliche Ergebnisse die Freiheit des menschlichen Willens nicht außer Kraft setzen könne.
In dieser Arbeit soll vordergründig die Frage erörtert werden, wie die teilweise entgegengesetzten und sich gänzlich widersprechenden Perspektiven auf den Freiheitsbegriff überhaupt zusammengedacht werden können. Diesbezüglich werde ich zunächst die theologische Perspektive anhand von Luthers Theologie skizzieren, dann die Ergebnisse der Neurobiologie anhand der Standpunkte von Wolf Singer und Gerhard Roth erläutern und anschließend auch die soziologische Perspektive kurz umreißen.
Was das ausgeprägte Spannungsverhältnis zwischen Natur- und Geisteswissenschaft betrifft, werden Argumentationen von Peter Bieri und Matthias Jung herangezogen. Da die Frage nach dem freien Willen des Menschen immer auch die Frage der persönlichen Verantwortlichkeit mit einschließt, soll im Anschluss auch auf die Problematik eines möglichen Determinismus – sowohl bei Luther als auch in der Neurowissenschaft – und auf die damit verbundene Frage der Schuldfähigkeit des Einzelnen eingegangen werden. Letztendlich wäre auch die Frage zu klären, in welchem Zusammenhang moderne, wissenschaftliche Theorien zu Luthers theologisch ausgerichteter Argumentation stehen und ob die Hirnforschung Luthers Theologie außer Kraft setzen kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theologische Perspektive: Luthers Freiheitsverständnis
- ,,Vom unfreien Willen”
- ,,Von der Freiheit eines Christenmenschen”
- Neurobiologische Perspektive
- nach Wolf Singer
- nach Gerhard Roth
- Die Antwort der Soziologie
- Das (Spannungs-)Verhältnis von Natur- und Geisteswissenschaft
- Kompatible Freiheit nach Peter Bieri
- Artikulierte Freiheit nach Matthias Jung
- Die Frage des Determinismus und der Schuldfähigkeit
- bzgl. Luthers Theorie
- bzgl. neurobiologischer Ergebnisse
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage des freien Willens aus unterschiedlichen Perspektiven, insbesondere der theologischen und neurobiologischen. Sie untersucht den Widerspruch zwischen der Alltagsdefinition von Freiheit und neuen neurobiologischen Erkenntnissen, die den freien Willen als Illusion bezeichnen. Der Text analysiert die gegensätzlichen Standpunkte und untersucht, ob sie miteinander vereinbar sind.
- Luthers theologische Perspektive auf den freien Willen und seine Kritik an der menschlichen Fähigkeit zur Selbststeuerung
- Die neurobiologischen Erkenntnisse über den freien Willen, insbesondere die Ansichten von Wolf Singer und Gerhard Roth
- Die Frage des Determinismus und der Schuldfähigkeit in Bezug auf Luthers Theologie und neurobiologische Ergebnisse
- Das Spannungsverhältnis zwischen Natur- und Geisteswissenschaft im Kontext der Debatte über den freien Willen
- Die Vereinbarkeit von wissenschaftlichen Theorien mit Luthers theologischen Ansichten und die Frage, ob die Hirnforschung Luthers Theologie außer Kraft setzen kann
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Frage nach dem freien Willen als eine seit jeher bestehende und gegenwärtig durch neurowissenschaftliche Erkenntnisse neu aufgeflammte Debatte vor. Sie beleuchtet den Widerspruch zwischen der empfundenen Freiheit und der wissenschaftlichen Behauptung, der freie Wille sei eine Illusion. Der Text skizziert die zentralen Standpunkte in der Debatte und die zu untersuchenden Perspektiven.
- Theologische Perspektive: Luthers Freiheitsverständnis: Dieser Abschnitt beleuchtet Luthers Verständnis des freien Willens, das er auf die Schrift und die eigene Erfahrung stützt. Er stellt Luthers Argumentation gegen Erasmus dar, der dem menschlichen Willen eine größere Bedeutung zuschreibt. Luther betont die absolute Macht Gottes und die Unfähigkeit des Menschen, durch eigene Kraft zum Heil zu gelangen. Er verwendet die Reittier-Metapher, um den Willen des Menschen als von Gott und Satan beeinflusst darzustellen.
Schlüsselwörter
Freier Wille, Theologische Perspektive, Luthers Theologie, Neurobiologie, Determinismus, Schuldfähigkeit, Natur- und Geisteswissenschaft, Spannungsverhältnis, Kompatible Freiheit, Artikulierte Freiheit.
Häufig gestellte Fragen
Ist der freie Wille laut der modernen Neurobiologie eine Illusion?
Viele Neurowissenschaftler wie Wolf Singer und Gerhard Roth argumentieren, dass der freie Wille eine Illusion ist, da Handlungen vom Gehirn vorbereitet werden, bevor sie uns bewusst werden.
Wie begründet Martin Luther die Unfreiheit des menschlichen Willens?
Luther vertritt die Ansicht, dass der menschliche Wille unfrei ist, da Gott alles mit ewigem und unfehlbarem Willen vorhersieht und lenkt. Der Mensch könne nicht aus eigener Kraft zum Heil gelangen.
Was besagt die Reittier-Metapher von Luther?
Luther vergleicht den menschlichen Willen mit einem Reittier, das entweder von Gott oder vom Satan geritten wird, ohne dass der Mensch selbst entscheiden kann, wer sein Reiter ist.
Was versteht Peter Bieri unter "kompatibler Freiheit"?
Peter Bieri vertritt einen geisteswissenschaftlichen Standpunkt, der versucht, die Freiheit des Willens mit den Erkenntnissen der Naturwissenschaften in Einklang zu bringen (Kompatibilismus).
Welche Konsequenzen hat der Determinismus für die Schuldfähigkeit?
Wenn Handlungen rein biologisch determiniert sind, stellt sich die Frage, ob ein Individuum für seine Taten moralisch und rechtlich verantwortlich gemacht werden kann, was weitreichende Folgen für das Strafrecht hätte.
Kann die Hirnforschung Luthers Theologie außer Kraft setzen?
Obwohl beide Disziplinen zum Schluss kommen, dass der Wille nicht vollkommen frei ist, basieren sie auf unterschiedlichen Argumentationsebenen (Glaube vs. empirische Messung), die in der Arbeit gegenübergestellt werden.
- Arbeit zitieren
- Linda Lau (Autor:in), 2012, Die Frage nach dem freien Willen aus geistes- und naturwissenschaftlicher Sicht, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/195799