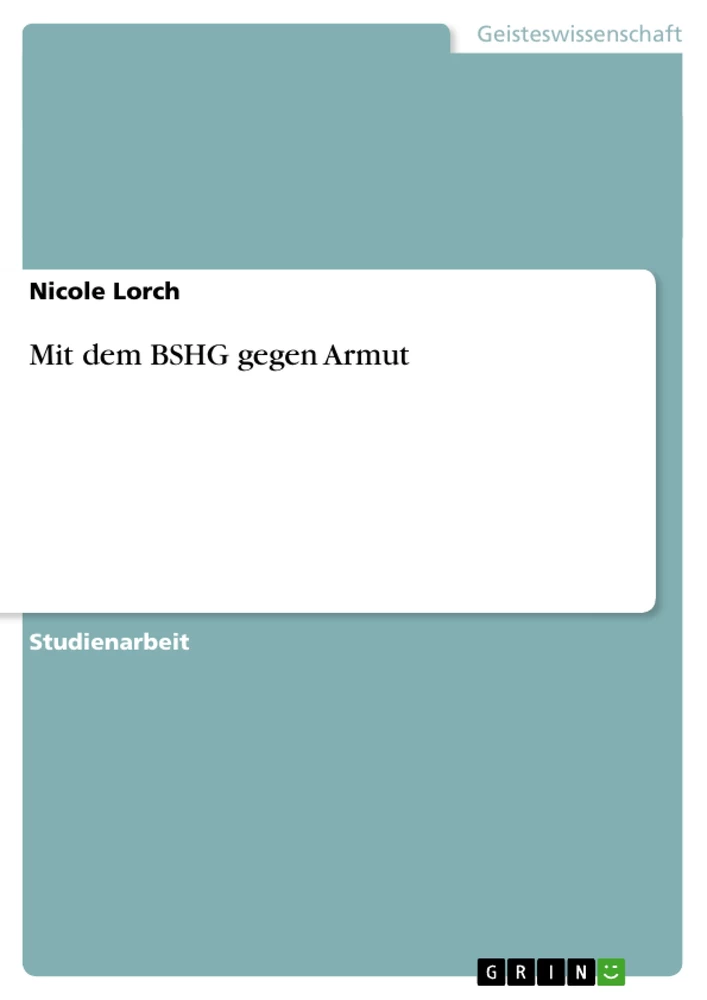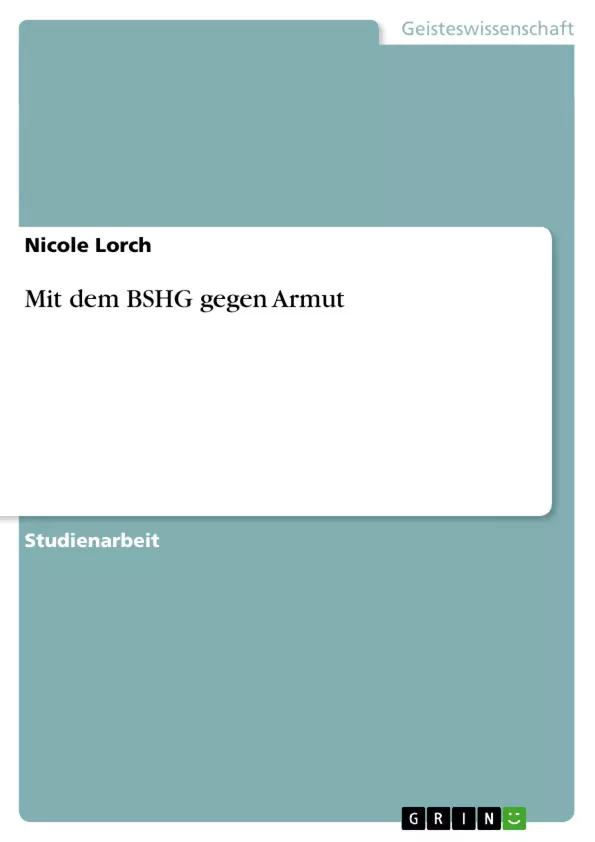Die Bundesrepublik bezeichnet sich als "sozialen Bundesstaat", doch im Grundgesetz kommt der Begriff des "Sozialstaates" nicht vor, selbst das Wort "sozial" wird nicht genauer definiert. Nach dem BSHG hat jeder Bedürftige einen Rechtsanspruch auf Hilfe, dies legt nahe, dass Sozialpolitik die sozialen Notlagen lindern, wenn nicht gar beseitigen soll. (vgl. Bellermann, 2001, S. 9ff) Trotz allem gibt es viele Familien, Alleinerziehende, RentnerInnen und Obdachlose, die unter dem Sozialhilfeniveau leben. Die Dunkelziffer der Armut ist hierbei sehr hoch, weshalb sich die Frage stellen muss, ob das soziale Sicherungssystem entgegen seines eigenen Anspruchs, Not zu verhindern, diese sozialen Notlagen erst systematisch zulässt. (vgl. Wagner, 1991, S. 57f.)
Auf der Ebene der Sozialhilfeträger hat sich die Tendenz fortgesetzt, das Verwaltungshandeln nach betriebswirtschaftlichen Effizienzkriterien auszurichten. Nicht mehr die ordnungsgemäße Erfüllung gesetzlicher Aufgaben ist das Leitbild, vielmehr Wirtschaftlichkeit und Effektivität der Leistungserbringung um die Haushalte von störenden Sozialhilfeausgaben zu entlasten. (vgl. Brühl, 2000, S.V) Ich werde in dieser Hausarbeit die Entwicklung des bundesdeutschen Sozialstaates im Hinblick auf die Umgehensweise mit Armut beschreiben. Das "Haus der sozialen Sicherung" werde ich darstellen um anhand des Bundessozialhilfegesetzes (BSHG) einen genaueren Einblick in das Teilgebiet der sozialen Sicherung zu verschaffen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bedeutung von Armut
- Das soziale Sicherungssystem
- Das Dach (Versorgungs- und Ausgleichsprinzip)
- Das Fundament (Fürsorgeprinzip)
- Die fünf Säulen (Versicherungsprinzip)
- Sozialhilfe als Beispiel sozialer Sicherung
- Rechtliche Grundlagen
- Hintergrund
- Nachrang und Ausrichtung
- Einsatz der Arbeitskraft
- Sozialhilfe und Armut
- Armut trotz Sozialstaat?
- Armut von Familien
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Entwicklung des bundesdeutschen Sozialstaates und beleuchtet die Frage, ob das soziale Sicherungssystem trotz seines Anspruchs, soziale Notlagen zu verhindern, diese nicht vielmehr systematisch zulässt. Dabei wird das „Haus der sozialen Sicherung“ dargestellt und anhand des Bundessozialhilfegesetzes (BSHG) ein genauerer Einblick in das Teilgebiet der sozialen Sicherung gewährt.
- Die Bedeutung von Armut in Deutschland, inklusive der Analyse von Armutsquoten und Risikofaktoren.
- Die Struktur des sozialen Sicherungssystems und die verschiedenen Prinzipien wie das Versorgungsprinzip, das Fürsorgeprinzip und das Versicherungsprinzip.
- Die Rolle der Sozialhilfe im sozialen Sicherungssystem, einschließlich ihrer rechtlichen Grundlagen, ihrer Funktion im Hinblick auf die Armutsbekämpfung und den Umgang mit der Arbeitskraft.
- Die Frage, ob die Sozialhilfe den Anspruch auf Armutsbekämpfung erfüllt oder ob sie trotz Sozialstaates zur systematischen Zulassung von Armut beiträgt.
- Die Problematik der Armut von Familien und der besonderen Herausforderungen für Alleinerziehende.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Diese Einleitung stellt die These auf, dass das deutsche soziale Sicherungssystem, trotz seines Selbstverständnisses als „sozialer Bundesstaat“, möglicherweise systematisch soziale Notlagen zulässt. Es wird auf die hohen Armutsquoten in Deutschland hingewiesen und die Frage gestellt, ob das soziale Sicherungssystem trotz seiner Ziele diese Notlagen tatsächlich verhindern kann.
Bedeutung von Armut
Dieses Kapitel fasst die wichtigsten Ergebnisse des Armutsberichts (Stand 2000) der Hans Böckler-Stiftung, des DGB und des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes zusammen. Es wird auf die regionalen Unterschiede in der Armutsquote hingewiesen, die Situation von Erwerbstätigen mit Kindern beleuchtet und die besondere Armutsgefährdung von Arbeitslosen, Familien und Migranten hervorgehoben.
Das soziale Sicherungssystem
Dieses Kapitel beschreibt das deutsche soziale Sicherungssystem als „Haus der sozialen Sicherung“ und erläutert die drei wichtigsten Prinzipien: das Versorgungsprinzip, das Versicherungsprinzip und das Fürsorgeprinzip. Dabei wird die Finanzierung und Funktionsweise jedes Prinzips detailliert dargestellt.
Das Dach (Versorgungs- und Ausgleichsprinzip)
Dieser Abschnitt erläutert die Leistungen des Versorgungs- und Ausgleichsprinzips, darunter soziale Ausgleichsleistungen wie Kindergeld, Wohngeld und Bafög, soziale Entschädigungsleistungen wie die Kriegsversehrtenrente und die soziale Versorgung für Beamte. Es wird auch das „Gießkannenprinzip“ kritisiert, da die Leistungen oft nicht ausreichend sind, um den Bedarf in Notlagen zu decken.
Das Fundament (Fürsorgeprinzip)
Dieser Abschnitt erläutert die Leistungen des Fürsorgeprinzips, darunter Sozialhilfe und Kinder- und Jugendhilfe. Es wird betont, dass diese Leistungen als letzte Maßnahme gelten, die nur greifen, wenn der Einzelne sich nicht mehr selbst helfen kann. Das Subsidiaritäts- oder Nachrangprinzip wird erklärt und die Bedürftigkeitsprüfung für diese Leistungen betont.
Sozialhilfe als Beispiel sozialer Sicherung
Dieses Kapitel betrachtet die Sozialhilfe im Detail und beleuchtet ihre rechtlichen Grundlagen, ihre Funktion im Hinblick auf die Armutsbekämpfung und den Umgang mit der Arbeitskraft.
Rechtliche Grundlagen
Dieser Abschnitt behandelt die rechtlichen Grundlagen der Sozialhilfe und die Ansprüche, die Bedürftigen haben.
Hintergrund
Dieser Abschnitt beleuchtet den Hintergrund und die Entstehung der Sozialhilfe.
Nachrang und Ausrichtung
Dieser Abschnitt beschreibt die Rolle der Sozialhilfe als letzte Maßnahme und die verschiedenen Ausrichtungen, die sie verfolgt, um soziale Notlagen zu lindern.
Einsatz der Arbeitskraft
Dieser Abschnitt untersucht, wie die Sozialhilfe den Einsatz der Arbeitskraft der Leistungsempfänger fördert und die Herausforderungen dabei.
Sozialhilfe und Armut
Dieses Kapitel setzt sich mit der Frage auseinander, ob die Sozialhilfe trotz Sozialstaates zur systematischen Zulassung von Armut beiträgt. Es werden die Argumente pro und contra beleuchtet und die Situation von Familien und Alleinerziehenden im Fokus betrachtet.
Armut trotz Sozialstaat?
Dieser Abschnitt befasst sich mit der Frage, ob das soziale Sicherungssystem trotz seiner Ziele die Armut in Deutschland effektiv bekämpfen kann.
Armut von Familien
Dieser Abschnitt beleuchtet die besondere Situation von Familien in Armut und die Herausforderungen, die ihnen im Bezug auf die Sozialhilfe und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf begegnen.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Hausarbeit sind: Sozialstaat, Armut, soziales Sicherungssystem, Versorgungsprinzip, Fürsorgeprinzip, Versicherungsprinzip, Sozialhilfe, Bundessozialhilfegesetz (BSHG), Bedürftigkeitsprüfung, Familienarmut, Alleinerziehende, Arbeitslosigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das BSHG?
Das Bundessozialhilfegesetz (BSHG) regelte den Rechtsanspruch auf Hilfe für Bedürftige in Deutschland (vor den Hartz-Reformen).
Was sind die drei Säulen des sozialen Sicherungssystems?
Das System basiert auf dem Versorgungsprinzip (Dach), dem Versicherungsprinzip (Säulen) und dem Fürsorgeprinzip (Fundament).
Warum gibt es trotz Sozialstaat Armut?
Die Arbeit hinterfragt, ob das System Notlagen teils systematisch zulässt, etwa durch zu niedrige Sätze oder den Fokus auf betriebswirtschaftliche Effizienz der Träger.
Welche Gruppen sind besonders von Armut betroffen?
Besonders gefährdet sind Alleinerziehende, kinderreiche Familien, Arbeitslose und Migranten.
Was besagt das Nachrangprinzip in der Sozialhilfe?
Sozialhilfe wird erst gewährt, wenn der Einzelne sich nicht mehr selbst helfen kann und keine anderen Leistungen (wie Versicherungen) greifen.
- Citation du texte
- Nicole Lorch (Auteur), 2003, Mit dem BSHG gegen Armut, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/19582