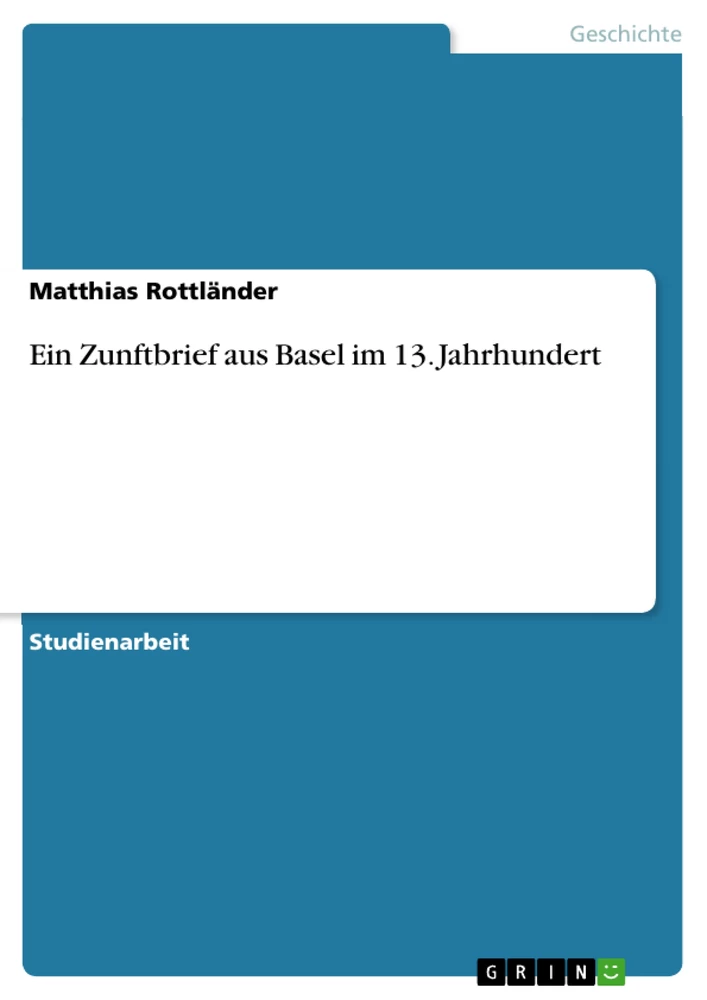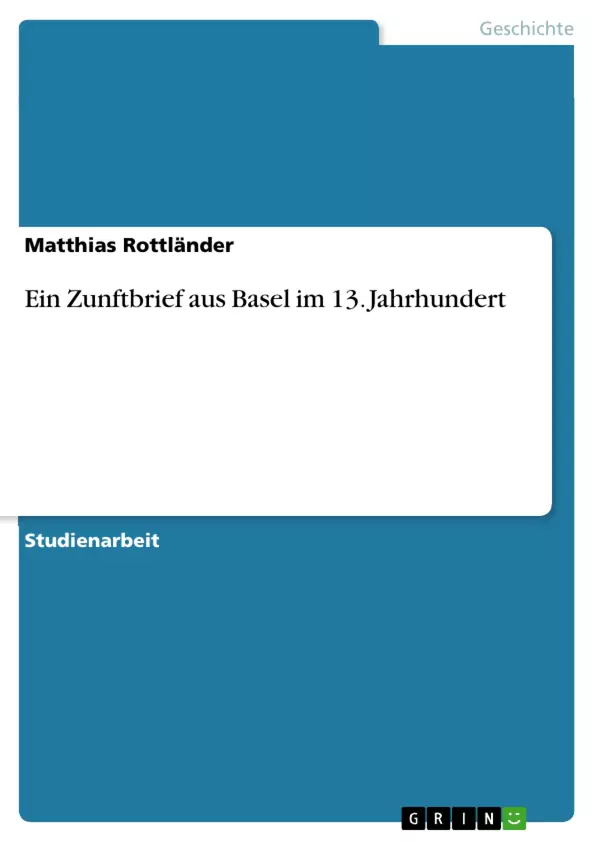Ein Basler Zunftbrief für die Gärtner, Obster und Lebensmittelhändler eröffnet einen interessanten und detaillierten Einblick in die Organisations- und Funktionsstrukturen der Zünfte im spätmittelalterlichen Basel in der Mitte des 13. Jahrhunderts und erlaubt darüber hinaus weitere Erkenntnisse über die Entwicklung des Zunftwesens im Allgemeinen.
Inhaltverzeichnis
1. Einleitung und Entwicklung der Fragestellung
2. Hauptteil
2.1. Der historische Kontext der Quelle: Das Bistum Basel im Spätmittelalter
2.2. Der Zunftbrief für die Gärtner, Obster und Lebensmittelhändler in Basel 126[4-1269]
3. Resümee
4. Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Zunftbrief?
Ein Zunftbrief ist ein offizielles Dokument, das die Regeln, Rechte und Pflichten einer Zunft (einer Vereinigung von Handwerkern oder Händlern) festlegt.
Welche Berufsgruppen werden in diesem Basler Zunftbrief genannt?
Der Brief betrifft die Gärtner, Obster (Obst-Händler) und Lebensmittelhändler im spätmittelalterlichen Basel.
Aus welcher Zeit stammt das Dokument genau?
Die Quelle wird auf den Zeitraum zwischen 1264 und 1269 datiert, also in die Mitte des 13. Jahrhunderts.
Welche Einblicke bietet der Zunftbrief in das mittelalterliche Basel?
Er erlaubt detaillierte Erkenntnisse über die Organisations- und Funktionsstrukturen der Zünfte sowie über das Bistum Basel im Spätmittelalter.
Warum ist dieser Zunftbrief für Historiker wichtig?
Er dient als wichtige Primärquelle, um die allgemeine Entwicklung des Zunftwesens und die wirtschaftliche Struktur einer bedeutenden Stadt im 13. Jahrhundert zu verstehen.
- Arbeit zitieren
- Matthias Rottländer (Autor:in), 2010, Ein Zunftbrief aus Basel im 13. Jahrhundert, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/195836