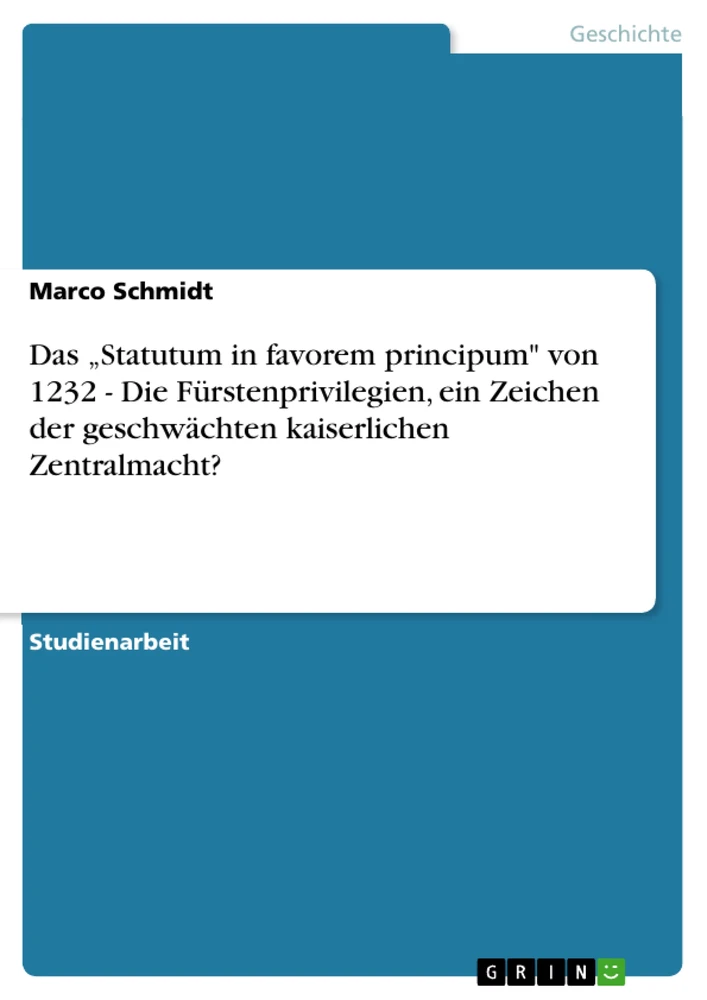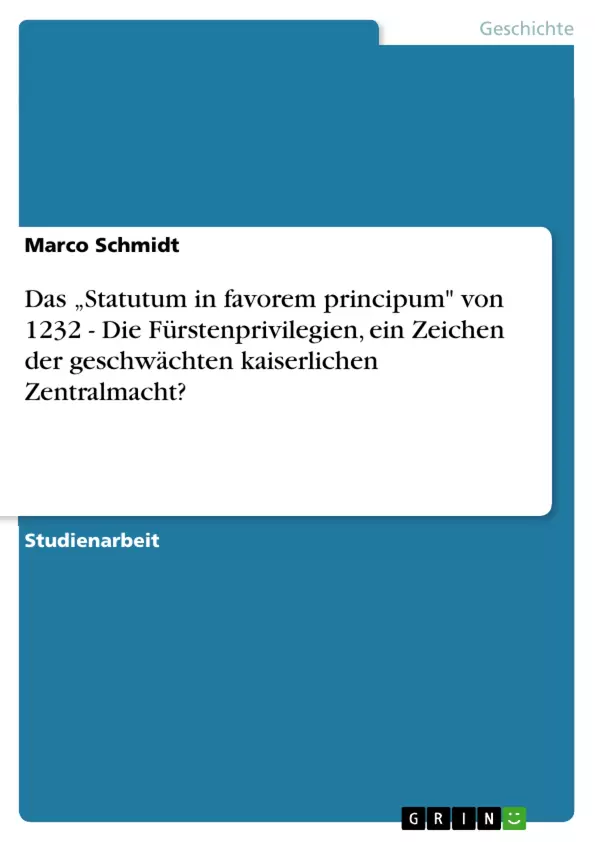Unter den Fürstenprivilegien Friedrichs II. von Hohenstaufen werden die Privilegien verstanden, die im Jahre 1220 den geistlichen und in den Jahren 1231/1232 den weltlichen Reichsfürsten erteilt wurden. Seit dem 19. Jahrhundert wird das erste der beiden als „Confoederatio cum principibus eccelesiasticis“ und das zweite als „Statutum in favorem principum“ bezeichnet.
Die folgende Arbeit befasst sich mit dem bedeutendsten Fürstenprivileg der Staufer, dem „Statutum in favorem principum" – das Gesetz zugunsten der Landesherren.
Bei dem 1231 von König Heinrich VII. erlassenen und dem im Mai 1232 von Kaiser Friedrich II. in Cividale bestätigten Privileg zugunsten der weltlichen Fürsten handelt es sich um eine gesetzliche Festschreibung und Bestätigung der fürstlichen Regalien in 23 Artikeln. In seinen Bestimmungen schützt der Herrscher die Fürsten vor der Anlage neuer Städte (§ 1-5), sichert ihnen wichtige Rechte, wie etwa das Geleitrecht (§ 14), und spricht diese teilweise auch den Städten ab und überträgt ihnen auch weitreichende Lehnsrechte (§ 20 – 23).
Schließlich ist die Kaiserurkunde ein sehr bedeutsames Dokument, das den beginnenden Machtverfall des Kaisertums und den Aufstieg der Territorialfürsten markiert.
Ziel dieser Arbeit ist es, zunächst die Quelle formal und inhaltlich zu analysieren. Dabei wird das „Statutum“ zunächst in den historischen Kontext eingeordnet, um die Hintergründe für diesen Erlass zu verstehen. Anhand des Urkundenaufbaus soll wiederum nachgezeichnet werden in welcher Art und Weise der Erlass geschah. Die Fragestellung, welche Zugeständnisse Friedrich den Fürsten gegenüber gemacht hat und wie man diese bewerten könnte, soll den zentralen Analyseschwerpunkt bilden. Dabei sollen auch Merkmale staufischer Städtepolitik an den einzelnen Verfügungen des „Statutum“ deutlich gemacht werden.
Schließlich werden die Auswirkungen des „Statutum“ auf die Herrschaft aller Beteiligten beleuchtet. Die Analyseergebnisse sollen letztendlich die Frage beantworten können, ob die Fürstenprivilegien ein Zeichen der geschwächten kaiserlichen Zentralmacht waren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Quellenanalyse „Statutum in favorem principum“
- Historischer Kontext
- Aufbau der Urkunde
- Die Verfügungen des Statutums
- Auswirkungen des Statutums
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert das „Statutum in favorem principum“ von 1232, ein bedeutendes Fürstenprivileg Friedrichs II., um dessen Bedeutung für die spätstaufische Zeit zu ergründen. Die Analyse fokussiert auf die formale und inhaltliche Untersuchung der Urkunde, ihre Einordnung in den historischen Kontext und die Bewertung der darin enthaltenen Zugeständnisse an die Fürsten. Die Auswirkungen des Statutums auf die Herrschaft aller Beteiligten und die Frage nach einer geschwächten kaiserlichen Zentralmacht stehen im Mittelpunkt.
- Formale und inhaltliche Analyse des „Statutums“
- Einordnung des „Statutums“ in den historischen Kontext der spätstaufischen Zeit
- Bewertung der Zugeständnisse Friedrichs II. an die Fürsten
- Auswirkungen des „Statutums“ auf die Herrschaftsverhältnisse
- Bedeutung des „Statutums“ für die kaiserliche Zentralmacht
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Fürstenprivilegien Friedrichs II. ein, insbesondere in das „Statutum in favorem principum“ von 1232. Sie beschreibt das Statut als ein wichtiges Dokument, welches die fortschreitende Schwächung der kaiserlichen Macht und den Aufstieg der Territorialfürsten markiert. Die Arbeit hat zum Ziel, das Statut formal und inhaltlich zu analysieren, es in seinen historischen Kontext einzuordnen und die darin enthaltenen Zugeständnisse an die Fürsten zu bewerten. Die Auswirkungen auf die Herrschaft aller Beteiligten und die Frage, ob das Statut ein Zeichen geschwächter kaiserlicher Zentralmacht darstellt, bilden den zentralen Fokus der Untersuchung.
Quellenanalyse „Statutum in favorem principum“: Dieses Kapitel analysiert das „Statutum“ detailliert. Der historische Kontext beleuchtet Friedrich II.'s schwierige Regierungsübernahme und seine Politik, die auf einen zentralisierten Staat in Süditalien abzielte, jedoch ein ruhiges Deutsches Reich benötigte. Die Vergabe von Privilegien an die Fürsten wird als Mittel zur Sicherung dieser Ruhe dargestellt. Die Entstehung des „Statutums“ wird mit der Politik Heinrichs VII. in Verbindung gebracht, die zu Protesten der Fürsten führte und den kaiserlichen Erlass von 1232 ermöglichte. Der Aufbau der Urkunde, ihre Bestimmungen und deren Auswirkungen auf die Herrschaft aller Beteiligten werden ebenfalls diskutiert. Es wird auf die Gleichstellung weltlicher und geistlicher Fürsten durch die Übertragung fast aller Reichsrechte hingewiesen, sowie auf die Einschränkung der königlichen Stadtgründungen und die Stärkung des fürstlichen Rechts.
Schlüsselwörter
Statutum in favorem principum, Friedrich II., Hohenstaufen, Fürstenprivilegien, Kaiserliche Zentralmacht, Territorialfürsten, Reichsrechte, Städtepolitik, Heinrich VII., Stauferzeit, Regalien, Herrschaftsverhältnisse.
Häufig gestellte Fragen zum "Statutum in favorem principum"
Was ist das "Statutum in favorem principum" und worum geht es in der Arbeit?
Das "Statutum in favorem principum" von 1232 war ein bedeutendes Fürstenprivileg Kaiser Friedrichs II. Diese Arbeit analysiert dieses Statut, um dessen Bedeutung für die spätstaufische Zeit zu ergründen. Der Fokus liegt auf der formalen und inhaltlichen Untersuchung der Urkunde, ihrer Einordnung in den historischen Kontext und der Bewertung der darin enthaltenen Zugeständnisse an die Fürsten. Zentrale Fragen sind die Auswirkungen des Statutums auf die Herrschaftsverhältnisse und die Frage nach einer möglichen Schwächung der kaiserlichen Zentralmacht.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: die formale und inhaltliche Analyse des Statuts, seine Einordnung in den historischen Kontext der spätstaufischen Zeit, die Bewertung der Zugeständnisse Friedrichs II. an die Fürsten, die Auswirkungen des Statuts auf die Herrschaftsverhältnisse und dessen Bedeutung für die kaiserliche Zentralmacht.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, eine detaillierte Quellenanalyse des "Statutum in favorem principum" (mit Unterkapiteln zu historischem Kontext, Aufbau der Urkunde, Verfügungen und Auswirkungen), und ein Resümee. Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die Zielsetzung der Arbeit. Die Quellenanalyse untersucht das Statut im Detail, inklusive seines historischen Kontextes und seiner Auswirkungen. Das Resümee fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen.
Welche Kapitelzusammenfassungen bietet die Arbeit?
Die Einleitung präsentiert das "Statutum in favorem principum" als wichtiges Dokument, das die fortschreitende Schwächung der kaiserlichen Macht und den Aufstieg der Territorialfürsten markiert. Die Quellenanalyse beleuchtet Friedrich II.'s schwierige Regierungsübernahme und seine Politik, die Vergabe von Privilegien als Mittel zur Sicherung der Ruhe im Reich, die Entstehung des Statuts im Zusammenhang mit der Politik Heinrichs VII. und den Protesten der Fürsten, sowie den Aufbau, die Bestimmungen und die Auswirkungen der Urkunde auf die Herrschaft aller Beteiligten, inklusive der Gleichstellung weltlicher und geistlicher Fürsten und der Einschränkungen königlicher Stadtgründungen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Statutum in favorem principum, Friedrich II., Hohenstaufen, Fürstenprivilegien, Kaiserliche Zentralmacht, Territorialfürsten, Reichsrechte, Städtepolitik, Heinrich VII., Stauferzeit, Regalien, Herrschaftsverhältnisse.
Welchen Zweck verfolgt die Quellenanalyse des "Statutum in favorem principum"?
Die Quellenanalyse zielt darauf ab, das "Statutum in favorem principum" detailliert zu untersuchen, seinen historischen Kontext zu beleuchten und die darin enthaltenen Bestimmungen zu analysieren. Sie untersucht den Aufbau der Urkunde, die darin enthaltenen Verfügungen und deren Auswirkungen auf die Herrschaftsverhältnisse im Heiligen Römischen Reich.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit bezüglich der kaiserlichen Zentralmacht?
Die Arbeit untersucht, ob das "Statutum in favorem principum" ein Zeichen für eine geschwächte kaiserliche Zentralmacht darstellt. Dies wird durch die Analyse der Zugeständnisse an die Fürsten und deren Auswirkungen auf die Herrschaftsverhältnisse geprüft. Die genaue Schlussfolgerung wird im Resümee der Arbeit dargelegt.
- Arbeit zitieren
- Marco Schmidt (Autor:in), 2011, Das „Statutum in favorem principum" von 1232 - Die Fürstenprivilegien, ein Zeichen der geschwächten kaiserlichen Zentralmacht?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/195869