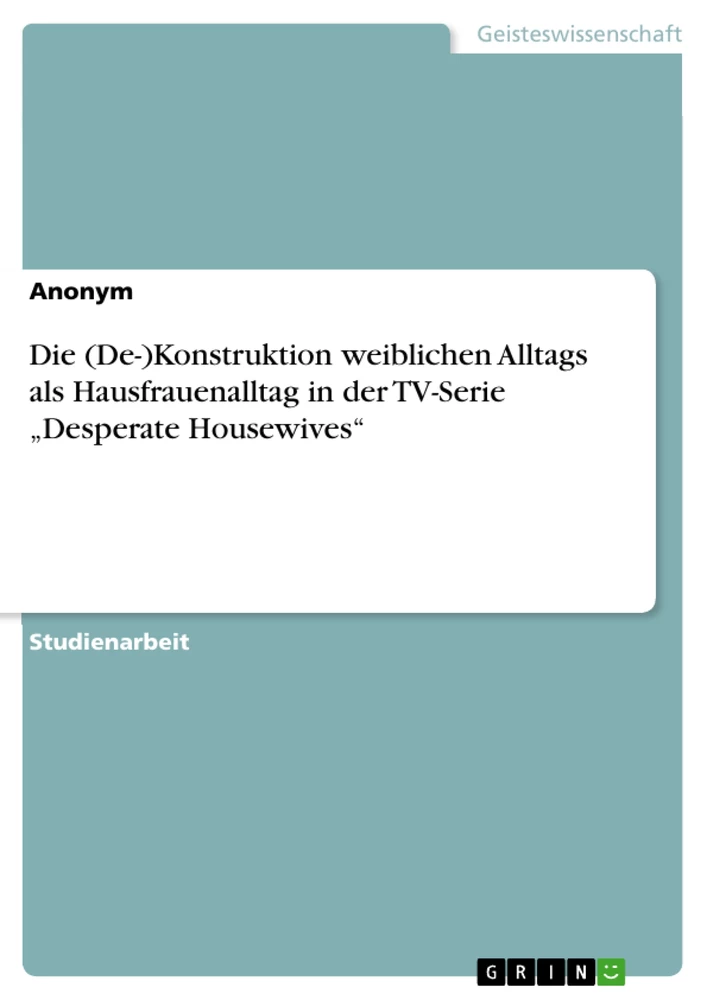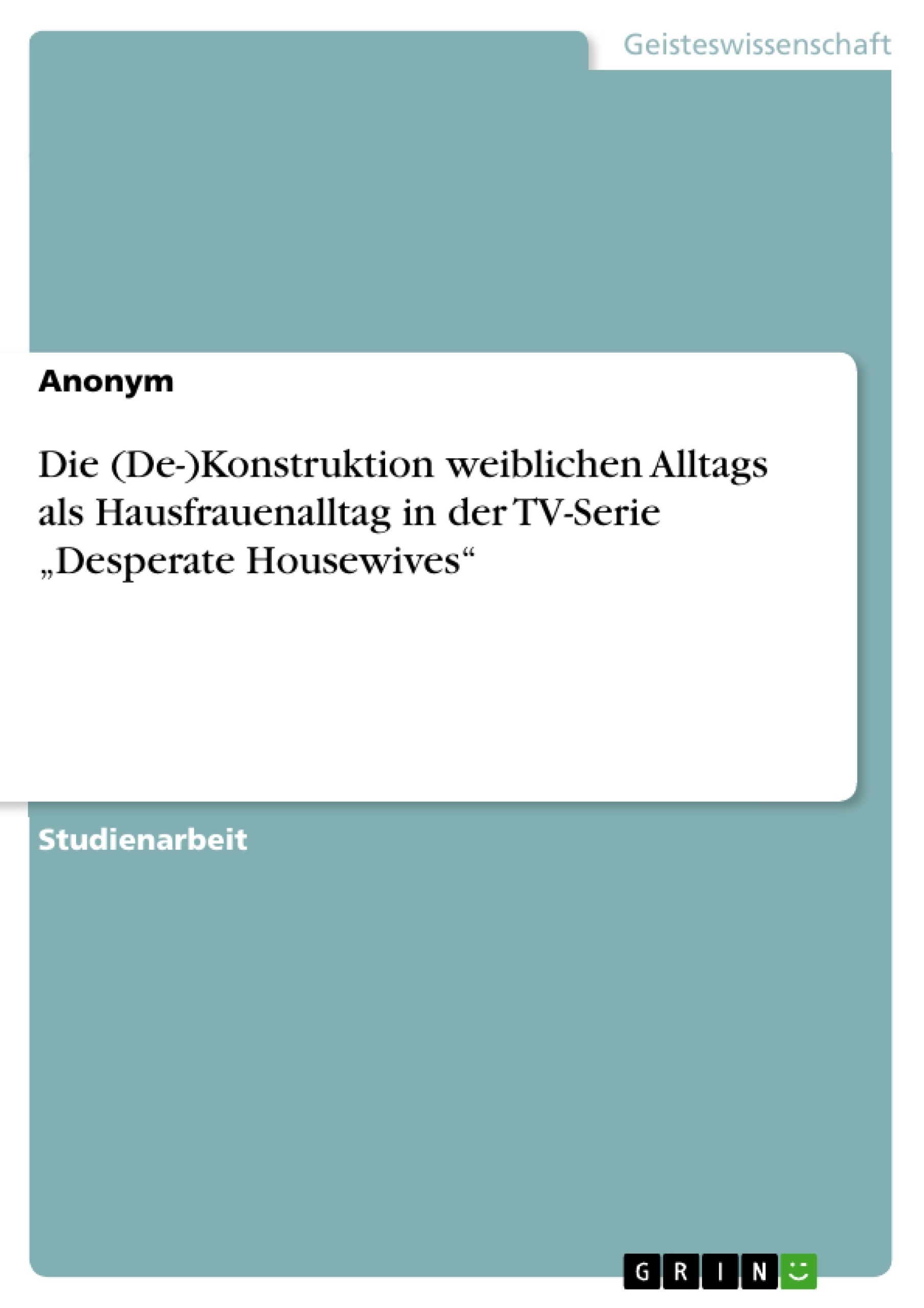Serielle TV-Formate, in denen der Alltag inhaltlich im Zentrum der Narration steht, haben in deutschen sowohl als auch im US-amerikanischen Fernsehprogrammen in den letzten Jahren Hochkonjunktur. Insbesondere das Hybridformat Doku-Soap zeigt in Deutschland häufig ausschließlich alltägliche Situationen von alltäglichen Menschen , die zu zu „Helden des All-tags“ werden. Aber auch die fiktionalen Fernsehserien, die ebenfalls die mediale Vermittlung von Alltag und Alltäglichem zum Gegenstand haben, erfreuen sich bereits seit Jahrzehnten großer Beliebtheit. Die Fokussierung auf Alltäglichkeit spielt in den Serien eine ebenso wichtige Rolle, wie die Darstellung von Momenten, in denen den Protagonisten die Kontrolle über die alltäglichen Routinen entgleitet. Neben diesen Höhen und Tiefen des Alltags(,) wird in den Sendungen eine Form des Alltags konstruiert, die Orientierung und Verlässlichkeit verspricht. Vor einigen Jahren war anstelle des Alltags eher das Außeralltägliche inhaltlicher Gegenstand der TV-Serien - es wurden statt Welten des Alltäglichen eher „Gegenwelten zum Alltäglichen“ geschaffen. Serielle Formate wie Lost, 24 und CSI lebten vom Besonderen, Gehobenen und Elitären im Gegensatz zum heute dominierenden Banalem, Gewöhnlichem und Unauffälligem. Die früheren „Gegenwelten des Alltäglichen“ waren in der Konsequenz jedoch nicht anschlussfähig an die eigene Lebenswelt der Rezipienten. Dies ist jedoch bei den heute dargestellten Welten des Alltäglichen der Fall und entscheidende Voraussetzung für bestimmte Aushandlungsprozesse, wie auch die Sicht auf Geschlechterrollen im Alltag der Rezipienten. Frühe, fiktive Fernsehserien wie die „Familie Schöllermann“ in den fünfziger und sechziger Jahren, über die „Familie Hesselbach“ in den Sechziger und Siebziger Jahren sowie die „Lindenstraße“ in den Achtzigern und zahlreiche folgende TV-Serien haben bis heute die „Dramaturgie des Normalen“ , die Inszenierung des Alltags zum Gegenstand. Durch diese Darstellung von Alltagen anderer, ‚gewöhnlicher‘ Menschen rückt das bisher Unauffällige und teilweise Selbstverständliche immer weiter in den Fokus und verändert seine Sichtbarkeit: der Alltag wird auffällig.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vorgehensweise
- Wissensbasierter Alltagsbegriff
- Weiblicher Alltag als Hausfrauenalltag in den US-amerikanischen Vorstädten
- Geschlechtliche Raum- und Kleidungssemantisierung
- Inhalt der TV-Serie Desperate Housewives
- Alltägliches weibliches Geschlechterwissen in Desperate Housewives
- Gabrielle Solis: die abhängige, materialistische Ehefrau
- Bree van de Kamp: die „perfekte“ Hausfrau
- Lynette Scavo: die „perfekte“ Mutter
- Susan Mayer: die Hilfsbedürftige
- Renee Perry: die „Andere“
- Performativität des weiblichen Alltags in Desperate Housewives
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung des weiblichen Alltags in der Fernsehserie „Desperate Housewives“. Ziel ist es, die Konstruktion eines „typisch weiblichen“ Alltags als Hausfrauenalltag zu analysieren und dessen Brüche und subversive Momente herauszuarbeiten. Dabei wird der Fokus auf die Performativität des weiblichen Alltags gelegt, um aufzuzeigen, dass dieser kein starres Konstrukt ist.
- Konstruktion des weiblichen Alltags als Hausfrauenalltag
- Historischer Kontext und gesellschaftliche Erwartungen an Hausfrauen
- Analyse der weiblichen Protagonistinnen und ihrer Handlungen
- Brüche und subversive Momente im dargestellten Alltag
- Performativität des weiblichen Alltags in „Desperate Housewives“
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Darstellung von Alltag in Fernsehserien ein und stellt die Serie „Desperate Housewives“ als Untersuchungsgegenstand vor. Sie hebt die Bedeutung von Fernsehserien als Spiegel unserer Gesellschaft und deren Rolle in der Konstruktion von Geschlechterrollen hervor. Besonders wird der Fokus auf die Brüche und die „Dramedy“-Natur der Serie gelegt, die eine dekonstruktivistische Analyse ermöglichen.
Vorgehensweise: Dieses Kapitel beschreibt die methodische Vorgehensweise der Arbeit. Es wird erläutert, wie der Alltagsbegriff definiert wird und wie die Analyse der Serie strukturiert ist. Die Arbeit kündigt die Untersuchung der historischen Wurzeln des Hausfrauenalltags an und die anschließende Analyse der Protagonistinnen im Hinblick auf Brüche und subversive Momente.
Wissensbasierter Alltagsbegriff: Dieses Kapitel skizziert den verwendeten wissensbasierten Alltagsbegriff. Alltagswissen wird als ein in sozio-kulturellen Kontexten anerkannter Wissensbestand definiert, der sowohl Selbstverständlichkeiten als auch abweichende Deutungsmuster umfasst. Der Fokus liegt auf dem alltäglichen Handeln der Protagonistinnen und der kritischen Hinterfragung dieses Handelns im Kontext der Gender Studies und des (Post-)Feminismus.
Weiblicher Alltag als Hausfrauenalltag in den US-amerikanischen Vorstädten: Dieses Kapitel beleuchtet den historischen Kontext des Hausfrauenalltags in den US-amerikanischen Vorstädten nach dem Zweiten Weltkrieg. Es analysiert die Rolle der Vororte als symbolische Repräsentation des „American Way of Life“ und deren Zusammenhang mit wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Strukturen, die den Hausfrauenalltag prägten. Hier wird der Zusammenhang zwischen dem Wohnort, der ökonomischen Situation und den gesellschaftlichen Erwartungen an Frauen erörtert.
Schlüsselwörter
Desperate Housewives, weiblicher Alltag, Hausfrauenalltag, Geschlechterrollen, Performativität, US-amerikanische Vorstädte, Gender Studies, (Post-)Feminismus, Dekonstruktion, Alltagswissen, Medienrepräsentation.
Häufig gestellte Fragen zur Analyse von "Desperate Housewives"
Was ist das Thema der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Darstellung des weiblichen Alltags in der Fernsehserie „Desperate Housewives“. Im Fokus steht die Konstruktion eines „typisch weiblichen“ Alltags als Hausfrauenalltag, seine Brüche und subversive Momente sowie die Performativität dieses Alltags.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht, wie ein „typisch weiblicher“ Hausfrauenalltag in der Serie konstruiert wird und welche Brüche und subversiven Momente diese Konstruktion aufweist. Besonderes Augenmerk liegt auf der Performativität des weiblichen Alltags, um aufzuzeigen, dass dieser kein starres Konstrukt ist.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Konstruktion des weiblichen Alltags als Hausfrauenalltag, den historischen Kontext und gesellschaftliche Erwartungen an Hausfrauen, die Analyse der weiblichen Protagonistinnen und ihrer Handlungen, Brüche und subversive Momente im dargestellten Alltag sowie die Performativität des weiblichen Alltags in „Desperate Housewives“.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Vorgehensweise, ein Kapitel zum wissensbasierten Alltagsbegriff, ein Kapitel zum weiblichen Alltag als Hausfrauenalltag in den US-amerikanischen Vorstädten, eine Analyse der weiblichen Protagonistinnen in „Desperate Housewives“, ein Kapitel zur Performativität des weiblichen Alltags in der Serie und ein Fazit.
Welche methodische Vorgehensweise wird angewendet?
Die Arbeit beschreibt explizit ihre methodische Vorgehensweise, einschließlich der Definition des Alltagsbegriffs und der Struktur der Serienanalyse. Es wird die Untersuchung der historischen Wurzeln des Hausfrauenalltags und die Analyse der Protagonistinnen im Hinblick auf Brüche und subversive Momente angekündigt.
Wie wird der Alltagsbegriff definiert?
Die Arbeit verwendet einen wissensbasierten Alltagsbegriff. Alltagswissen wird als in sozio-kulturellen Kontexten anerkannter Wissensbestand definiert, der sowohl Selbstverständlichkeiten als auch abweichende Deutungsmuster umfasst. Der Fokus liegt auf dem alltäglichen Handeln der Protagonistinnen und dessen kritischer Hinterfragung im Kontext der Gender Studies und des (Post-)Feminismus.
Welchen historischen Kontext beleuchtet die Arbeit?
Die Arbeit beleuchtet den historischen Kontext des Hausfrauenalltags in den US-amerikanischen Vorstädten nach dem Zweiten Weltkrieg. Analysiert wird die Rolle der Vororte als symbolische Repräsentation des „American Way of Life“ und deren Zusammenhang mit wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Strukturen, die den Hausfrauenalltag prägten.
Wie werden die weiblichen Protagonistinnen analysiert?
Die Arbeit analysiert die weiblichen Protagonistinnen (Gabrielle Solis, Bree van de Kamp, Lynette Scavo, Susan Mayer und Renee Perry) im Hinblick auf ihr alltägliches Handeln und die kritische Hinterfragung dieses Handelns im Kontext der Gender Studies und des (Post-)Feminismus. Dabei werden die individuellen Charaktere und ihre Handlungsweisen im Kontext des konstruierten Hausfrauenalltags untersucht.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Desperate Housewives, weiblicher Alltag, Hausfrauenalltag, Geschlechterrollen, Performativität, US-amerikanische Vorstädte, Gender Studies, (Post-)Feminismus, Dekonstruktion, Alltagswissen, Medienrepräsentation.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2012, Die (De-)Konstruktion weiblichen Alltags als Hausfrauenalltag in der TV-Serie „Desperate Housewives“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/195908