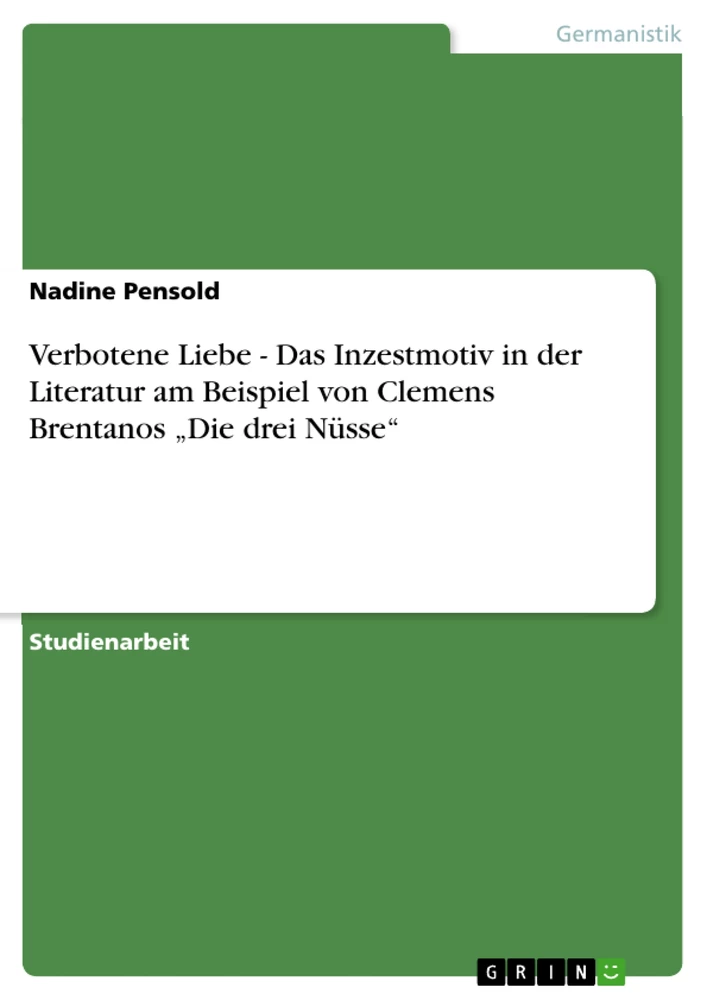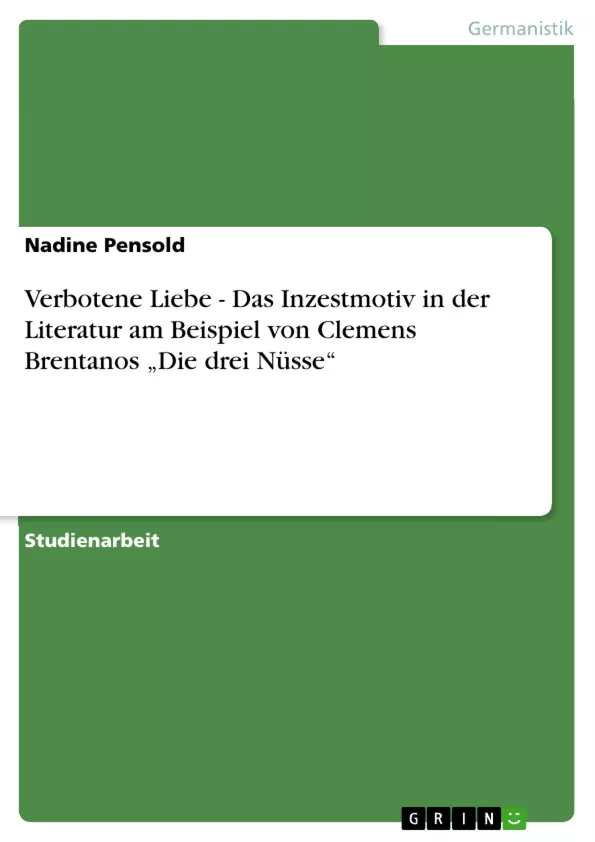Der Reiz am Verbotenen ist bereits seit der biblischen Schöpfungsgeschichte bekannt. Dem entgegen stehen Moral, Werte und Normen der Gesellschaft. Der hieraus resultierende menschliche Grundkonflikt bietet dabei seit der Antike Stoff für literarische und künstlerische Verarbeitung. Dies gilt auch für den Inzest. Der Prototyp für die literarische Bearbeitung des Themas ist dabei der Oedipus. Seither wurde das Motiv unzählige Male in wohl beinahe allen erdenklichen Ausführungen literarisch verwertet.
Vor allem die Autoren der Romantik bedienten sich dem Tabuthema. Einige Theoretiker gehen sogar davon aus, dass der literarische Inzest symbolisch für die zentrale Frage nach der Identität des bürgerlichen Subjekts in der Romantik ist. Das neue Selbstbewusstsein des Einzelnen fühlt sich durch die gesellschaftlichen Regeln beengt und in seiner individuellen Entwicklung eingeschränkt. Der Inzest spiegelt auf psychischer Ebene genau diese Empfindungen wieder und wird zum Transfer dieses Gefühls als literarisches Mittel genutzt. Es dokumentiert außerdem, dass der Befreiung des Selbst auch die Machtlosigkeit gegenüber überindividuellen Kräften steht. Diesem Gefühl zu entrinnen bleibt in der Romantik nur die Flucht in die Geborgenheit der anderen Seelenhälfte.
Diese Arbeit analysiert anhand einer Schicksalsnovelle von Clemens Brentano die inhaltliche und strukturelle Bedeutung des Inzestmotivs und schließt dabei die philosophische Überlegungen und mythologische Deutungen verbundener Motive mit ein.
Gliederung
I. Das Inzestmotiv in der Romantik
II. Das literarische Inzestmotiv in Clemens Brentanos „Die drei Nüsse“
1. Die Struktur des Inzestmotivs
1.1. Erzählerischer Aufbau und Funktion des Motivs
1.2. Zwischen Rätsel und Geheimnis
1.3. Die Nuss als Leitmotiv
2. Das Streben nach Einheit und Vollkommenheit
2.1. Figurenkonstellation der Novelle
2.2. Charakterisierung der Amélie
2.3. Exkurs: Platons Kugelmenschen
III. Das Inzestmotiv in der Literaturgeschichte
IV. Literaturverzeichnis
Verbotene Liebe - Der literarische Inzest
Häufig gestellte Fragen
Warum war das Inzestmotiv in der Romantik so populär?
Für Romantiker symbolisierte der literarische Inzest oft die Suche nach Identität und die Sehnsucht nach Einheit in einer einengenden bürgerlichen Gesellschaft.
Welches Werk von Clemens Brentano wird analysiert?
Die Analyse konzentriert sich auf die Schicksalsnovelle „Die drei Nüsse“ und die darin enthaltene inhaltliche und strukturelle Bedeutung des Inzestmotivs.
Was symbolisiert die Nuss in Brentanos Novelle?
Die Nuss fungiert als zentrales Leitmotiv, das zwischen Rätsel und Geheimnis steht und die Struktur der Erzählung maßgeblich prägt.
Welchen Bezug gibt es zu Platons Kugelmenschen?
Die Arbeit zieht mythologische Deutungen wie Platons Kugelmenschen heran, um das Streben der Figuren nach Vollkommenheit und Einheit zu erklären.
Wer gilt als literarischer Prototyp für das Inzestthema?
Der antike Mythos des Oedipus wird als Prototyp für die literarische Verarbeitung des Inzestmotivs in der Weltliteratur genannt.
- Quote paper
- Nadine Pensold (Author), 2008, Verbotene Liebe - Das Inzestmotiv in der Literatur am Beispiel von Clemens Brentanos „Die drei Nüsse“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/195962