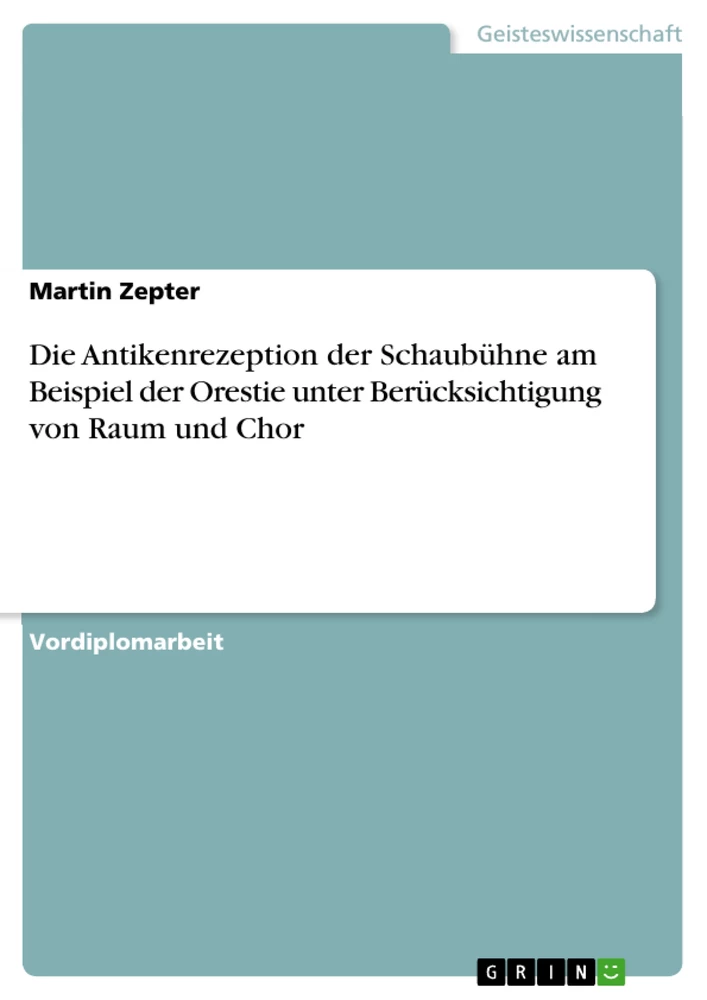"Denn dieses Theater erhält seine Bedeutung für uns nicht nur durch seine Exotik, sondern durch seine Wahrheit, nicht durch seine Ästhetik, sondern durch seine Ordnung. Und diese Wahrheit als solche kann nur eine Funktion sein, die Beziehung, die unseren modernen Blick mit einer sehr alten Gesellschaft verbindet: Dieses Theater betrifft uns durch seine Distanz. Das Problem liegt also nicht darin, es zu imitieren oder zu verfremden, sondern darin es begreiflich zu machen."
1. Einführung
Diese 1965 von Roland Barthes veröffentlichten Sätze stehen am Ende seines Aufsatzes "Über das griechische Theater". Und wie schon auf den Seiten zuvor, auf welchen er über die Institution, die Architektur, die Entstehungsgeschichte, die Texte und ihre Struktur, über sein Zeichensystem, eigentlich über alles, was man mit dem griechischen Theater in Verbindung bringen kann, gesprochen hat, wird auch hier klar: Das griechische Theater war weit mehr als wir uns, aus unserem modernen Theaterverständnis heraus, vorstellen können. Es war Volksversammlung und Volksfest, es war Reflexion über die Entwicklung des Staates, es war mystisch, es wirkte transzendental und es war vor allem allen Bürgern ausgesprochen wichtig, ein integraler Bestandteil des Lebens in der Polis, zumindest in der klassischen Zeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Der Chor
- Die Funktion des Chors im antiken Drama
- Die Rezeptionsgeschichte des Chors seit der Antike
- Peter Steins Chorkonzeption in der "Orestie"
- Der Raum
- Der Raum des antiken Theaters
- Die Institution
- Der Raum im Theater
- Peter Steins Raumkonzept in der "Orestie"
- Fazit
- Exkurs
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Antikenrezeption der Schaubühne am Beispiel der Orestie von Aischylos unter besonderer Berücksichtigung der Rolle von Raum und Chor. Das Ziel ist es, zu analysieren, wie die Schaubühne das antike Drama aufgreift und in ein modernes Kontext setzt. Dabei werden die Funktionen des Chors im antiken Drama, die Rezeptionsgeschichte des Chors, Peter Steins Chorkonzeption in der "Orestie", der Raum des antiken Theaters, die Institution des Theaters und Steins Raumkonzept in der "Orestie" beleuchtet.
- Antikenrezeption der Schaubühne
- Rolle des Chors im antiken Drama und in modernen Inszenierungen
- Bedeutung des Raumes im antiken Theater und in der Inszenierung der "Orestie"
- Peter Steins Inszenierungskonzept der "Orestie" am Beispiel von Raum und Chor
- Beziehung zwischen antikem und modernem Theater
Zusammenfassung der Kapitel
- Einführung: Die Einleitung stellt die "Orestie" als eines der wichtigsten Werke der griechischen Tragödie vor und erläutert die Bedeutung des 5. Jahrhunderts v. Chr. als Zeit der Entstehung der Tragödie. Sie befasst sich mit der Entwicklung der Tragödie von Aischylos, über Sophokles bis hin zu Euripides und hebt die Bedeutung der "Orestie" als ein Werk hervor, das über Generationen von Künstlern und Theatertheoretikern hinweg inspiriert hat.
- Der Chor: Dieses Kapitel behandelt die Funktion des Chors im antiken Drama, die Rezeptionsgeschichte des Chors seit der Antike und Peter Steins Chorkonzeption in der "Orestie". Es analysiert die verschiedenen Funktionen des Chors, seine Entwicklung und die besonderen Aspekte, die Peter Stein in seiner Inszenierung integriert hat.
- Der Raum: Dieses Kapitel konzentriert sich auf den Raum des antiken Theaters, die Institution des Theaters und den Raum im Theater. Es analysiert die Bedeutung des Raumes im antiken Drama, die Entwicklung des Theaterraumes und die Besonderheiten von Peter Steins Raumkonzept in der "Orestie".
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Antikenrezeption, Orestie, Aischylos, Schaubühne, Raum, Chor, Peter Stein, Theaterwissenschaft, griechisches Theater, Tragödie, Dramaturgie, Inszenierung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Besondere an Peter Steins Inszenierung der „Orestie“?
Peter Stein versuchte in seiner Inszenierung an der Schaubühne, das antike Drama durch ein spezifisches Raum- und Chorkonzept für das moderne Publikum begreiflich zu machen.
Welche Funktion hatte der Chor im antiken griechischen Theater?
Der Chor fungierte als Kommentator, Vermittler zwischen Publikum und Handlung sowie als Repräsentant der Gemeinschaft oder Polis.
Wie unterschied sich der antike Theaterraum vom modernen Theater?
Das antike Theater war ein offener, ritueller Ort der Volksversammlung, während das moderne Theater oft eine stärkere Trennung zwischen Bühne und Zuschauerraum aufweist.
Warum ist die „Orestie“ von Aischylos heute noch relevant?
Sie thematisiert fundamentale Fragen von Rache, Gerechtigkeit und den Übergang von der Blutrache zur staatlichen Rechtsordnung.
Was bedeutet „Antikenrezeption“ in der Theaterwissenschaft?
Es bezeichnet die Art und Weise, wie antike Stoffe, Formen und Theorien in späteren Epochen, wie der Moderne, aufgegriffen, interpretiert und neu inszeniert werden.
- Citation du texte
- Martin Zepter (Auteur), 2003, Die Antikenrezeption der Schaubühne am Beispiel der Orestie unter Berücksichtigung von Raum und Chor, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/19619